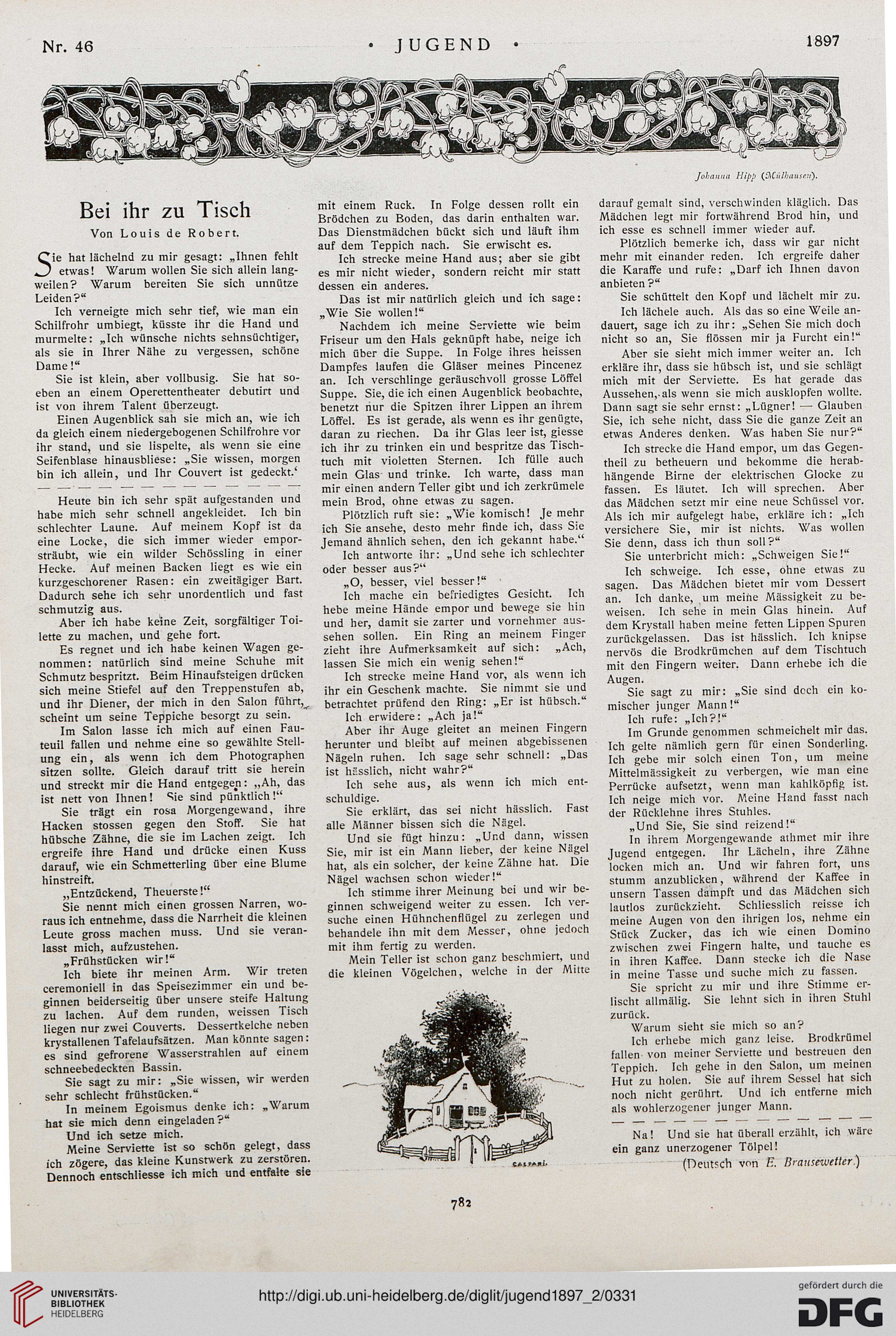Nr. 46
JUGEND
1897
Johanna Hipp (ßCülhauseu).
Bei ihr zu Tisch
Von Louis de Robert.
ie hat lächelnd zu mir gesagt: „Ihnen fehlt
etwas! Warum wollen Sie sich allein lang-
weilen? Warum bereiten Sie sich unnütze
Leiden?“
Ich verneigte mich sehr tief, wie man ein
Schilfrohr umbiegt, küsste ihr die Hand und
murmelte: „Ich wünsche nichts sehnsüchtiger,
als sie in Ihrer Nähe zu vergessen, schöne
Dame 1“
Sie ist klein, aber vollbusig. Sie hat so-
eben an einem Operettentheater debutirt und
ist von ihrem Talent überzeugt.
Einen Augenblick sah sie mich an, wie ich
da gleich einem niedergebogenen Schilfrohre vor
ihr stand, und sie lispelte, als wenn sie eine
Seifenblase hinausbliese: „Sie wissen, morgen
bin ich allein, und Ihr Couvert ist gedeckt.“
Heute bin ich sehr spät aufgestanden und
habe mich sehr schnell angekleidet. Ich bin
schlechter Laune. Auf meinem Kopf ist da
eine Locke, die sich immer wieder empor-
sträubt, wie ein wilder Schössling in einer
Hecke. Auf meinen Backen liegt es wie ein
kurzgeschorener Rasen: ein zweitägiger Bart.
Dadurch sehe ich sehr unordentlich und fast
schmutzig aus.
Aber ich habe keine Zeit, sorgfältiger Toi-
lette zu machen, und gehe fort.
Es regnet und ich habe keinen Wagen ge-
nommen: natürlich sind meine Schuhe mit
Schmutz bespritzt. Beim Hinaufsteigen drücken
sich meine Stiefel auf den Treppenstufen ab,
und ihr Diener, der mich in den Salon führt,
scheint um seine Teppiche besorgt zu sein.
Im Salon lasse ich mich auf einen Fau-
teuil fallen und nehme eine so gewählte Stell-
ung ein, als wenn ich dem Photographen
sitzen sollte. Gleich darauf tritt sie herein
und streckt mir die Hand entgegen: „Ah, das
ist nett von Ihnen! Sie sind pünktlich!“
Sie trägt ein rosa Morgengewand, ihre
Hacken stossen gegen den Stoff. Sie hat
hübsche Zähne, die sie im Lachen zeigt. Ich
ergreife ihre Hand und drücke einen Kuss
darauf, wie ein Schmetterling über eine Blume
hinstreift.
„Entzückend, Theuerste!“
Sie nennt mich einen grossen Narren, wo-
raus ich entnehme, dass die Narrheit die kleinen
Leute gross machen muss. Und sie veran-
lasst mich, aufzustehen.
„Frühstücken wir!“
Ich biete ihr meinen Arm. Wir treten
ceremoniell in das Speisezimmer ein und be-
ginnen beiderseitig über unsere steife Haltung
zu lachen. Auf dem runden, weissen Tisch
liegen nur zwei Couverts. Dessertkelche neben
krystallenen Tafelaufsätzen. Man könnte sagen:
es sind gefrorene Wasserstrahlen auf einem
schneebedeckten Bassin.
Sie sagt zu mir: „Sie wissen, wir werden
sehr schlecht frühstücken.“
In meinem Egoismus denke ich: „Warum
hat sie mich denn eingeladen?“
Und ich setze mich.
Meine Serviette ist so schön gelegt, dass
ich zögere, das kleine Kunstwerk zu zerstören.
Dennoch entschliesse ich mich und entfalte sie
mit einem Ruck. In Folge dessen rollt ein
Brödchen zu Boden, das darin enthalten war.
Das Dienstmädchen bückt sich und läuft ihm
auf dem Teppich nach. Sie erwischt es.
Ich strecke meine Hand aus; aber sie gibt
es mir nicht wieder, sondern reicht mir statt
dessen ein anderes.
Das ist mir natürlich gleich und ich sage:
„Wie Sie wollen!“
Nachdem ich meine Serviette wie beim
Friseur um den Hals geknüpft habe, neige ich
mich über die Suppe. In Folge ihres heissen
Dampfes laufen die Gläser meines Pincenez
an. Ich verschlinge geräuschvoll grosse Löffel
Suppe. Sie, die ich einen Augenblick beobachte,
benetzt nur die Spitzen ihrer Lippen an ihrem
Löffel. Es ist gerade, als wenn es ihr genügte,
daran zu riechen. Da ihr Glas leer ist, giesse
ich ihr zu trinken ein und bespritze das Tisch-
tuch mit violetten Sternen. Ich fülle auch
mein Glas und trinke. Ich warte, dass man
mir einen andern Teller gibt und ich zerkrümele
mein Brod, ohne etwas zu sagen.
Plötzlich ruft sie: „Wie komisch! Je mehr
ich Sie ansehe, desto mehr linde ich, dass Sie
Jemand ähnlich sehen, den ich gekannt habe.“
Ich antworte ihr: „Und sehe ich schlechter
oder besser aus?“
„O, besser, viel besser!“
Ich mache ein befriedigtes Gesicht. Ich
hebe meine Hände empor und bewege sie hin
und her, damit sie zarter und vornehmer aus-
sehen sollen. Ein Ring an meinem Finger
zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich: „Ach,
lassen Sie mich ein wenig sehen!“
Ich strecke meine Hand vor, als wenn ich
ihr ein Geschenk machte. Sie nimmt sie und
betrachtet prüfend den Ring: „Er ist hübsch.“
Ich erwidere: „Ach ja!“
Aber ihr Auge gleitet an meinen Fingern
herunter und bleibt auf meinen abgebissenen
Nägeln ruhen. Ich sage sehr schnell: „Das
ist hässlich, nicht wahr?“
Ich sehe aus, als wenn ich mich ent-
schuldige.
Sie erklärt, das sei nicht hässlich. Fast
alle Männer bissen sich die Nägel.
Und sie fügt hinzu: „Und dann, wissen
Sie, mir ist ein Mann lieber, der keine Nägel
hat, als ein solcher, der keine Zähne hat. Die
Nägel wachsen schon wieder!“
Ich stimme ihrer Meinung bei und wir be-
ginnen schweigend weiter zu essen. Ich ver-
suche einen Hühnchenflügel zu zerlegen und
behandele ihn mit dem Messer, ohne jedoch
mit ihm fertig zu werden.
Mein Teller ist schon ganz beschmiert, und
die kleinen Vögelchen, welche in der Mitte
darauf gemalt sind, verschwinden kläglich. Das
Mädchen legt mir fortwährend Brod hin, und
ich esse es schnell immer wieder auf.
Plötzlich bemerke ich, dass wir gar nicht
mehr mit einander reden. Ich ergreife daher
die Karaffe und rufe: „Darf ich Ihnen davon
anbieten ?“
Sie schüttelt den Kopf und lächelt mir zu.
Ich lächele auch. Als das so eine Weile an-
dauert, sage ich zu ihr: „Sehen Sie mich doch
nicht so an, Sie flössen mir ja Furcht ein!“
Aber sie sieht mich immer weiter an. Ich
erkläre ihr, dass sie hübsch ist, und sie schlägt
mich mit der Serviette. Es hat gerade das
Aussehen,-als wenn sie mich ausklopfen wollte.
Dann sagt sie sehr ernst: „Lügner! — Glauben
Sie, ich sehe nicht, dass Sie die ganze Zeit an
etwas Anderes denken. Was haben Sie nur?“
Ich strecke die Hand empor, um das Gegen-
theil zu betheuern und bekomme die herab-
hängende Birne der elektrischen Glocke zu
fassen. Es läutet. Ich will sprechen. Aber
das Mädchen setzt mir eine neue Schüssel vor.
Als ich mir aufgelegt habe, erkläre ich: „Ich
versichere Sie, mir ist nichts. Was wollen
Sie denn, dass ich thun soll?“
Sie unterbricht mich: „Schweigen Sie!“
Ich schweige. Ich esse, ohne etwas zu
sagen. Das Mädchen bietet mir vom Dessert
an. Ich danke, um meine Massigkeit zu be-
weisen. Ich sehe in mein Glas hinein. Auf
dem Krystall haben meine fetten Lippen Spuren
zurückgelassen. Das ist hässlich. Ich knipse
nervös die Brodkrümchen auf dem Tischtuch
mit den Fingern weiter. Dann erhebe ich die
Augen.
Sie sagt zu mir: „Sie sind doch ein ko-
mischer junger Mann!“
Ich rufe: „Ich?!“
Im Grunde genommen schmeichelt mir das.
Ich gelte nämlich gern für einen Sonderling.
Ich gebe mir solch einen Ton, um meine
Mittelmässigkeit zu verbergen, wie man eine
Perrücke aufsetzt, wenn man kahlköpfig ist.
Ich neige mich vor. Meine Hand fasst nach
der Rücklehne ihres Stuhles.
„Und Sie, Sie sind reizend!“
In ihrem Morgengewande athmet mir ihre
Jugend entgegen. Ihr Lächeln, ihre Zähne
locken mich an. Und wir fahren fort, uns
stumm anzublicken, während der Kaffee in
unsern Tassen dampft und das Mädchen sich
lautlos zurückzieht. Schliesslich reisse ich
meine Augen von den ihrigen los, nehme ein
Stück Zucker, das ich wie einen Domino
zwischen zwei Fingern halte, und tauche es
in ihren Kaffee. Dann stecke ich die Nase
in meine Tasse und suche mich zu fassen.
Sie spricht zu mir und ihre Stimme er-
lischt allmälig. Sie lehnt sich in ihren Stuhl
zurück.
Warum sieht sie mich so an?
Ich erhebe mich ganz leise. Brodkrümel
fallen von meiner Serviette und bestreuen den
Teppich. Ich gehe in den Salon, um meinen
Hut zu holen. Sie auf ihrem Sessel hat sich
noch nicht gerührt. Und ich entferne mich
als wohlerzogener junger Mann.
Na! Und sie hat überall erzählt, ich wäre
ein ganz unerzogener Tölpel!
(Deutsch von E. Rrausewitter.)
782
JUGEND
1897
Johanna Hipp (ßCülhauseu).
Bei ihr zu Tisch
Von Louis de Robert.
ie hat lächelnd zu mir gesagt: „Ihnen fehlt
etwas! Warum wollen Sie sich allein lang-
weilen? Warum bereiten Sie sich unnütze
Leiden?“
Ich verneigte mich sehr tief, wie man ein
Schilfrohr umbiegt, küsste ihr die Hand und
murmelte: „Ich wünsche nichts sehnsüchtiger,
als sie in Ihrer Nähe zu vergessen, schöne
Dame 1“
Sie ist klein, aber vollbusig. Sie hat so-
eben an einem Operettentheater debutirt und
ist von ihrem Talent überzeugt.
Einen Augenblick sah sie mich an, wie ich
da gleich einem niedergebogenen Schilfrohre vor
ihr stand, und sie lispelte, als wenn sie eine
Seifenblase hinausbliese: „Sie wissen, morgen
bin ich allein, und Ihr Couvert ist gedeckt.“
Heute bin ich sehr spät aufgestanden und
habe mich sehr schnell angekleidet. Ich bin
schlechter Laune. Auf meinem Kopf ist da
eine Locke, die sich immer wieder empor-
sträubt, wie ein wilder Schössling in einer
Hecke. Auf meinen Backen liegt es wie ein
kurzgeschorener Rasen: ein zweitägiger Bart.
Dadurch sehe ich sehr unordentlich und fast
schmutzig aus.
Aber ich habe keine Zeit, sorgfältiger Toi-
lette zu machen, und gehe fort.
Es regnet und ich habe keinen Wagen ge-
nommen: natürlich sind meine Schuhe mit
Schmutz bespritzt. Beim Hinaufsteigen drücken
sich meine Stiefel auf den Treppenstufen ab,
und ihr Diener, der mich in den Salon führt,
scheint um seine Teppiche besorgt zu sein.
Im Salon lasse ich mich auf einen Fau-
teuil fallen und nehme eine so gewählte Stell-
ung ein, als wenn ich dem Photographen
sitzen sollte. Gleich darauf tritt sie herein
und streckt mir die Hand entgegen: „Ah, das
ist nett von Ihnen! Sie sind pünktlich!“
Sie trägt ein rosa Morgengewand, ihre
Hacken stossen gegen den Stoff. Sie hat
hübsche Zähne, die sie im Lachen zeigt. Ich
ergreife ihre Hand und drücke einen Kuss
darauf, wie ein Schmetterling über eine Blume
hinstreift.
„Entzückend, Theuerste!“
Sie nennt mich einen grossen Narren, wo-
raus ich entnehme, dass die Narrheit die kleinen
Leute gross machen muss. Und sie veran-
lasst mich, aufzustehen.
„Frühstücken wir!“
Ich biete ihr meinen Arm. Wir treten
ceremoniell in das Speisezimmer ein und be-
ginnen beiderseitig über unsere steife Haltung
zu lachen. Auf dem runden, weissen Tisch
liegen nur zwei Couverts. Dessertkelche neben
krystallenen Tafelaufsätzen. Man könnte sagen:
es sind gefrorene Wasserstrahlen auf einem
schneebedeckten Bassin.
Sie sagt zu mir: „Sie wissen, wir werden
sehr schlecht frühstücken.“
In meinem Egoismus denke ich: „Warum
hat sie mich denn eingeladen?“
Und ich setze mich.
Meine Serviette ist so schön gelegt, dass
ich zögere, das kleine Kunstwerk zu zerstören.
Dennoch entschliesse ich mich und entfalte sie
mit einem Ruck. In Folge dessen rollt ein
Brödchen zu Boden, das darin enthalten war.
Das Dienstmädchen bückt sich und läuft ihm
auf dem Teppich nach. Sie erwischt es.
Ich strecke meine Hand aus; aber sie gibt
es mir nicht wieder, sondern reicht mir statt
dessen ein anderes.
Das ist mir natürlich gleich und ich sage:
„Wie Sie wollen!“
Nachdem ich meine Serviette wie beim
Friseur um den Hals geknüpft habe, neige ich
mich über die Suppe. In Folge ihres heissen
Dampfes laufen die Gläser meines Pincenez
an. Ich verschlinge geräuschvoll grosse Löffel
Suppe. Sie, die ich einen Augenblick beobachte,
benetzt nur die Spitzen ihrer Lippen an ihrem
Löffel. Es ist gerade, als wenn es ihr genügte,
daran zu riechen. Da ihr Glas leer ist, giesse
ich ihr zu trinken ein und bespritze das Tisch-
tuch mit violetten Sternen. Ich fülle auch
mein Glas und trinke. Ich warte, dass man
mir einen andern Teller gibt und ich zerkrümele
mein Brod, ohne etwas zu sagen.
Plötzlich ruft sie: „Wie komisch! Je mehr
ich Sie ansehe, desto mehr linde ich, dass Sie
Jemand ähnlich sehen, den ich gekannt habe.“
Ich antworte ihr: „Und sehe ich schlechter
oder besser aus?“
„O, besser, viel besser!“
Ich mache ein befriedigtes Gesicht. Ich
hebe meine Hände empor und bewege sie hin
und her, damit sie zarter und vornehmer aus-
sehen sollen. Ein Ring an meinem Finger
zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich: „Ach,
lassen Sie mich ein wenig sehen!“
Ich strecke meine Hand vor, als wenn ich
ihr ein Geschenk machte. Sie nimmt sie und
betrachtet prüfend den Ring: „Er ist hübsch.“
Ich erwidere: „Ach ja!“
Aber ihr Auge gleitet an meinen Fingern
herunter und bleibt auf meinen abgebissenen
Nägeln ruhen. Ich sage sehr schnell: „Das
ist hässlich, nicht wahr?“
Ich sehe aus, als wenn ich mich ent-
schuldige.
Sie erklärt, das sei nicht hässlich. Fast
alle Männer bissen sich die Nägel.
Und sie fügt hinzu: „Und dann, wissen
Sie, mir ist ein Mann lieber, der keine Nägel
hat, als ein solcher, der keine Zähne hat. Die
Nägel wachsen schon wieder!“
Ich stimme ihrer Meinung bei und wir be-
ginnen schweigend weiter zu essen. Ich ver-
suche einen Hühnchenflügel zu zerlegen und
behandele ihn mit dem Messer, ohne jedoch
mit ihm fertig zu werden.
Mein Teller ist schon ganz beschmiert, und
die kleinen Vögelchen, welche in der Mitte
darauf gemalt sind, verschwinden kläglich. Das
Mädchen legt mir fortwährend Brod hin, und
ich esse es schnell immer wieder auf.
Plötzlich bemerke ich, dass wir gar nicht
mehr mit einander reden. Ich ergreife daher
die Karaffe und rufe: „Darf ich Ihnen davon
anbieten ?“
Sie schüttelt den Kopf und lächelt mir zu.
Ich lächele auch. Als das so eine Weile an-
dauert, sage ich zu ihr: „Sehen Sie mich doch
nicht so an, Sie flössen mir ja Furcht ein!“
Aber sie sieht mich immer weiter an. Ich
erkläre ihr, dass sie hübsch ist, und sie schlägt
mich mit der Serviette. Es hat gerade das
Aussehen,-als wenn sie mich ausklopfen wollte.
Dann sagt sie sehr ernst: „Lügner! — Glauben
Sie, ich sehe nicht, dass Sie die ganze Zeit an
etwas Anderes denken. Was haben Sie nur?“
Ich strecke die Hand empor, um das Gegen-
theil zu betheuern und bekomme die herab-
hängende Birne der elektrischen Glocke zu
fassen. Es läutet. Ich will sprechen. Aber
das Mädchen setzt mir eine neue Schüssel vor.
Als ich mir aufgelegt habe, erkläre ich: „Ich
versichere Sie, mir ist nichts. Was wollen
Sie denn, dass ich thun soll?“
Sie unterbricht mich: „Schweigen Sie!“
Ich schweige. Ich esse, ohne etwas zu
sagen. Das Mädchen bietet mir vom Dessert
an. Ich danke, um meine Massigkeit zu be-
weisen. Ich sehe in mein Glas hinein. Auf
dem Krystall haben meine fetten Lippen Spuren
zurückgelassen. Das ist hässlich. Ich knipse
nervös die Brodkrümchen auf dem Tischtuch
mit den Fingern weiter. Dann erhebe ich die
Augen.
Sie sagt zu mir: „Sie sind doch ein ko-
mischer junger Mann!“
Ich rufe: „Ich?!“
Im Grunde genommen schmeichelt mir das.
Ich gelte nämlich gern für einen Sonderling.
Ich gebe mir solch einen Ton, um meine
Mittelmässigkeit zu verbergen, wie man eine
Perrücke aufsetzt, wenn man kahlköpfig ist.
Ich neige mich vor. Meine Hand fasst nach
der Rücklehne ihres Stuhles.
„Und Sie, Sie sind reizend!“
In ihrem Morgengewande athmet mir ihre
Jugend entgegen. Ihr Lächeln, ihre Zähne
locken mich an. Und wir fahren fort, uns
stumm anzublicken, während der Kaffee in
unsern Tassen dampft und das Mädchen sich
lautlos zurückzieht. Schliesslich reisse ich
meine Augen von den ihrigen los, nehme ein
Stück Zucker, das ich wie einen Domino
zwischen zwei Fingern halte, und tauche es
in ihren Kaffee. Dann stecke ich die Nase
in meine Tasse und suche mich zu fassen.
Sie spricht zu mir und ihre Stimme er-
lischt allmälig. Sie lehnt sich in ihren Stuhl
zurück.
Warum sieht sie mich so an?
Ich erhebe mich ganz leise. Brodkrümel
fallen von meiner Serviette und bestreuen den
Teppich. Ich gehe in den Salon, um meinen
Hut zu holen. Sie auf ihrem Sessel hat sich
noch nicht gerührt. Und ich entferne mich
als wohlerzogener junger Mann.
Na! Und sie hat überall erzählt, ich wäre
ein ganz unerzogener Tölpel!
(Deutsch von E. Rrausewitter.)
782