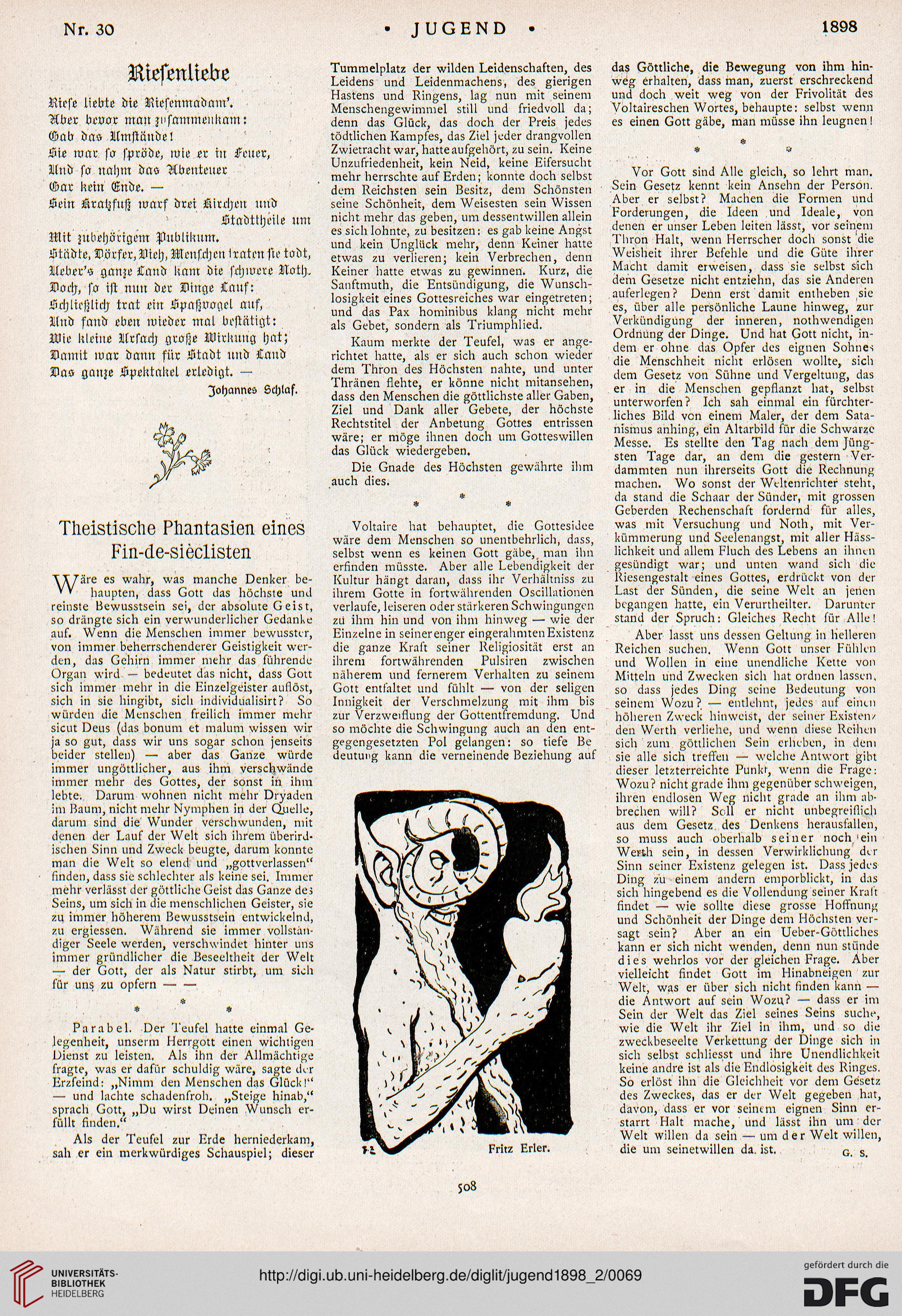Nr. 30
JUGEND
1898
Kiesenüebe
Rieft liebte die Meftnmadam'.
Ader bevor manznsammrnkam:
Gab da» Umstände!
Sie war so spröde, wie er in Feuer,
And so nahm das Abenteuer
Gar kein Ende. —
Sein Lratzfuß warf drei Kirchen und
Stadtiheile um
Mit zubehörigem Publikum.
Städte, Dörfer, Vieh, Menschen iraten sie todt,
Aeber's ganze Land kam die schwere Roth.
Doch, so ist nun der Dinge Lauf:
Schließlich trat ein Spaßvogel auf,
And fand eben wieder mal bestätigt:
Wie kleine Arsach große Wirkung hat;
Damit :var dann für Stadt und Land
Das ganze Spektakel erledigt. —
Johannes Schlaf.
Theistisclie Phantasien eines
Fin-de-sieclisten
Wäre es wahr, was manche Denker be-
haupten, dass Gott das höchste und
reinste Bewusstsein sei, der absolute Geist,
so drängte sich ein verwunderlicher Gedanke
auf. Wenn die Menschen immer bewusster,
von immer beherrschenderer Geistigkeit wer-
den, das Gehirn immer mehr das führende
Organ wird — bedeutet das nicht, dass Gott
sich immer mehr in die Einzelgeister auflöst,
sich in sie hingibt, sich individualisirt? So
würden die Menschen freilich immer mehr
sicut Deus (das bonum et malum wissen wir
ja so gut, dass wir uns sogar schon jenseits
beider stellen) — aber das Ganze würde
immer ungöttlicher, aus ihm verschwände
immer mehr des Gottes, der sonst in ihm
lebte. Darum wohnen nicht mehr Dryaden
im Baum, nicht mehr Nymphen in der Quelle,
darum sind die Wunder verschwunden, mit
denen der Lauf der Welt sich ihrem überird-
ischen Sinn und Zweck beugte, darum konnte
man die Welt so elend und „gottverlassen“
finden, dass sie schlechter als keine sei. Immer
mehr verlässt der göttliche Geist das Ganze des
Seins, um sich in die menschlichen Geister, sie
zu immer höherem Bewusstsein entwickelnd,
zu ergiessen. Während sie immer vollstän-
diger Seele werden, verschwindet hinter uns
immer gründlicher die Beseeltheit der Welt
— der Gott, der als Natur stirbt, um sich
für uns zu opfern --
Parabel. Der Teufel hatte einmal Ge-
legenheit, unseren Herrgott einen wichtigen
Dienst zu leisten. Als ihn der Allmächtige
fragte, was er dafür schuldig wäre, sagte der
Erzfeind: „Nimm den Menschen das Glück!“
-— und lachte schadenfroh. „Steige hinab,“
sprach Gott, „Du wirst Deinen Wunsch er-
füllt finden.“
Als der Teufel zur Erde herniederkam,
sah er ein merkwürdiges Schauspiel; dieser
Tummelplatz der wilden Leidenschaften, des
Leidens und Leidenmachens, des gierigen
Hastens und Ringens, lag nun mit seinem
Menschengewimmel still und friedvoll da;
denn das Glück, das doch der Preis jedes
tödtlichen Kampfes, das Ziel jeder drangvollen
Zwietracht war, hatte aufgehört, zu sein. Keine
Unzufriedenheit, kein Neid, keine Eifersucht
mehr herrschte auf Erden; konnte doch selbst
dem Reichsten sein Besitz, dem Schönsten
seine Schönheit, dem Weisesten sein Wissen
nicht mehr das geben, um dessentwillen allein
es sich lohnte, zu besitzen: es gab keine Angst
und kein Unglück mehr, denn Keiner hatte
etwas zu verlieren; kein Verbrechen, denn
Keiner hatte etwas zu gewinnen. Kurz, die
Sanftmuth, die Entsündigung, die Wunsch-
losigkeit eines Gottesreiches war eingetreten;
und das Pax hominibus klang nicht mehr
als Gebet, sondern als Triumphlied.
Kaum merkte der Teufel, was er ange-
richtet hatte, als er sich auch schon wieder
dem Thron des Höchsten nahte, und unter
Thronen flehte, er könne nicht mitansehen,
dass den Menschen die göttlichste aller Gaben,
Ziel und Dank aller Gebete, der höchste
Rechtstitel der Anbetung Gottes entrissen
wäre; er möge ihnen doch um Gotteswillen
das Glück wiedergeben.
Die Gnade des Höchsten gewährte ihm
auch dies.
Voltaire hat behauptet, die Gottesidee
wäre dem Menschen so unentbehrlich, dass,
selbst wenn es keinen Gott gäbe, man ihn
erfinden müsste. Aber alle Lebendigkeit der
Kultur hängt daran, dass ihr Verhältniss zu
ihrem Gotte in fortwährenden Oscillationen
verlaufe, leiseren oder stärkeren Schwingungen
zu ihm hin und von ihm hinweg — wie der
Einzelne in seiner enger eingerahmten Existenz
die ganze Kraft seiner Religiosität erst an
ihrem fortwährenden Pulsiren zwischen
näherem und fernerem Verhalten zu seinem
Gott entfaltet und fühlt — von der seligen
Innigkeit der Verschmelzung mit ihm bis
zur Verzweiflung der Gottentfremdung. Und
so möchte die Schwingung auch an den ent-
gegengesetzten Pol gelangen: so tiefe Be
deutung kann die verneinende Beziehung auf
508
das Göttliche, die Bewegung von ihm hin-
weg erhalten, dass man, zuerst erschreckend
und doch weit weg von der Frivolität des
Voltaireschen Wortes, behaupte: selbst wenn
es einen Gott gäbe, man müsse ihn leugnen!
Vor Gott sind Alle gleich, so lehrt man.
Sein Gesetz kennt kein Ansehn der Person.
Aber er selbst? Machen die Formen und
Forderungen, die Ideen und Ideale, von
denen er unser Leben leiten lässt, vor seinem
Thron Halt, wenn Herrscher doch sonst 'die
Weisheit ihrer Befehle und die Güte ihrer
Macht damit erweisen, dass sie selbst sich
dem Gesetze nicht entziehn, das sie Anderen
auferlegen? Denn erst damit entheben sie
es, über alle persönliche Laune hinweg, zur
Verkündigung der inneren, nothwendigen
Ordnung der Dinge. Und hat Gott nicht, in-
dem er ohne das Opfer des eignen Sohnes
die Menschheit nicht erlösen wollte, sich
dem Gesetz von Sühne und Vergeltung, das
er in die Menschen gepflanzt hat, selbst
unterworfen? Ich sah einmal ein fürchter-
liches Bild von einem Maler, der dem Sata-
nismus anhing, ein Altarbild für die Schwarze
Messe. Es stellte den Tag nach dem Jüng-
sten Tage dar, an dem die gestern Ver-
dammten nun ihrerseits Gott die Rechnung
machen. Wo sonst der Weltenrichter steht,
da stand die Schaar der Sünder, mit grossen
Geberden Rechenschaft fordernd für alles,
was mit Versuchung und Noth, mit Ver-
kümmerung und Seelenangst, mit aller Häss-
lichkeit und allem Fluch des Lebens an ihnen
gesündigt war; und unten wand sich die
Riesengestalt eines Gottes, erdrückt von der
Last der Sünden, die seine Welt an jenen
begangen hatte, ein Verurtheilter. Darunter
stand der Spruch: Gleiches Recht für Alle!
Aber lasst uns dessen Geltung in helleren
Reichen suchen. Wenn Gott unser Fühlen
und Wollen in eine unendliche Kette von
Mitteln und Zwecken sich hat ordnen lassen,
so dass jedes Ding seine Bedeutung von
seinem Wozu? — entlehnt, jedes auf einen
höheren Zweck hinweist, der seiner Existenz
den Werth verliehe, und wenn diese Reihen
sich zum göttlichen Sein erheben, in dem
sie alle sich treffen — welche Antwort gibt
dieser letzterreichte Punkt, wenn die Frage:
Wozu? nicht grade ihm gegenüber schweigen,
ihren endlosen Weg nicht grade an ihm ab-
brechen will? Soll er nicht unbegreiflich
aus dem Gesetz, des Denkens herausfallen,
so muss auch oberhalb seiner noch ein
Werth sein, in dessen Verwirklichung du-
Sinn seiner Existenz gelegen ist. Dass jedes
Ding zu einem andern emporblickt, in das
sich hingebend es die Vollendung seiner Kralt
findet — wie sollte diese grosse Hoffnung
und Schönheit der Dinge dem Höchsten ver-
sagt sein? Aber an ein Ueber-Göttliches
kann er sich nicht wenden, denn nun stünde
dies wehrlos vor der gleichen Frage. Aber
vielleicht findet Gott im Hinabneigen zur
Welt, was er über sich nicht finden kann —
die Antwort auf sein Wozu? — dass er im
Sein der Welt das Ziel seines Seins suche,
wie die Welt ihr Ziel in ihm, und so die
zweckbeseelte Verkettung der Dinge sich in
sich selbst schliesst und ihre Unendlichkeit
keine andre ist als die Endlosigkeit des Ringes.
So erlöst ihn die Gleichheit vor dem Gesetz
des Zweckes, das er der Welt gegeben hat,
davon, dass er vor seinem eignen Sinn er-
starrt Halt mache, und lässt ihn um der
Welt willen da sein — um der Welt willen,
die um seinetwillen da. ist. G s
JUGEND
1898
Kiesenüebe
Rieft liebte die Meftnmadam'.
Ader bevor manznsammrnkam:
Gab da» Umstände!
Sie war so spröde, wie er in Feuer,
And so nahm das Abenteuer
Gar kein Ende. —
Sein Lratzfuß warf drei Kirchen und
Stadtiheile um
Mit zubehörigem Publikum.
Städte, Dörfer, Vieh, Menschen iraten sie todt,
Aeber's ganze Land kam die schwere Roth.
Doch, so ist nun der Dinge Lauf:
Schließlich trat ein Spaßvogel auf,
And fand eben wieder mal bestätigt:
Wie kleine Arsach große Wirkung hat;
Damit :var dann für Stadt und Land
Das ganze Spektakel erledigt. —
Johannes Schlaf.
Theistisclie Phantasien eines
Fin-de-sieclisten
Wäre es wahr, was manche Denker be-
haupten, dass Gott das höchste und
reinste Bewusstsein sei, der absolute Geist,
so drängte sich ein verwunderlicher Gedanke
auf. Wenn die Menschen immer bewusster,
von immer beherrschenderer Geistigkeit wer-
den, das Gehirn immer mehr das führende
Organ wird — bedeutet das nicht, dass Gott
sich immer mehr in die Einzelgeister auflöst,
sich in sie hingibt, sich individualisirt? So
würden die Menschen freilich immer mehr
sicut Deus (das bonum et malum wissen wir
ja so gut, dass wir uns sogar schon jenseits
beider stellen) — aber das Ganze würde
immer ungöttlicher, aus ihm verschwände
immer mehr des Gottes, der sonst in ihm
lebte. Darum wohnen nicht mehr Dryaden
im Baum, nicht mehr Nymphen in der Quelle,
darum sind die Wunder verschwunden, mit
denen der Lauf der Welt sich ihrem überird-
ischen Sinn und Zweck beugte, darum konnte
man die Welt so elend und „gottverlassen“
finden, dass sie schlechter als keine sei. Immer
mehr verlässt der göttliche Geist das Ganze des
Seins, um sich in die menschlichen Geister, sie
zu immer höherem Bewusstsein entwickelnd,
zu ergiessen. Während sie immer vollstän-
diger Seele werden, verschwindet hinter uns
immer gründlicher die Beseeltheit der Welt
— der Gott, der als Natur stirbt, um sich
für uns zu opfern --
Parabel. Der Teufel hatte einmal Ge-
legenheit, unseren Herrgott einen wichtigen
Dienst zu leisten. Als ihn der Allmächtige
fragte, was er dafür schuldig wäre, sagte der
Erzfeind: „Nimm den Menschen das Glück!“
-— und lachte schadenfroh. „Steige hinab,“
sprach Gott, „Du wirst Deinen Wunsch er-
füllt finden.“
Als der Teufel zur Erde herniederkam,
sah er ein merkwürdiges Schauspiel; dieser
Tummelplatz der wilden Leidenschaften, des
Leidens und Leidenmachens, des gierigen
Hastens und Ringens, lag nun mit seinem
Menschengewimmel still und friedvoll da;
denn das Glück, das doch der Preis jedes
tödtlichen Kampfes, das Ziel jeder drangvollen
Zwietracht war, hatte aufgehört, zu sein. Keine
Unzufriedenheit, kein Neid, keine Eifersucht
mehr herrschte auf Erden; konnte doch selbst
dem Reichsten sein Besitz, dem Schönsten
seine Schönheit, dem Weisesten sein Wissen
nicht mehr das geben, um dessentwillen allein
es sich lohnte, zu besitzen: es gab keine Angst
und kein Unglück mehr, denn Keiner hatte
etwas zu verlieren; kein Verbrechen, denn
Keiner hatte etwas zu gewinnen. Kurz, die
Sanftmuth, die Entsündigung, die Wunsch-
losigkeit eines Gottesreiches war eingetreten;
und das Pax hominibus klang nicht mehr
als Gebet, sondern als Triumphlied.
Kaum merkte der Teufel, was er ange-
richtet hatte, als er sich auch schon wieder
dem Thron des Höchsten nahte, und unter
Thronen flehte, er könne nicht mitansehen,
dass den Menschen die göttlichste aller Gaben,
Ziel und Dank aller Gebete, der höchste
Rechtstitel der Anbetung Gottes entrissen
wäre; er möge ihnen doch um Gotteswillen
das Glück wiedergeben.
Die Gnade des Höchsten gewährte ihm
auch dies.
Voltaire hat behauptet, die Gottesidee
wäre dem Menschen so unentbehrlich, dass,
selbst wenn es keinen Gott gäbe, man ihn
erfinden müsste. Aber alle Lebendigkeit der
Kultur hängt daran, dass ihr Verhältniss zu
ihrem Gotte in fortwährenden Oscillationen
verlaufe, leiseren oder stärkeren Schwingungen
zu ihm hin und von ihm hinweg — wie der
Einzelne in seiner enger eingerahmten Existenz
die ganze Kraft seiner Religiosität erst an
ihrem fortwährenden Pulsiren zwischen
näherem und fernerem Verhalten zu seinem
Gott entfaltet und fühlt — von der seligen
Innigkeit der Verschmelzung mit ihm bis
zur Verzweiflung der Gottentfremdung. Und
so möchte die Schwingung auch an den ent-
gegengesetzten Pol gelangen: so tiefe Be
deutung kann die verneinende Beziehung auf
508
das Göttliche, die Bewegung von ihm hin-
weg erhalten, dass man, zuerst erschreckend
und doch weit weg von der Frivolität des
Voltaireschen Wortes, behaupte: selbst wenn
es einen Gott gäbe, man müsse ihn leugnen!
Vor Gott sind Alle gleich, so lehrt man.
Sein Gesetz kennt kein Ansehn der Person.
Aber er selbst? Machen die Formen und
Forderungen, die Ideen und Ideale, von
denen er unser Leben leiten lässt, vor seinem
Thron Halt, wenn Herrscher doch sonst 'die
Weisheit ihrer Befehle und die Güte ihrer
Macht damit erweisen, dass sie selbst sich
dem Gesetze nicht entziehn, das sie Anderen
auferlegen? Denn erst damit entheben sie
es, über alle persönliche Laune hinweg, zur
Verkündigung der inneren, nothwendigen
Ordnung der Dinge. Und hat Gott nicht, in-
dem er ohne das Opfer des eignen Sohnes
die Menschheit nicht erlösen wollte, sich
dem Gesetz von Sühne und Vergeltung, das
er in die Menschen gepflanzt hat, selbst
unterworfen? Ich sah einmal ein fürchter-
liches Bild von einem Maler, der dem Sata-
nismus anhing, ein Altarbild für die Schwarze
Messe. Es stellte den Tag nach dem Jüng-
sten Tage dar, an dem die gestern Ver-
dammten nun ihrerseits Gott die Rechnung
machen. Wo sonst der Weltenrichter steht,
da stand die Schaar der Sünder, mit grossen
Geberden Rechenschaft fordernd für alles,
was mit Versuchung und Noth, mit Ver-
kümmerung und Seelenangst, mit aller Häss-
lichkeit und allem Fluch des Lebens an ihnen
gesündigt war; und unten wand sich die
Riesengestalt eines Gottes, erdrückt von der
Last der Sünden, die seine Welt an jenen
begangen hatte, ein Verurtheilter. Darunter
stand der Spruch: Gleiches Recht für Alle!
Aber lasst uns dessen Geltung in helleren
Reichen suchen. Wenn Gott unser Fühlen
und Wollen in eine unendliche Kette von
Mitteln und Zwecken sich hat ordnen lassen,
so dass jedes Ding seine Bedeutung von
seinem Wozu? — entlehnt, jedes auf einen
höheren Zweck hinweist, der seiner Existenz
den Werth verliehe, und wenn diese Reihen
sich zum göttlichen Sein erheben, in dem
sie alle sich treffen — welche Antwort gibt
dieser letzterreichte Punkt, wenn die Frage:
Wozu? nicht grade ihm gegenüber schweigen,
ihren endlosen Weg nicht grade an ihm ab-
brechen will? Soll er nicht unbegreiflich
aus dem Gesetz, des Denkens herausfallen,
so muss auch oberhalb seiner noch ein
Werth sein, in dessen Verwirklichung du-
Sinn seiner Existenz gelegen ist. Dass jedes
Ding zu einem andern emporblickt, in das
sich hingebend es die Vollendung seiner Kralt
findet — wie sollte diese grosse Hoffnung
und Schönheit der Dinge dem Höchsten ver-
sagt sein? Aber an ein Ueber-Göttliches
kann er sich nicht wenden, denn nun stünde
dies wehrlos vor der gleichen Frage. Aber
vielleicht findet Gott im Hinabneigen zur
Welt, was er über sich nicht finden kann —
die Antwort auf sein Wozu? — dass er im
Sein der Welt das Ziel seines Seins suche,
wie die Welt ihr Ziel in ihm, und so die
zweckbeseelte Verkettung der Dinge sich in
sich selbst schliesst und ihre Unendlichkeit
keine andre ist als die Endlosigkeit des Ringes.
So erlöst ihn die Gleichheit vor dem Gesetz
des Zweckes, das er der Welt gegeben hat,
davon, dass er vor seinem eignen Sinn er-
starrt Halt mache, und lässt ihn um der
Welt willen da sein — um der Welt willen,
die um seinetwillen da. ist. G s