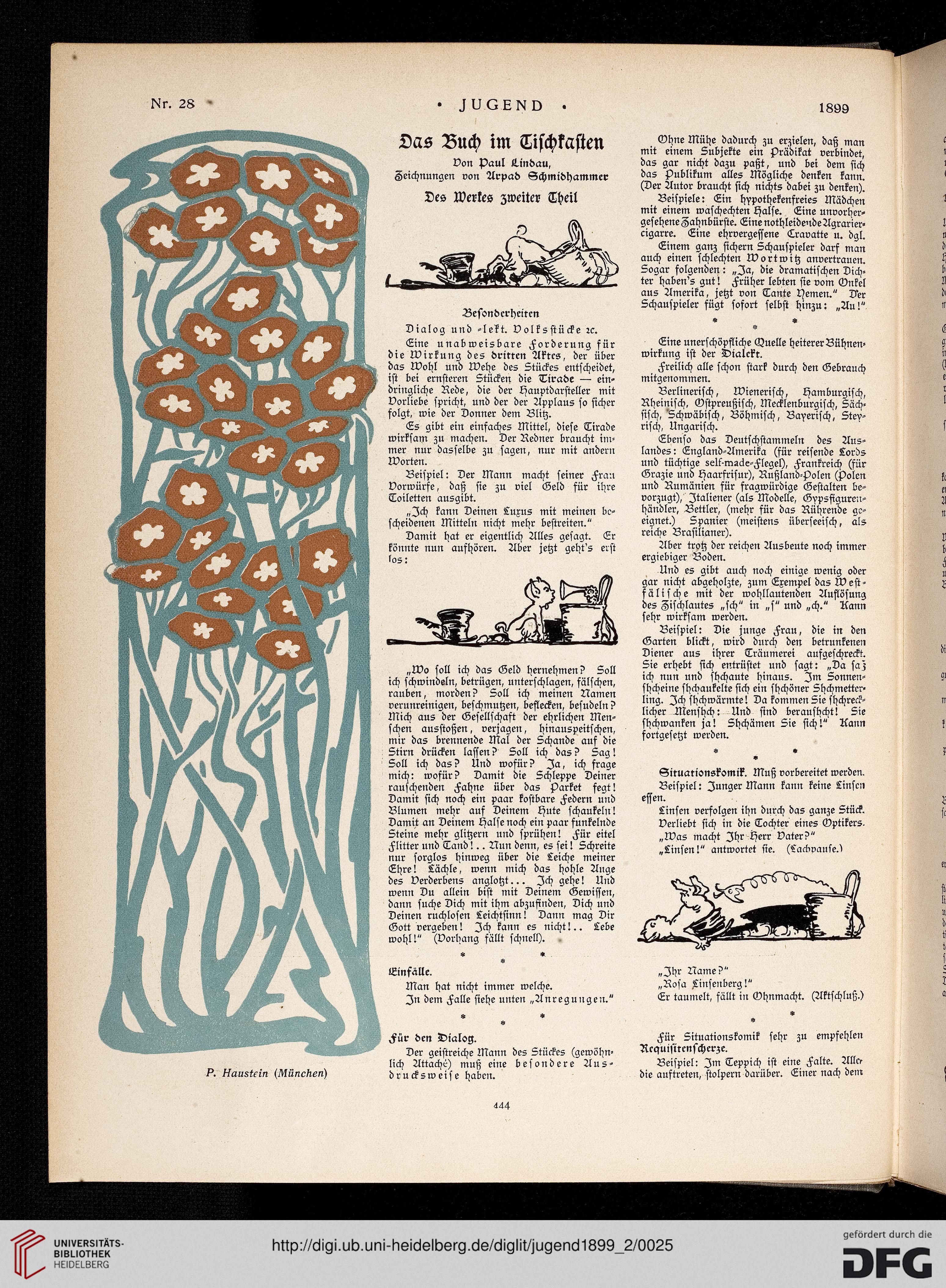Nr. 28 •
JUGEND
1899
P. Haustein (München)
Das Buch im Tischkasten
Port Paul Lindau,
Zeichnungen von Arpad Schmidhammer
Des Werkes zweiter Theil
Besonderheiten
Dialog und -lekt. Volks stücke rc.
Eine unabweisbare Forderung für
die Wirkung des dritten Aktes, der über
das Wohl und wehe des Stückes entscheidet,
ist bei ernsteren Stücken die Dirade — ein-
dringliche Rede, die der Hauptdarsteller mit
Vorliebe spricht, und der der Applaus so sicher
folgt, wie der Donner dem Blitz.
Es gibt ein einfaches Mittel, diese Tirade
wirksam zu machen. Der Redner braucht im-
mer nur dasselbe zu sagen, nur mit andern
Worten.
Beispiel: Der Mann macht seiner Frau
Vorwürfe, daß sie zu viel Geld für ihre
Toiletten ausgibt.
„Ich kann Deinen Luxus mit meinen be-
scheidenen Mitteln nicht mehr bestreiten."
Damit hat er eigentlich Alles gesagt. Er
könnte nun aufhören. Aber jetzt geht's erst
los:
„wo soll ich das Geld hernehmen? Soll
ich schwindeln, betrügen, unterschlagen, fälschen,
rauben, morden? Soll ich meinen Namen
verunreinigen, beschmutzen, beflecken, besudeln?
Mich aus der Gesellschaft der ehrlichen Men-
schen ausstoßen, verjagen, hinauspeitschen,
mir das brennende Mal der Schande auf die
Stirn drücken lassen? Soll ich das? Sag!
Soll ich das? Und wofür? Ja, ich frage
mich: wofür? Damit die Schleppe Deiner
rauschenden Fahne über das parket fegt!
Damit sich noch ein paar kostbare Federn und
Blumen mehr auf Deinem Hute schaukeln!
Damit an Deinem Halse noch ein paar funkelnde
Steine mehr glitzern und sprühen! Für eitel
Flitter und Tand!.. Nur: denn, es sei! Schreite
nur sorglos hinweg über die Leiche meiner
Ehre! Lächle, wenn mich das hohle Auge
des Verderbens anglotzt... Ich gehe! Und
wenn Du allein bist mit Deinem Gewissen,
dann suche Dich mit ihm abzufinden, Dich und
Deinen ruchlosen Leichtsinn! Dann mag Dir
Gott vergeben! Ich kann es nicht!.. Lebe
wohl!" (Vorhang fällt schrrell). .
* »
-r-
Einfälle.
Man hat nicht immer welche.
In dem Falle siehe unten „Anregungen."
H *
Für den Dialog.
Der geistreiche Mann des Stückes (gewöhn-
lich Attache) muß eine besondere Aus-
drucksweise haben.
Ohne Mühe dadurch zu erzielen, daß man
mit einem Subjekte ein Prädikat verbindet,
das gar nicht dazu paßt, und bei dem sich
das Publikum alles Mögliche denken kann.
(Der Autor braucht sich nichts dabei zu denken).
Beispiele: Ein hypothekenfreies Mädchen
mit einem waschechten Halse. Eine unvorher-
gesehene Zahnbürste. Eine nothleidendeAgrarier-
cigarre. Eine ehrvergessene Lravatte u. dgl.
Einem ganz sichern Schauspieler darf man
auch einen schlechten Wortwitz anvertrauen.
Sogar folgenden: „Ja, die dramatischen Dich-
ter haben's gut! Früher lebten sie vom Onkel
aus Amerika, jetzt von Tante pemen." Der
Schauspieler fügt sofort selbst hinzu: „Au!"
4- »
*
Eine unerschöpfliche Ouelle heiterer Bühnen-
wirkung ist der Dialekt.
Freilich alle schon stark durch den Gebrauch
mitgenommen.
Berlinerisch, wienerisch, Hamburgisch,
Rheinisch, Ostpreußisch, Mecklenburgisch, Säch-
sisch, 'Schwäbisch, Böhmisch, Bayerisch, Stey-
risch, Ungarisch.
Ebenso das Deutschstammeln des Aus-
landes: England-Amerika (für reisende Lords
und tüchtige selt-maäe-Flegel), Frankreich (für
Grazie und Haarfrisur), Rußland-Polen (Polen
und Rumänien für fragwürdige Gestalten be-
vorzugt), Italiener (als Modelle, Gypsfiguren-
händler, Bettler, (mehr für das Rührende ge-
eignet.) Spanier (meistens überseeisch, als
reiche Brasilianer).
Aber trotz der reichen Ausbeute noch immer
ergiebiger Boden.
Und es gibt auch noch einige wenig oder
gar nicht abgeholzte, zum Exempel das west-
fälische mit der wohllautenden Auflösung
des Zischlautes „sch" in „s" und „ch." Rann
sehr wirksam werden.
Beispiel: Die junge Frau, die in den
Garten blickt, wird durch den betrunkenen
Diener aus ihrer Träumerei aufgeschreckt.
Sie erhebt sich entrüstet und sagt: „Da saz
ich nun und shchaute hinaus. Im Sonnen-
shcheine shchaukelte sich ein shchöner Shchmetter-
ling. Ich shchwärmte! Da kommen Sie shchreck-
licher Menshch: Und sind beraushcht! Sie
shchwanken ja! Shchämen Sie sich!" Rann
fortgesetzt werden.
* »
*
Situationskomik. Muß vorbereitet werden.
Beispiel: Junger Mann kann keine Linsen
essen.
Linsen verfolgen ihn durch das ganze Stück.
Verliebt sich in die Tochter eines Optikers.
„was macht Ihr Herr Vater?"
„Linsen!" antwortet sie. (Lacbpause.'l
„Ihr Name?"
„Rosa Linsenberg!"
Er taumelt, fällt in Ohnmacht. (Aktschluß.)
Für Situationskomik sehr zu empfehlen
Rcquisitenscherze.
Beispiel: Im Teppich ist eine Falte. llUcr
die auftreten, stolpern darüber. Einer nach dem
444
JUGEND
1899
P. Haustein (München)
Das Buch im Tischkasten
Port Paul Lindau,
Zeichnungen von Arpad Schmidhammer
Des Werkes zweiter Theil
Besonderheiten
Dialog und -lekt. Volks stücke rc.
Eine unabweisbare Forderung für
die Wirkung des dritten Aktes, der über
das Wohl und wehe des Stückes entscheidet,
ist bei ernsteren Stücken die Dirade — ein-
dringliche Rede, die der Hauptdarsteller mit
Vorliebe spricht, und der der Applaus so sicher
folgt, wie der Donner dem Blitz.
Es gibt ein einfaches Mittel, diese Tirade
wirksam zu machen. Der Redner braucht im-
mer nur dasselbe zu sagen, nur mit andern
Worten.
Beispiel: Der Mann macht seiner Frau
Vorwürfe, daß sie zu viel Geld für ihre
Toiletten ausgibt.
„Ich kann Deinen Luxus mit meinen be-
scheidenen Mitteln nicht mehr bestreiten."
Damit hat er eigentlich Alles gesagt. Er
könnte nun aufhören. Aber jetzt geht's erst
los:
„wo soll ich das Geld hernehmen? Soll
ich schwindeln, betrügen, unterschlagen, fälschen,
rauben, morden? Soll ich meinen Namen
verunreinigen, beschmutzen, beflecken, besudeln?
Mich aus der Gesellschaft der ehrlichen Men-
schen ausstoßen, verjagen, hinauspeitschen,
mir das brennende Mal der Schande auf die
Stirn drücken lassen? Soll ich das? Sag!
Soll ich das? Und wofür? Ja, ich frage
mich: wofür? Damit die Schleppe Deiner
rauschenden Fahne über das parket fegt!
Damit sich noch ein paar kostbare Federn und
Blumen mehr auf Deinem Hute schaukeln!
Damit an Deinem Halse noch ein paar funkelnde
Steine mehr glitzern und sprühen! Für eitel
Flitter und Tand!.. Nur: denn, es sei! Schreite
nur sorglos hinweg über die Leiche meiner
Ehre! Lächle, wenn mich das hohle Auge
des Verderbens anglotzt... Ich gehe! Und
wenn Du allein bist mit Deinem Gewissen,
dann suche Dich mit ihm abzufinden, Dich und
Deinen ruchlosen Leichtsinn! Dann mag Dir
Gott vergeben! Ich kann es nicht!.. Lebe
wohl!" (Vorhang fällt schrrell). .
* »
-r-
Einfälle.
Man hat nicht immer welche.
In dem Falle siehe unten „Anregungen."
H *
Für den Dialog.
Der geistreiche Mann des Stückes (gewöhn-
lich Attache) muß eine besondere Aus-
drucksweise haben.
Ohne Mühe dadurch zu erzielen, daß man
mit einem Subjekte ein Prädikat verbindet,
das gar nicht dazu paßt, und bei dem sich
das Publikum alles Mögliche denken kann.
(Der Autor braucht sich nichts dabei zu denken).
Beispiele: Ein hypothekenfreies Mädchen
mit einem waschechten Halse. Eine unvorher-
gesehene Zahnbürste. Eine nothleidendeAgrarier-
cigarre. Eine ehrvergessene Lravatte u. dgl.
Einem ganz sichern Schauspieler darf man
auch einen schlechten Wortwitz anvertrauen.
Sogar folgenden: „Ja, die dramatischen Dich-
ter haben's gut! Früher lebten sie vom Onkel
aus Amerika, jetzt von Tante pemen." Der
Schauspieler fügt sofort selbst hinzu: „Au!"
4- »
*
Eine unerschöpfliche Ouelle heiterer Bühnen-
wirkung ist der Dialekt.
Freilich alle schon stark durch den Gebrauch
mitgenommen.
Berlinerisch, wienerisch, Hamburgisch,
Rheinisch, Ostpreußisch, Mecklenburgisch, Säch-
sisch, 'Schwäbisch, Böhmisch, Bayerisch, Stey-
risch, Ungarisch.
Ebenso das Deutschstammeln des Aus-
landes: England-Amerika (für reisende Lords
und tüchtige selt-maäe-Flegel), Frankreich (für
Grazie und Haarfrisur), Rußland-Polen (Polen
und Rumänien für fragwürdige Gestalten be-
vorzugt), Italiener (als Modelle, Gypsfiguren-
händler, Bettler, (mehr für das Rührende ge-
eignet.) Spanier (meistens überseeisch, als
reiche Brasilianer).
Aber trotz der reichen Ausbeute noch immer
ergiebiger Boden.
Und es gibt auch noch einige wenig oder
gar nicht abgeholzte, zum Exempel das west-
fälische mit der wohllautenden Auflösung
des Zischlautes „sch" in „s" und „ch." Rann
sehr wirksam werden.
Beispiel: Die junge Frau, die in den
Garten blickt, wird durch den betrunkenen
Diener aus ihrer Träumerei aufgeschreckt.
Sie erhebt sich entrüstet und sagt: „Da saz
ich nun und shchaute hinaus. Im Sonnen-
shcheine shchaukelte sich ein shchöner Shchmetter-
ling. Ich shchwärmte! Da kommen Sie shchreck-
licher Menshch: Und sind beraushcht! Sie
shchwanken ja! Shchämen Sie sich!" Rann
fortgesetzt werden.
* »
*
Situationskomik. Muß vorbereitet werden.
Beispiel: Junger Mann kann keine Linsen
essen.
Linsen verfolgen ihn durch das ganze Stück.
Verliebt sich in die Tochter eines Optikers.
„was macht Ihr Herr Vater?"
„Linsen!" antwortet sie. (Lacbpause.'l
„Ihr Name?"
„Rosa Linsenberg!"
Er taumelt, fällt in Ohnmacht. (Aktschluß.)
Für Situationskomik sehr zu empfehlen
Rcquisitenscherze.
Beispiel: Im Teppich ist eine Falte. llUcr
die auftreten, stolpern darüber. Einer nach dem
444