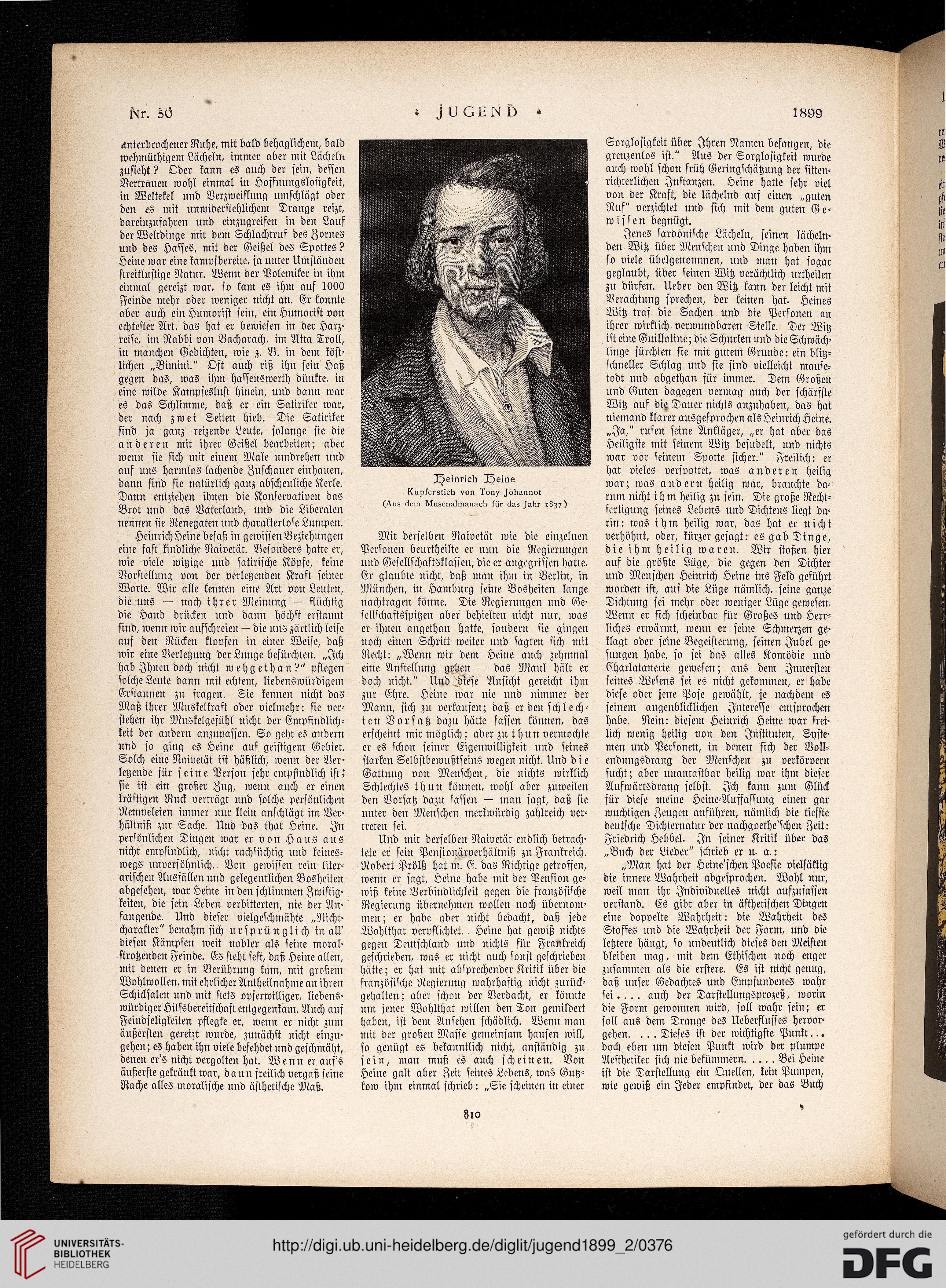Nr. 5Ö
4
1899
unterbrochener Ruhe, mit bald behaglichem, bald
wehmüthigem Lächeln, immer aber mit Lächeln
zusieht? Oder kann es auch der sein, dessen
Vertrauen wohl einmal in Hoffnungslosigkeit,
in Weltekel und Verzweiflung umschlägt oder
den es mit unwiderstehlichem Drange reizt,
dareinzufahren und einzugreifen in den Lauf
der Weltdinge mit dem Schlachtruf des Zornes
und des Hasses, mit der Geißel des Spottes?
Heine war eine kampfbereite, ja unter Umständen
streitlustige Natur. Wenn der Polemiker in ihm
einmal gereizt war, so kam es ihm auf 1000
Feinde mehr oder weniger nicht an. Er konnte
aber auch ein Humorist sein, ein Humorist von
echtester Art, das hat er bewiesen in der Harz-
reise, im Rabbi von Bacharach, im Atta Troll,
in manchen Gedichten, wie z. B. in dem köst-
lichen „Bimini." Oft auch riß ihn sein Haß
gegen das, was ihm Hassenswerth dünkte, in
eine wilde Kampfeslust hinein, und dann war
es das Schlimme, daß er ein Satiriker war,
der nach zwei Seiten hieb. Die Satiriker
sind ja ganz reizende Leute, solange sie die
anderen mit ihrer Geißel bearbeiten; aber
wenn sie sich mit einem Male umdrehen und
auf uns harmlos lachende Zuschauer einhauen,
dann sind sie natürlich ganz abscheuliche Kerle.
Dann entziehen ihnen die Konservativen das
Brot und das Vaterland, und die Liberalen
nennen sie Renegaten und charakterlose Lumpen.
Heinrich Heine besaß in gewissen Beziehungen
eine fast kindliche Naivetät. Besonders hatte er,
wie viele witzige und satirische Köpfe, keine
Vorstellung von der verletzenden Kraft seiner
Worte. Wir alle kennen eine Art von Leuten,
die uns — nach ihrer Meinung — flüchtig
die Hand drücken und dann höchst erstaunt
sind, wenn wir aufschreien — die uns zärtlich leise
auf den Rücken klopfen in einer Weise, daß
wir eine Verletzung der Lunge befürchten. „Ich
Hab Ihnen doch nicht rvehgethan?" pflegen
solche Leute dann mit echtem, liebenswürdigem
Erstaunen gu fragen. Sie kennen nicht das
Maß ihrer Muskelkraft oder vielmehr: sie ver-
stehen ihr Muskelgefühl nicht der Empfindlich-
keit der andern anzupassen. So geht es andern
und so ging es Heine auf geistigem Gebiet.
Solch eine Naivetät ist häßlich, wenn der Ver-
letzende für seine Person sehr empfindlich ist;
sie ist ein großer Zug, wenn auch er einen
kräftigen Ruck verträgt und solche persönlichen
Rempeleien immer nur klein anschlägt im Ver-
hältniß zur Sache. Und das that Heine. In
persönlichen Dingen war er von Haus aus
nicht empfindlich, nicht rachsüchtig und keines-
wegs unversöhnlich. Von gewissen rein liter-
arischen Ausfällen und gelegentlichen Bosheiten
abgesehen, war Heine in den schlimmen Zwistig-
keiten, die sein Leben verbitterten, nie der An-
fangende. Und dieser vielgeschmähte „Nicht-
charakter" benahm sich ursprünglich in all'
diesen Kämpfen weit nobler als seine moral-
strotzenden Feinde. Es steht fest, daß Heine allen,
mit denen er in Berührung kam, mit großem
Wohlwollen, mit ehrlicherAntheilnahme an ihren
Schicksalen und mit stets opferwilliger, liebens-
würdiger Hilfsbereitschaft entgegenkam. Auch auf
Feindseligkeiten pflegte er, wenn er nicht zum
äußersten gereizt wurde, zunächst nicht einzu-
gehen; es haben ihn viele befehdet und geschmäht,
denen er's nicht vergolten hat. W enn er auf's
äußerste gekränkt war, dann freilich vergaß seine
Rache alles moralische und ästhetische Maß.
* JUGEND
Heinrich I)eine
Kupferstich von Tony Johannot
(Aus dem Musenalmanach für das Jahr 1837)
Mit derselben Naivetät wie die einzelnen
Personen beurtheilte er nun die Regierungen
und Gesellschaftsklassen, die er angegriffen hatte.
Er glaubte nicht, daß man ihm in Berlin, in
München, in Hamburg seine Bosheiten lange
nachtragen könne. Die Regierungen und Ge-
sellschaftsspitzen aber behielten nicht nur, was
er ihnen angethan hatte, sondern sie gingen
noch einen Schritt weiter und sagten sich mit
Recht: „Wenn wir dem Heine auch zehnmal
eine Anstellung geben — das Maul hält er
doch nicht." Und diese Ansicht gereicht ihm
zur Ehre. Heine war nie und nimmer der
Mann, sich zu verkaufen; daß er den schlech-
ten Vorsatz dazu hätte fassen können, das
erscheint mir möglich; aber zu t h un vermochte
er es schon seiner Eigenwilligkeit und seines
starken Selbstbewußtseins wegen nicht. Und die
Gattung von Menschen, die nichts wirklich
Schlechtes thun können, wohl aber zuweilen
den Vorsatz dazu fassen — man sagt, daß sie
unter den Menschen merkwürdig zahlreich ver-
treten sei.
Und mit derselben Naivetät endlich betrach-
tete er sein Pensionärverhältniß zu Frankreich.
Robert Prölß hat m. E. das Nichtige getroffen,
wenn er sagt, Heine habe mit der Pension ge-
wiß keine Verbindlichkeit gegen die französische
Regierung übernehmen wollen noch übernom-
men; er habe aber nicht bedacht, daß jede
Wohlthat verpflichtet. Heine hat gewiß nichts
gegen Deutschland und nichts für Frankreich
geschrieben, was er nicht auch sonst geschrieben
hätte; er hat mit absprechender Kritik über die
französische Regierung wahrhaftig nicht zurück-
gehalten; aber schon der Verdacht, er könnte
um jener Wohlthat willen den Ton gemildert
haben, ist dem Ansehen schädlich. Wenn man
mit der großen Masse gemeinsam hausen will,
so genügt es bekanntlich nicht, anständig zu
sein, man muß es auch scheine n. Von
Heine galt aber Zeit seines Lebens, was Gutz-
kow ihm einmal schrieb: „Sie scheinen in einer
Sorglosigkeit über Ihren Namen befangen, die
grenzenlos ist." Aus der Sorglosigkeit wurde
auch wohl schon früh Geringschätzung der sitten-
richterlichen Instanzen. Heine hatte sehr viel
von der Kraft, die lächelnd auf einen „guten
Ruf" verzichtet und sich mit dem guten Ge-
wissen begnügt.
Jenes sardonische Lächeln, seinen lächeln-
den Witz über Menschen und Dinge haben ihm
so viele übelgenommen, und man hat sogar
geglaubt, über seinen Witz verächtlich urtheilen
zu dürfen. Ueber den Witz kann der leicht mit
Verachtung sprechen, der keinen hat. Heines
Witz traf die Sachen und die Personen an
ihrer wirklich verwundbaren Stelle. Der Witz
ist eine Guillotine; die Schurken und die Schwäch-
linge fürchten sie mit gutem Grunde: ein blitz-
schneller Schlag und sie sind vielleicht mause-
todt und abgethan für immer. Dem Großen
und Guten dagegen vermag auch der schärfste
Witz auf ditz Dauer nichts anzuhaben, das hat
niemand klarer ausgesprochen als Heinrich Heine.
„Ja," rufen seine Ankläger, „er hat aber das
Heiligste mit seinem Witz besudelt, und nichts
war vor seinem Spotte sicher." Freilich: er
hat vieles verspottet, was anderen heilig
war; was andern heilig war, brauchte da-
rum nicht ihm heilig zu sein. Die große Recht-
fertigung seines Lebens und Dichtens liegt da-
rin: was ihm heilig war, das hat er nicht
verhöhnt, oder, kürzer gesagt: es gab Dinge,
die ihm heilig waren. Wir stoßen hier
auf die größte Lüge, die gegen den Dichter
und Menschen Heinrich Heine ins Feld geführt
worden ist, auf die Lüge nämlich, seine ganze
Dichtung sei mehr oder weniger Lüge gewesen.
Wenn er sich scheinbar für Großes und Herr-
liches erwärmt, wenn er seine Schmerzen ge-
klagt oder seine Begeisterung, seinen Jubel ge-
sungen habe, so sei das alles Komödie und
Charlatanerie gewesen; aus dem Innersten
seines Wesens sei es nicht gekommen, er habe
diese oder jene Pose gewählt, je nachdem es
seinem augenblicklichen Interesse entsprochen
habe. Nein: diesem Heinrich Heine war frei-
lich wenig heilig von den Instituten, Syste-
men und Personen, in denen sich der Voll-
endungsdrang der Menschen zu verkörpern
sucht; aber unantastbar heilig war ihm dieser
Aufwärtsdrang selbst. Ich kann zum Glück
für diese meine Heine-Auffassung einen gar
wuchtigen Zeugen anführen, nämlich die tiefste
deutsche Dichternatur der nachgoethe'schen Zeit:
Friedrich Hebbel. In seiner Kritik über das
„Buch der Lieder" schrieb er u. a.:
„Man hat der Heine'schen Poesie vielfältig
die innere Wahrheit abgesprochen. Wohl nur,
weil man ihr Individuelles nicht aufzufassen
verstand. Es gibt aber in ästhetischen Dingen
eine doppelte Wahrheit: die Wahrheit des
Stoffes und die Wahrheit der Form, und die
letztere hängt, so undeutlich dieses den Meisten
bleiben mag, mit dem Ethischen noch enger
zusammen als die erstere. Es ist nicht genug,
daß unser Gedachtes und Empfundenes wahr
sei... . auch der Darstellungsprozeß, worin
die Form gewonnen wird, soll wahr sein; er
soll aus dem Drange des Neberflusses hervor-
gehen. . . . Dieses ist der wichtigste Punkt...
doch eben um diesen Punkt wird der plumpe
Aesthetiker sich nie bekümmern.Bei Heine
ist die Darstellung ein Quellen, kein Pumpen,
wie gewiß ein Jeder empfindet, der das Buch
*
810
4
1899
unterbrochener Ruhe, mit bald behaglichem, bald
wehmüthigem Lächeln, immer aber mit Lächeln
zusieht? Oder kann es auch der sein, dessen
Vertrauen wohl einmal in Hoffnungslosigkeit,
in Weltekel und Verzweiflung umschlägt oder
den es mit unwiderstehlichem Drange reizt,
dareinzufahren und einzugreifen in den Lauf
der Weltdinge mit dem Schlachtruf des Zornes
und des Hasses, mit der Geißel des Spottes?
Heine war eine kampfbereite, ja unter Umständen
streitlustige Natur. Wenn der Polemiker in ihm
einmal gereizt war, so kam es ihm auf 1000
Feinde mehr oder weniger nicht an. Er konnte
aber auch ein Humorist sein, ein Humorist von
echtester Art, das hat er bewiesen in der Harz-
reise, im Rabbi von Bacharach, im Atta Troll,
in manchen Gedichten, wie z. B. in dem köst-
lichen „Bimini." Oft auch riß ihn sein Haß
gegen das, was ihm Hassenswerth dünkte, in
eine wilde Kampfeslust hinein, und dann war
es das Schlimme, daß er ein Satiriker war,
der nach zwei Seiten hieb. Die Satiriker
sind ja ganz reizende Leute, solange sie die
anderen mit ihrer Geißel bearbeiten; aber
wenn sie sich mit einem Male umdrehen und
auf uns harmlos lachende Zuschauer einhauen,
dann sind sie natürlich ganz abscheuliche Kerle.
Dann entziehen ihnen die Konservativen das
Brot und das Vaterland, und die Liberalen
nennen sie Renegaten und charakterlose Lumpen.
Heinrich Heine besaß in gewissen Beziehungen
eine fast kindliche Naivetät. Besonders hatte er,
wie viele witzige und satirische Köpfe, keine
Vorstellung von der verletzenden Kraft seiner
Worte. Wir alle kennen eine Art von Leuten,
die uns — nach ihrer Meinung — flüchtig
die Hand drücken und dann höchst erstaunt
sind, wenn wir aufschreien — die uns zärtlich leise
auf den Rücken klopfen in einer Weise, daß
wir eine Verletzung der Lunge befürchten. „Ich
Hab Ihnen doch nicht rvehgethan?" pflegen
solche Leute dann mit echtem, liebenswürdigem
Erstaunen gu fragen. Sie kennen nicht das
Maß ihrer Muskelkraft oder vielmehr: sie ver-
stehen ihr Muskelgefühl nicht der Empfindlich-
keit der andern anzupassen. So geht es andern
und so ging es Heine auf geistigem Gebiet.
Solch eine Naivetät ist häßlich, wenn der Ver-
letzende für seine Person sehr empfindlich ist;
sie ist ein großer Zug, wenn auch er einen
kräftigen Ruck verträgt und solche persönlichen
Rempeleien immer nur klein anschlägt im Ver-
hältniß zur Sache. Und das that Heine. In
persönlichen Dingen war er von Haus aus
nicht empfindlich, nicht rachsüchtig und keines-
wegs unversöhnlich. Von gewissen rein liter-
arischen Ausfällen und gelegentlichen Bosheiten
abgesehen, war Heine in den schlimmen Zwistig-
keiten, die sein Leben verbitterten, nie der An-
fangende. Und dieser vielgeschmähte „Nicht-
charakter" benahm sich ursprünglich in all'
diesen Kämpfen weit nobler als seine moral-
strotzenden Feinde. Es steht fest, daß Heine allen,
mit denen er in Berührung kam, mit großem
Wohlwollen, mit ehrlicherAntheilnahme an ihren
Schicksalen und mit stets opferwilliger, liebens-
würdiger Hilfsbereitschaft entgegenkam. Auch auf
Feindseligkeiten pflegte er, wenn er nicht zum
äußersten gereizt wurde, zunächst nicht einzu-
gehen; es haben ihn viele befehdet und geschmäht,
denen er's nicht vergolten hat. W enn er auf's
äußerste gekränkt war, dann freilich vergaß seine
Rache alles moralische und ästhetische Maß.
* JUGEND
Heinrich I)eine
Kupferstich von Tony Johannot
(Aus dem Musenalmanach für das Jahr 1837)
Mit derselben Naivetät wie die einzelnen
Personen beurtheilte er nun die Regierungen
und Gesellschaftsklassen, die er angegriffen hatte.
Er glaubte nicht, daß man ihm in Berlin, in
München, in Hamburg seine Bosheiten lange
nachtragen könne. Die Regierungen und Ge-
sellschaftsspitzen aber behielten nicht nur, was
er ihnen angethan hatte, sondern sie gingen
noch einen Schritt weiter und sagten sich mit
Recht: „Wenn wir dem Heine auch zehnmal
eine Anstellung geben — das Maul hält er
doch nicht." Und diese Ansicht gereicht ihm
zur Ehre. Heine war nie und nimmer der
Mann, sich zu verkaufen; daß er den schlech-
ten Vorsatz dazu hätte fassen können, das
erscheint mir möglich; aber zu t h un vermochte
er es schon seiner Eigenwilligkeit und seines
starken Selbstbewußtseins wegen nicht. Und die
Gattung von Menschen, die nichts wirklich
Schlechtes thun können, wohl aber zuweilen
den Vorsatz dazu fassen — man sagt, daß sie
unter den Menschen merkwürdig zahlreich ver-
treten sei.
Und mit derselben Naivetät endlich betrach-
tete er sein Pensionärverhältniß zu Frankreich.
Robert Prölß hat m. E. das Nichtige getroffen,
wenn er sagt, Heine habe mit der Pension ge-
wiß keine Verbindlichkeit gegen die französische
Regierung übernehmen wollen noch übernom-
men; er habe aber nicht bedacht, daß jede
Wohlthat verpflichtet. Heine hat gewiß nichts
gegen Deutschland und nichts für Frankreich
geschrieben, was er nicht auch sonst geschrieben
hätte; er hat mit absprechender Kritik über die
französische Regierung wahrhaftig nicht zurück-
gehalten; aber schon der Verdacht, er könnte
um jener Wohlthat willen den Ton gemildert
haben, ist dem Ansehen schädlich. Wenn man
mit der großen Masse gemeinsam hausen will,
so genügt es bekanntlich nicht, anständig zu
sein, man muß es auch scheine n. Von
Heine galt aber Zeit seines Lebens, was Gutz-
kow ihm einmal schrieb: „Sie scheinen in einer
Sorglosigkeit über Ihren Namen befangen, die
grenzenlos ist." Aus der Sorglosigkeit wurde
auch wohl schon früh Geringschätzung der sitten-
richterlichen Instanzen. Heine hatte sehr viel
von der Kraft, die lächelnd auf einen „guten
Ruf" verzichtet und sich mit dem guten Ge-
wissen begnügt.
Jenes sardonische Lächeln, seinen lächeln-
den Witz über Menschen und Dinge haben ihm
so viele übelgenommen, und man hat sogar
geglaubt, über seinen Witz verächtlich urtheilen
zu dürfen. Ueber den Witz kann der leicht mit
Verachtung sprechen, der keinen hat. Heines
Witz traf die Sachen und die Personen an
ihrer wirklich verwundbaren Stelle. Der Witz
ist eine Guillotine; die Schurken und die Schwäch-
linge fürchten sie mit gutem Grunde: ein blitz-
schneller Schlag und sie sind vielleicht mause-
todt und abgethan für immer. Dem Großen
und Guten dagegen vermag auch der schärfste
Witz auf ditz Dauer nichts anzuhaben, das hat
niemand klarer ausgesprochen als Heinrich Heine.
„Ja," rufen seine Ankläger, „er hat aber das
Heiligste mit seinem Witz besudelt, und nichts
war vor seinem Spotte sicher." Freilich: er
hat vieles verspottet, was anderen heilig
war; was andern heilig war, brauchte da-
rum nicht ihm heilig zu sein. Die große Recht-
fertigung seines Lebens und Dichtens liegt da-
rin: was ihm heilig war, das hat er nicht
verhöhnt, oder, kürzer gesagt: es gab Dinge,
die ihm heilig waren. Wir stoßen hier
auf die größte Lüge, die gegen den Dichter
und Menschen Heinrich Heine ins Feld geführt
worden ist, auf die Lüge nämlich, seine ganze
Dichtung sei mehr oder weniger Lüge gewesen.
Wenn er sich scheinbar für Großes und Herr-
liches erwärmt, wenn er seine Schmerzen ge-
klagt oder seine Begeisterung, seinen Jubel ge-
sungen habe, so sei das alles Komödie und
Charlatanerie gewesen; aus dem Innersten
seines Wesens sei es nicht gekommen, er habe
diese oder jene Pose gewählt, je nachdem es
seinem augenblicklichen Interesse entsprochen
habe. Nein: diesem Heinrich Heine war frei-
lich wenig heilig von den Instituten, Syste-
men und Personen, in denen sich der Voll-
endungsdrang der Menschen zu verkörpern
sucht; aber unantastbar heilig war ihm dieser
Aufwärtsdrang selbst. Ich kann zum Glück
für diese meine Heine-Auffassung einen gar
wuchtigen Zeugen anführen, nämlich die tiefste
deutsche Dichternatur der nachgoethe'schen Zeit:
Friedrich Hebbel. In seiner Kritik über das
„Buch der Lieder" schrieb er u. a.:
„Man hat der Heine'schen Poesie vielfältig
die innere Wahrheit abgesprochen. Wohl nur,
weil man ihr Individuelles nicht aufzufassen
verstand. Es gibt aber in ästhetischen Dingen
eine doppelte Wahrheit: die Wahrheit des
Stoffes und die Wahrheit der Form, und die
letztere hängt, so undeutlich dieses den Meisten
bleiben mag, mit dem Ethischen noch enger
zusammen als die erstere. Es ist nicht genug,
daß unser Gedachtes und Empfundenes wahr
sei... . auch der Darstellungsprozeß, worin
die Form gewonnen wird, soll wahr sein; er
soll aus dem Drange des Neberflusses hervor-
gehen. . . . Dieses ist der wichtigste Punkt...
doch eben um diesen Punkt wird der plumpe
Aesthetiker sich nie bekümmern.Bei Heine
ist die Darstellung ein Quellen, kein Pumpen,
wie gewiß ein Jeder empfindet, der das Buch
*
810