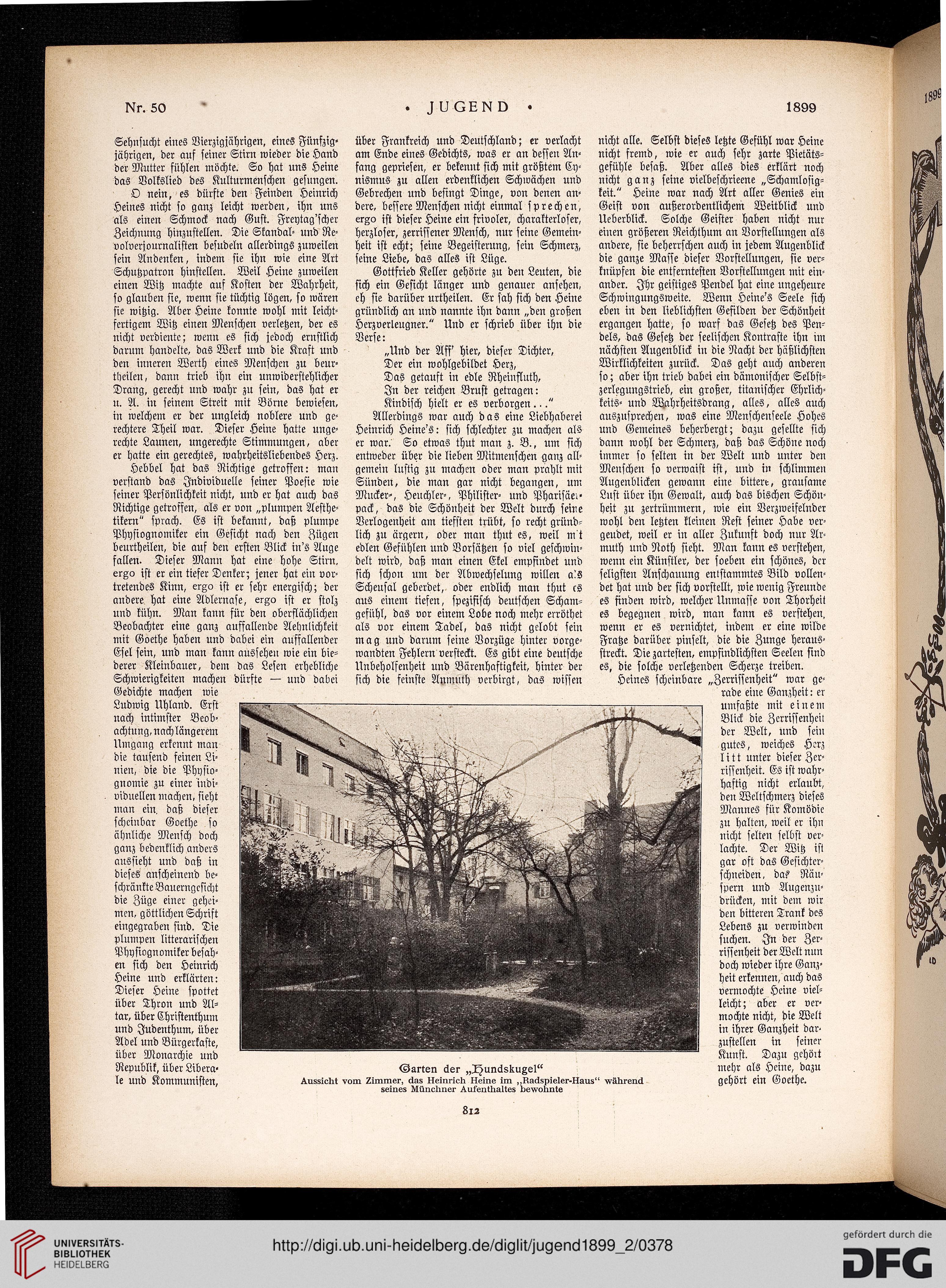Nr. 50
JUGEND
1899
«
Sehnsucht eines Vierzigjährigen, eines Fünfzig-
jährigen, der auf seiner Stirn wieder die Hand
der Mutter fühlen möchte. So hat uns Heine
das Volkslied des Kulturmenschen gesungen.
O nein, es dürfte den Feinden Heinrich
Heines nicht so ganz leicht werden, ihn uns
als einen Schmock nach Gust. Freytag'scher
Zeichnung hinzustellen. Die Skandal- und Re-
volverjournalisten besudeln allerdings zuweilen
sein Andenken, indem sie ihn wie eine Art
Schutzpatron hinstellen. Weil Heine zuweilen
einen Witz machte auf Kosten der Wahrheit,
so glauben sie, wenn sie tüchtig lögen, so wären
sie witzig. Aber Heine konnte wohl mit leicht-
fertigem Witz einen Menschen verletzen, der es
nicht verdiente; wenn es sich jedoch ernstlich
darum handelte, das Werk und die Kraft und
den inneren Werth eines Menschen zu beur-
theilen, dann trieb ihn ein unwiderstehlicher
Drang, gerecht und wahr zu sein, das hat er
lt. A. in seinem Streit mit Börne bewiesen,
in welchem er der ungleich noblere und ge-
rechtere Theil war. Dieser Heine hatte unge-
rechte Launen, ungerechte Stimmungen, aber
er hatte ein gerechtes, wahrheitsliebendes Herz.
Hebbel hat das Richtige getroffen: man
verstand das Individuelle seiner Poesie wie
seiner Persönlichkeit nicht, und er hat auch das
Richtige getroffen, als er von „plumpen Ästhe-
tikern" sprach. Es ist bekannt, daß plumpe
Physiognomiker ein Gesicht nach den Zügen
beurtheilen, die auf den ersten Blick in's Auge
fallen. Dieser Mann hat eine hohe Stirn,
ergo ist er ein tiefer Denker; jener hat ein vor-
tretendes Kinn, ergo ist er sehr energisch; der
andere hat eine Adlernase, ergo ist er stolz
und kühn. Man kann für den oberflächlichen
Beobachter eine ganz auffallende Ähnlichkeit
mit Goethe haben und dabei ein auffallender
Esel sein, und man kann aussehen wie ein bie-
derer Kleinbauer, dem das Lesen erhebliche
Schwierigkeiten machen dürfte — und dabei
Gedichte machen wie
Ludwig Uhland. Erst
nach intimster Beob-
achtung, nach längerem
Umgang erkennt man
die tausend feinen Li-
nien, die die Physio-
gnomie zu einer indi-
viduellen machen, sieht
man ein. daß dieser
scheinbar Goethe so
ähnliche Mensch doch
ganz bedenklich anders
aussieht und daß in
dieses anscheinend be-
schränkte Bauerngesicht
die Züge einer gehei-
men, göttlichen Schrift
eingegraben sind. Die
plumpen litterarischen
Physiognomiker besah-
en sich den Heinrich
Heine und erklärten:
Dieser Heine spottet
über Thron und Al-
tar, über Christenthum
und Judenthum, über
Adel und Bürgerkaste,
über Monarchie und
Republik, über Libera-
le und Kommunisten,
über Frankreich und Deutschland; er verlacht
am Ende eines Gedichts, was er an dessen An-
fang gepriesen, er bekennt sich mit größtem Cy-
nismus zu allen erdenklichen Schwächen und
Gebrechen und besingt Dinge, von denen an-
dere, bessere Menschen nicht einmal sprechen,
ergo ist dieser Heine ein frivoler, charakterloser,
herzloser, zerrissener Mensch, nur seine Gemein-
heit ist echt; seine Begeisterung, sein Schmerz,
seine Liebe, das alles ist Lüge.
Gottfried Keller gehörte zu den Leuten, die
sich ein Gesicht länger und genauer ansehen,
eh sie darüber urtheilen. Er sah sich den Heine
gründlich an und nannte ihn dann „den großen
Herzverleugner." Und er schrieb über ihn die
Verse:
„Und der Aff hier, dieser Dichter,
Der ein wohlgebildet Herz,
Das getauft in edle Rheinfluth,
In der reichen Brust getragen:
Kindisch hielt er es verborgen..."
Allerdings war auch das eine Liebhaberei
Heinrich Heine's: sich schlechter zu machen als
er war. So etwas thut man z. B., um sich
entweder über die lieben Mitmenschen ganz all-
gemein lustig zu machen oder man prahlt mit
Sünden, die man gar nicht begangen, um
Mucker-, Heuchler-, Philister- und Pharisäer-
pack, das die Schönheit der Welt durch seine
Verlogenheit am tiefsten trübt, so recht gründ-
lich zu ärgern, oder man thut es, weil m't
edlen Gefühlen und Vorsätzen so viel geschwin-
delt wird, daß man einen Ekel empfindet und
sich schon um der Abwechselung willen als
Scheusal geberdet, oder endlich man thut cs
aus einem tiefen, spezifisch deutschen Scham-
gefühl, das vor einem Lobe noch mehr erröthet
als vor einem Tadel, das nicht gelobt sein
mag und darum seine Vorzüge hinter vorge-
wandten Fehlern versteckt. Es gibt eine deutsche
Unbeholfenheit und Bärenhaftigkeit, hinter der
sich die feinste Anmuth verbirgt, das wissen
nicht alle. Selbst dieses letzte Gefühl war Heine
nicht fremd, wie er auch sehr zarte Pietäts-
gefühle besaß. Aber alles dies erklärt noch
nicht ganz seine vielbeschrieene „Schamlosig-
keit." Heine war nach Art aller Genies ein
Geist von außerordentlichem Weitblick und
Ueberblick. Solche Geister haben nicht nur
einen größeren Reichthum an Vorstellungen als
andere, sie beherrschen auch in jedem Augenblick
die ganze Masse dieser Vorstellungen, sie ver-
knüpfen die entferntesten Vorstellungen mit ein-
ander. Ihr geistiges Pendel hat eine ungeheure
Schwingungsweite. Wenn Heiners Seele sich
eben in den lieblichsten Gefilden der Schönheit
ergangen hatte, so warf das Gesetz des Pen-
dels, das Gesetz der seelischen Kontraste ihn im
nächsten Augenblick in die Nacht der häßlichsten
Wirklichkeiten zurück. Das geht auch anderen
so; aber ihn trieb dabei ein dämonischer Selbst-
zerlegungstrieb, ein großer, titanischer Ehrlich-
keits- und W.ahrheitsdrang, alles, alles auch
auszusprechen, was eine Menschenseele Hohes
und Gemeines beherbergt; dazu gesellte sich
dann wohl der Schmerz, daß das Schöne noch
immer so selten in der Welt und unter den
Menschen so verwaist ist, und in schlimmen
Augenblicken gewann eine bittere, grausame
Lust über ihn Gewalt, auch das bischen Schön-
heit zu zertrümmern, wie ein Verzweifelnder
wohl den letzten kleinen Rest seiner Habe ver-
geudet, weil er in aller Zukunft doch nur Ar-
muth und Noth sieht. Man kann es verstehen,
wenn ein Künstler, der soeben ein schönes, der
seligsten Anschauung entstammtes Bild vollen-
det hat und der sich vorstellt, wie wenig Freunde
es finden wird, welcher Unmasse von Thorheit
es begegnen wird, man kann es verstehen,
wenn er es vernichtet, indem er eine wilde
Fratze darüber pinselt, die die Zunge heraus-
streckt. Diezartesten, empfindlichsten Seelen sind
es, die solche verletzenden Scherze treiben.
Heines scheinbare „Zerrissenheit" war ge-
rade eine Ganzheit: er
umfaßte mit einem
Blick die Zerrissenheit
der Welt, und feilt
gutes, weiches Herz
litt unter dieser Zer-
rissenheit. Es ist wahr-
haftig nicht erlaubt,
den Weltschmerz dieses
Mannes für Komödie
zu halten, weil er ihn
nicht selten selbst ver-
lachte. Der Witz ist
gar oft das Gesichter-
schneiden, das Räu-
spern und Augenzn-
drücken, mit dem wir
den bitteren Trank des
Lebens zu verwinden
suchen. In der Zer-
rissenheit der Welt nun
doch wieder ihre Ganz-
heit erkennen, auch das
vermochte Heine viel-
leicht; aber er ver-
mochte nicht, die Welt
in ihrer Ganzheit dar>
zustellen in seiner
Kunst. Dazu gehört
mehr als Heine, dazu
gehört ein Goethe.
Garten cker „^unck8kuge1"
Aussicht vom Zimmer, das Heinrich Heine im ,,Radspieler-Haus“ während
seines Münchner Aufenthaltes bewohnte
8l2
JUGEND
1899
«
Sehnsucht eines Vierzigjährigen, eines Fünfzig-
jährigen, der auf seiner Stirn wieder die Hand
der Mutter fühlen möchte. So hat uns Heine
das Volkslied des Kulturmenschen gesungen.
O nein, es dürfte den Feinden Heinrich
Heines nicht so ganz leicht werden, ihn uns
als einen Schmock nach Gust. Freytag'scher
Zeichnung hinzustellen. Die Skandal- und Re-
volverjournalisten besudeln allerdings zuweilen
sein Andenken, indem sie ihn wie eine Art
Schutzpatron hinstellen. Weil Heine zuweilen
einen Witz machte auf Kosten der Wahrheit,
so glauben sie, wenn sie tüchtig lögen, so wären
sie witzig. Aber Heine konnte wohl mit leicht-
fertigem Witz einen Menschen verletzen, der es
nicht verdiente; wenn es sich jedoch ernstlich
darum handelte, das Werk und die Kraft und
den inneren Werth eines Menschen zu beur-
theilen, dann trieb ihn ein unwiderstehlicher
Drang, gerecht und wahr zu sein, das hat er
lt. A. in seinem Streit mit Börne bewiesen,
in welchem er der ungleich noblere und ge-
rechtere Theil war. Dieser Heine hatte unge-
rechte Launen, ungerechte Stimmungen, aber
er hatte ein gerechtes, wahrheitsliebendes Herz.
Hebbel hat das Richtige getroffen: man
verstand das Individuelle seiner Poesie wie
seiner Persönlichkeit nicht, und er hat auch das
Richtige getroffen, als er von „plumpen Ästhe-
tikern" sprach. Es ist bekannt, daß plumpe
Physiognomiker ein Gesicht nach den Zügen
beurtheilen, die auf den ersten Blick in's Auge
fallen. Dieser Mann hat eine hohe Stirn,
ergo ist er ein tiefer Denker; jener hat ein vor-
tretendes Kinn, ergo ist er sehr energisch; der
andere hat eine Adlernase, ergo ist er stolz
und kühn. Man kann für den oberflächlichen
Beobachter eine ganz auffallende Ähnlichkeit
mit Goethe haben und dabei ein auffallender
Esel sein, und man kann aussehen wie ein bie-
derer Kleinbauer, dem das Lesen erhebliche
Schwierigkeiten machen dürfte — und dabei
Gedichte machen wie
Ludwig Uhland. Erst
nach intimster Beob-
achtung, nach längerem
Umgang erkennt man
die tausend feinen Li-
nien, die die Physio-
gnomie zu einer indi-
viduellen machen, sieht
man ein. daß dieser
scheinbar Goethe so
ähnliche Mensch doch
ganz bedenklich anders
aussieht und daß in
dieses anscheinend be-
schränkte Bauerngesicht
die Züge einer gehei-
men, göttlichen Schrift
eingegraben sind. Die
plumpen litterarischen
Physiognomiker besah-
en sich den Heinrich
Heine und erklärten:
Dieser Heine spottet
über Thron und Al-
tar, über Christenthum
und Judenthum, über
Adel und Bürgerkaste,
über Monarchie und
Republik, über Libera-
le und Kommunisten,
über Frankreich und Deutschland; er verlacht
am Ende eines Gedichts, was er an dessen An-
fang gepriesen, er bekennt sich mit größtem Cy-
nismus zu allen erdenklichen Schwächen und
Gebrechen und besingt Dinge, von denen an-
dere, bessere Menschen nicht einmal sprechen,
ergo ist dieser Heine ein frivoler, charakterloser,
herzloser, zerrissener Mensch, nur seine Gemein-
heit ist echt; seine Begeisterung, sein Schmerz,
seine Liebe, das alles ist Lüge.
Gottfried Keller gehörte zu den Leuten, die
sich ein Gesicht länger und genauer ansehen,
eh sie darüber urtheilen. Er sah sich den Heine
gründlich an und nannte ihn dann „den großen
Herzverleugner." Und er schrieb über ihn die
Verse:
„Und der Aff hier, dieser Dichter,
Der ein wohlgebildet Herz,
Das getauft in edle Rheinfluth,
In der reichen Brust getragen:
Kindisch hielt er es verborgen..."
Allerdings war auch das eine Liebhaberei
Heinrich Heine's: sich schlechter zu machen als
er war. So etwas thut man z. B., um sich
entweder über die lieben Mitmenschen ganz all-
gemein lustig zu machen oder man prahlt mit
Sünden, die man gar nicht begangen, um
Mucker-, Heuchler-, Philister- und Pharisäer-
pack, das die Schönheit der Welt durch seine
Verlogenheit am tiefsten trübt, so recht gründ-
lich zu ärgern, oder man thut es, weil m't
edlen Gefühlen und Vorsätzen so viel geschwin-
delt wird, daß man einen Ekel empfindet und
sich schon um der Abwechselung willen als
Scheusal geberdet, oder endlich man thut cs
aus einem tiefen, spezifisch deutschen Scham-
gefühl, das vor einem Lobe noch mehr erröthet
als vor einem Tadel, das nicht gelobt sein
mag und darum seine Vorzüge hinter vorge-
wandten Fehlern versteckt. Es gibt eine deutsche
Unbeholfenheit und Bärenhaftigkeit, hinter der
sich die feinste Anmuth verbirgt, das wissen
nicht alle. Selbst dieses letzte Gefühl war Heine
nicht fremd, wie er auch sehr zarte Pietäts-
gefühle besaß. Aber alles dies erklärt noch
nicht ganz seine vielbeschrieene „Schamlosig-
keit." Heine war nach Art aller Genies ein
Geist von außerordentlichem Weitblick und
Ueberblick. Solche Geister haben nicht nur
einen größeren Reichthum an Vorstellungen als
andere, sie beherrschen auch in jedem Augenblick
die ganze Masse dieser Vorstellungen, sie ver-
knüpfen die entferntesten Vorstellungen mit ein-
ander. Ihr geistiges Pendel hat eine ungeheure
Schwingungsweite. Wenn Heiners Seele sich
eben in den lieblichsten Gefilden der Schönheit
ergangen hatte, so warf das Gesetz des Pen-
dels, das Gesetz der seelischen Kontraste ihn im
nächsten Augenblick in die Nacht der häßlichsten
Wirklichkeiten zurück. Das geht auch anderen
so; aber ihn trieb dabei ein dämonischer Selbst-
zerlegungstrieb, ein großer, titanischer Ehrlich-
keits- und W.ahrheitsdrang, alles, alles auch
auszusprechen, was eine Menschenseele Hohes
und Gemeines beherbergt; dazu gesellte sich
dann wohl der Schmerz, daß das Schöne noch
immer so selten in der Welt und unter den
Menschen so verwaist ist, und in schlimmen
Augenblicken gewann eine bittere, grausame
Lust über ihn Gewalt, auch das bischen Schön-
heit zu zertrümmern, wie ein Verzweifelnder
wohl den letzten kleinen Rest seiner Habe ver-
geudet, weil er in aller Zukunft doch nur Ar-
muth und Noth sieht. Man kann es verstehen,
wenn ein Künstler, der soeben ein schönes, der
seligsten Anschauung entstammtes Bild vollen-
det hat und der sich vorstellt, wie wenig Freunde
es finden wird, welcher Unmasse von Thorheit
es begegnen wird, man kann es verstehen,
wenn er es vernichtet, indem er eine wilde
Fratze darüber pinselt, die die Zunge heraus-
streckt. Diezartesten, empfindlichsten Seelen sind
es, die solche verletzenden Scherze treiben.
Heines scheinbare „Zerrissenheit" war ge-
rade eine Ganzheit: er
umfaßte mit einem
Blick die Zerrissenheit
der Welt, und feilt
gutes, weiches Herz
litt unter dieser Zer-
rissenheit. Es ist wahr-
haftig nicht erlaubt,
den Weltschmerz dieses
Mannes für Komödie
zu halten, weil er ihn
nicht selten selbst ver-
lachte. Der Witz ist
gar oft das Gesichter-
schneiden, das Räu-
spern und Augenzn-
drücken, mit dem wir
den bitteren Trank des
Lebens zu verwinden
suchen. In der Zer-
rissenheit der Welt nun
doch wieder ihre Ganz-
heit erkennen, auch das
vermochte Heine viel-
leicht; aber er ver-
mochte nicht, die Welt
in ihrer Ganzheit dar>
zustellen in seiner
Kunst. Dazu gehört
mehr als Heine, dazu
gehört ein Goethe.
Garten cker „^unck8kuge1"
Aussicht vom Zimmer, das Heinrich Heine im ,,Radspieler-Haus“ während
seines Münchner Aufenthaltes bewohnte
8l2