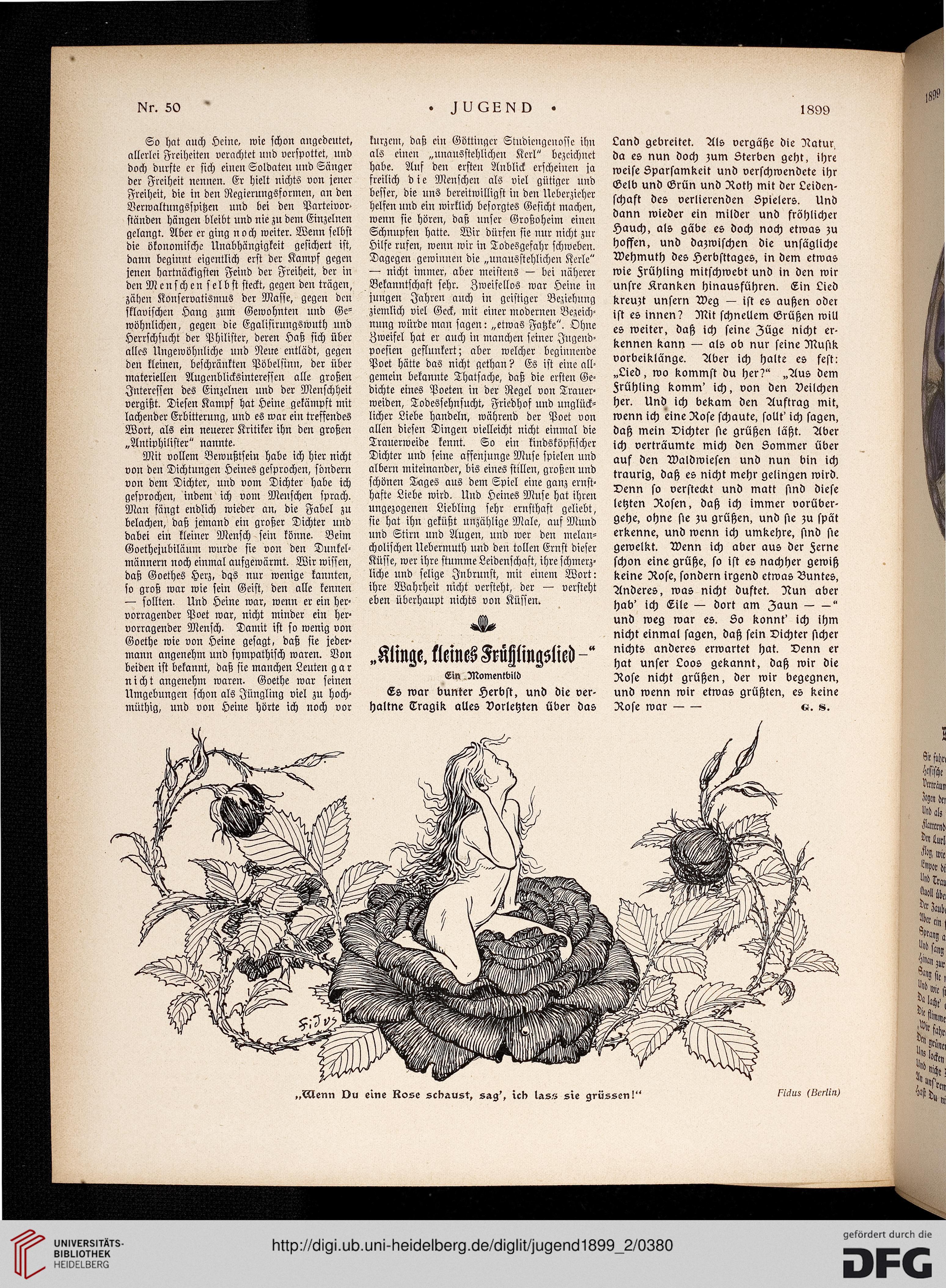Nr. 50
JUGEND
1899
So hat auch Heine, wie schon angedeutet,
allerlei Freiheiten verachtet und verspottet, und
doch durfte er sich einen Soldaten und Sänger
der Freiheit nennen. Er hielt nichts von jener
Freiheit, die in den Regierungsformen, an den
Verwaltungsspitzen und bei den Parteivor-
ständen hängen bleibt und nie Zu dem Einzelnen
gelangt. Aber er ging noch weiter. Wenn selbst
die ökonomische Unabhängigkeit gesichert ist,
dann beginnt eigentlich erst der Kampf gegen
jenen hartnäckigsten Feind der Freiheit, der in
den Menschen selb st steckt, gegen den trägen,
zähen Konservatismus der Masse, gegen den
sklavischen Hang Zum Gewohnten und Ge-
wöhnlichen, gegen die Egalisirungswuth und
Herrschsucht der Philister, deren Haß sich über
alles Ungewöhnliche und Nene entlädt, gegen
den kleinen, beschränkten Pöbelsinn, der über
materiellen Augenblicksinteressen alle großen
Interessen des Einzelnen und der Menschheit
vergißt. Diesen Kampf hat Heine gekämpft mit
lachender Erbitterung, und es war ein treffendes
Wort, als ein neuerer Kritiker ihn den großen
„Antiphilister" nannte.
Mit vollem Bewußtsein habe ich hier nicht
von den Dichtungen Heines gesprochen, sondern
von dem Dichter, und vom Dichter habe ich
gesprochen, indem ich vom Menschen sprach.
Man fängt endlich wieder an, die Fabel zu
belachen, daß jemand ein großer Dichter und
dabei ein kleiner Mensch sein könne. Beim
Goethejubiläum wurde sie von den Dunkel-
männern noch einmal aufgewärmt. Wir wissen,
daß Goethes Herz, dgs nur wenige kannten,
so groß war wie sein Geist, den alle kennen
— sollten. Und Heine war, wenn er ein her-
vorragender Poet war, nicht minder ein her-
vorragender Mensch. Damit ist so wenig von
Goethe wie von Heine gesagt, daß sie jeder-
mann angenehm und sympathisch waren. Von
beiden ist bekannt, daß sie manchen Leuten gar
nicht angenehm waren. Goethe war seinen
Umgebungen schon als Jüngling viel zu hoch-
müthig, und von Heine hörte ich noch vor
kurzem, daß ein Göttinger Studieugenosse ihn
als einen „unausstehlichen Kerl" bezeichnet
habe. Auf den ersten Anblick erscheinen ja
freilich die Menschen als viel gütiger und
besser, die uns bereitwilligst in den Ueberzieher
helfen und ein wirklich besorgtes Gesicht machen,
wenn sie hören, daß unser Großoheim einen
Schnupfen hatte. Wir dürfen sie nur nicht zur
Hilfe rufen, wenn wir in Todesgefahr schweben.
Dagegen gewinnen die „unausstehlichen Kerle"
— nicht immer, aber meistens — bei näherer
Bekanntschaft sehr. Zweifellos war Heine in
jungen Jahren auch in geistiger Beziehung
ziemlich viel Geck, mit einer modernen Bezeich-
nung würde man sagen: „etwas Fatzke". Ohne
Zweifel hat er auch in manchen seiner Jugend-
poesien geflunkert; aber welcher beginnende
Poet hätte das nicht gethan? Es ist eine all-
gemein bekannte Thatsache, daß die ersten Ge-
dichte eines Poeten in der Regel von Trauer-
weiden, Todessehnsucht, Friedhof und unglück-
licher Liebe handeln, während der Poet von
allen diesen Dingen vielleicht nicht einmal die
Trauerweide kennt. So ein kindsköpfischer
Dichter und seine affenjunge Muse spielen und
albern miteinander, bis eines stillen, großen und
schönen Tages aus dem Spiel eine ganz ernst-
hafte Liebe wird. Und Heines Muse hat ihren
ungezogenen Liebling sehr ernsthaft geliebt,
sie hat ihn geküßt unzählige Male, auf Mund
und Stirn und Augen, und wer den melan-
cholischen Uebermuth und den tollen Ernst dieser
Küsse, wer ihre stumme Leidenschaft, ihre schmerz-
liche und selige Inbrunst, mit einem Wort:
ihre Wahrheit nicht versteht, der — versteht
eben überhaupt nichts von Küssen.
„Klinge, kleines Imglingslie!»
Lin Momenkbild
Ls war bunter Herbst, und die ver-
haltne Tragik alles vorletzten über das
i
Land gebreitet. Als vergäße die Natur
da es nun doch ;um Sterben geht, ihre
weise Sparsamkeit und verschwendete ihr
Gelb und Grün und Roth mit der Leiden-
schaft des verlierenden Spielers. Und
dann wieder ein milder und fröhlicher
Hauch, als gäbe es doch noch etwas zu
hoffen, und dazwischen die unsägliche
Wehmuth des Herbsttages, in dem etwas
wie Frühling mitschwebt und in den wir
unsre Kranken hinaussühren. Lin Lied
kreuzt unfern Weg — ist es außen oder
ist es innen? Mit schnellem Grüßen will
es weiter, daß ich seine Züge nicht er-
kennen kann — als ob nur seine Musik
vorbeiklänge. Aber ich halte es fest:
„Lied, wo kommst du her?" „Aus dem
Frühling komm' ich, von den Veilchen
her. Und ich bekam den Auftrag mit,
wenn ich eine Rose schaute, sollt' ich sagen,
daß mein Dichter sie grüßen läßt. Aber
ich verträumte mich den Sommer über
auf den waldwiesen und nun bin ich
traurig, daß es nicht mehr gelingen wird.
Denn so versteckt und matt find diese
letzten Rosen, daß ich immer vorüber-
gehe, ohne sie zu grüßen, und sie zu spät
erkenne, und wenn ich umkehre, sind sie
gewelkt. Wenn ich aber aus der Ferne
schon eine grüße, so ist es nachher gewiß
keine Rose, sondern irgend etwas Buntes,
Anderes, was nicht duftet. Run aber
Hab' ich Lite — dort am Zaun-“
und weg war es. So könnt' ich ihm
nicht einmal sagen, daß sein Dichter sicher
nichts anderes erwartet hat. Denn er
hat unser Loos gekannt, daß wir die
Rose nicht grüßen, der wir begegnen,
und wenn wir etwas grüßten, es keine
Rose war- «. 8.
l
8ie fuhr,
Äsche
%it dei
Hub alg
Ratternd
% wie
Empor di
^ Wh,
% Ein |
fyraitj a
lind (r<ii
ftnau
3!te i
"Nd fti»
fcir 1
.ferne
Mnci
s
4*t:
„Menn Du eine Rose schaust, sag', ich lass sie grüssen!“
Fidus (Berlin)
JUGEND
1899
So hat auch Heine, wie schon angedeutet,
allerlei Freiheiten verachtet und verspottet, und
doch durfte er sich einen Soldaten und Sänger
der Freiheit nennen. Er hielt nichts von jener
Freiheit, die in den Regierungsformen, an den
Verwaltungsspitzen und bei den Parteivor-
ständen hängen bleibt und nie Zu dem Einzelnen
gelangt. Aber er ging noch weiter. Wenn selbst
die ökonomische Unabhängigkeit gesichert ist,
dann beginnt eigentlich erst der Kampf gegen
jenen hartnäckigsten Feind der Freiheit, der in
den Menschen selb st steckt, gegen den trägen,
zähen Konservatismus der Masse, gegen den
sklavischen Hang Zum Gewohnten und Ge-
wöhnlichen, gegen die Egalisirungswuth und
Herrschsucht der Philister, deren Haß sich über
alles Ungewöhnliche und Nene entlädt, gegen
den kleinen, beschränkten Pöbelsinn, der über
materiellen Augenblicksinteressen alle großen
Interessen des Einzelnen und der Menschheit
vergißt. Diesen Kampf hat Heine gekämpft mit
lachender Erbitterung, und es war ein treffendes
Wort, als ein neuerer Kritiker ihn den großen
„Antiphilister" nannte.
Mit vollem Bewußtsein habe ich hier nicht
von den Dichtungen Heines gesprochen, sondern
von dem Dichter, und vom Dichter habe ich
gesprochen, indem ich vom Menschen sprach.
Man fängt endlich wieder an, die Fabel zu
belachen, daß jemand ein großer Dichter und
dabei ein kleiner Mensch sein könne. Beim
Goethejubiläum wurde sie von den Dunkel-
männern noch einmal aufgewärmt. Wir wissen,
daß Goethes Herz, dgs nur wenige kannten,
so groß war wie sein Geist, den alle kennen
— sollten. Und Heine war, wenn er ein her-
vorragender Poet war, nicht minder ein her-
vorragender Mensch. Damit ist so wenig von
Goethe wie von Heine gesagt, daß sie jeder-
mann angenehm und sympathisch waren. Von
beiden ist bekannt, daß sie manchen Leuten gar
nicht angenehm waren. Goethe war seinen
Umgebungen schon als Jüngling viel zu hoch-
müthig, und von Heine hörte ich noch vor
kurzem, daß ein Göttinger Studieugenosse ihn
als einen „unausstehlichen Kerl" bezeichnet
habe. Auf den ersten Anblick erscheinen ja
freilich die Menschen als viel gütiger und
besser, die uns bereitwilligst in den Ueberzieher
helfen und ein wirklich besorgtes Gesicht machen,
wenn sie hören, daß unser Großoheim einen
Schnupfen hatte. Wir dürfen sie nur nicht zur
Hilfe rufen, wenn wir in Todesgefahr schweben.
Dagegen gewinnen die „unausstehlichen Kerle"
— nicht immer, aber meistens — bei näherer
Bekanntschaft sehr. Zweifellos war Heine in
jungen Jahren auch in geistiger Beziehung
ziemlich viel Geck, mit einer modernen Bezeich-
nung würde man sagen: „etwas Fatzke". Ohne
Zweifel hat er auch in manchen seiner Jugend-
poesien geflunkert; aber welcher beginnende
Poet hätte das nicht gethan? Es ist eine all-
gemein bekannte Thatsache, daß die ersten Ge-
dichte eines Poeten in der Regel von Trauer-
weiden, Todessehnsucht, Friedhof und unglück-
licher Liebe handeln, während der Poet von
allen diesen Dingen vielleicht nicht einmal die
Trauerweide kennt. So ein kindsköpfischer
Dichter und seine affenjunge Muse spielen und
albern miteinander, bis eines stillen, großen und
schönen Tages aus dem Spiel eine ganz ernst-
hafte Liebe wird. Und Heines Muse hat ihren
ungezogenen Liebling sehr ernsthaft geliebt,
sie hat ihn geküßt unzählige Male, auf Mund
und Stirn und Augen, und wer den melan-
cholischen Uebermuth und den tollen Ernst dieser
Küsse, wer ihre stumme Leidenschaft, ihre schmerz-
liche und selige Inbrunst, mit einem Wort:
ihre Wahrheit nicht versteht, der — versteht
eben überhaupt nichts von Küssen.
„Klinge, kleines Imglingslie!»
Lin Momenkbild
Ls war bunter Herbst, und die ver-
haltne Tragik alles vorletzten über das
i
Land gebreitet. Als vergäße die Natur
da es nun doch ;um Sterben geht, ihre
weise Sparsamkeit und verschwendete ihr
Gelb und Grün und Roth mit der Leiden-
schaft des verlierenden Spielers. Und
dann wieder ein milder und fröhlicher
Hauch, als gäbe es doch noch etwas zu
hoffen, und dazwischen die unsägliche
Wehmuth des Herbsttages, in dem etwas
wie Frühling mitschwebt und in den wir
unsre Kranken hinaussühren. Lin Lied
kreuzt unfern Weg — ist es außen oder
ist es innen? Mit schnellem Grüßen will
es weiter, daß ich seine Züge nicht er-
kennen kann — als ob nur seine Musik
vorbeiklänge. Aber ich halte es fest:
„Lied, wo kommst du her?" „Aus dem
Frühling komm' ich, von den Veilchen
her. Und ich bekam den Auftrag mit,
wenn ich eine Rose schaute, sollt' ich sagen,
daß mein Dichter sie grüßen läßt. Aber
ich verträumte mich den Sommer über
auf den waldwiesen und nun bin ich
traurig, daß es nicht mehr gelingen wird.
Denn so versteckt und matt find diese
letzten Rosen, daß ich immer vorüber-
gehe, ohne sie zu grüßen, und sie zu spät
erkenne, und wenn ich umkehre, sind sie
gewelkt. Wenn ich aber aus der Ferne
schon eine grüße, so ist es nachher gewiß
keine Rose, sondern irgend etwas Buntes,
Anderes, was nicht duftet. Run aber
Hab' ich Lite — dort am Zaun-“
und weg war es. So könnt' ich ihm
nicht einmal sagen, daß sein Dichter sicher
nichts anderes erwartet hat. Denn er
hat unser Loos gekannt, daß wir die
Rose nicht grüßen, der wir begegnen,
und wenn wir etwas grüßten, es keine
Rose war- «. 8.
l
8ie fuhr,
Äsche
%it dei
Hub alg
Ratternd
% wie
Empor di
^ Wh,
% Ein |
fyraitj a
lind (r<ii
ftnau
3!te i
"Nd fti»
fcir 1
.ferne
Mnci
s
4*t:
„Menn Du eine Rose schaust, sag', ich lass sie grüssen!“
Fidus (Berlin)