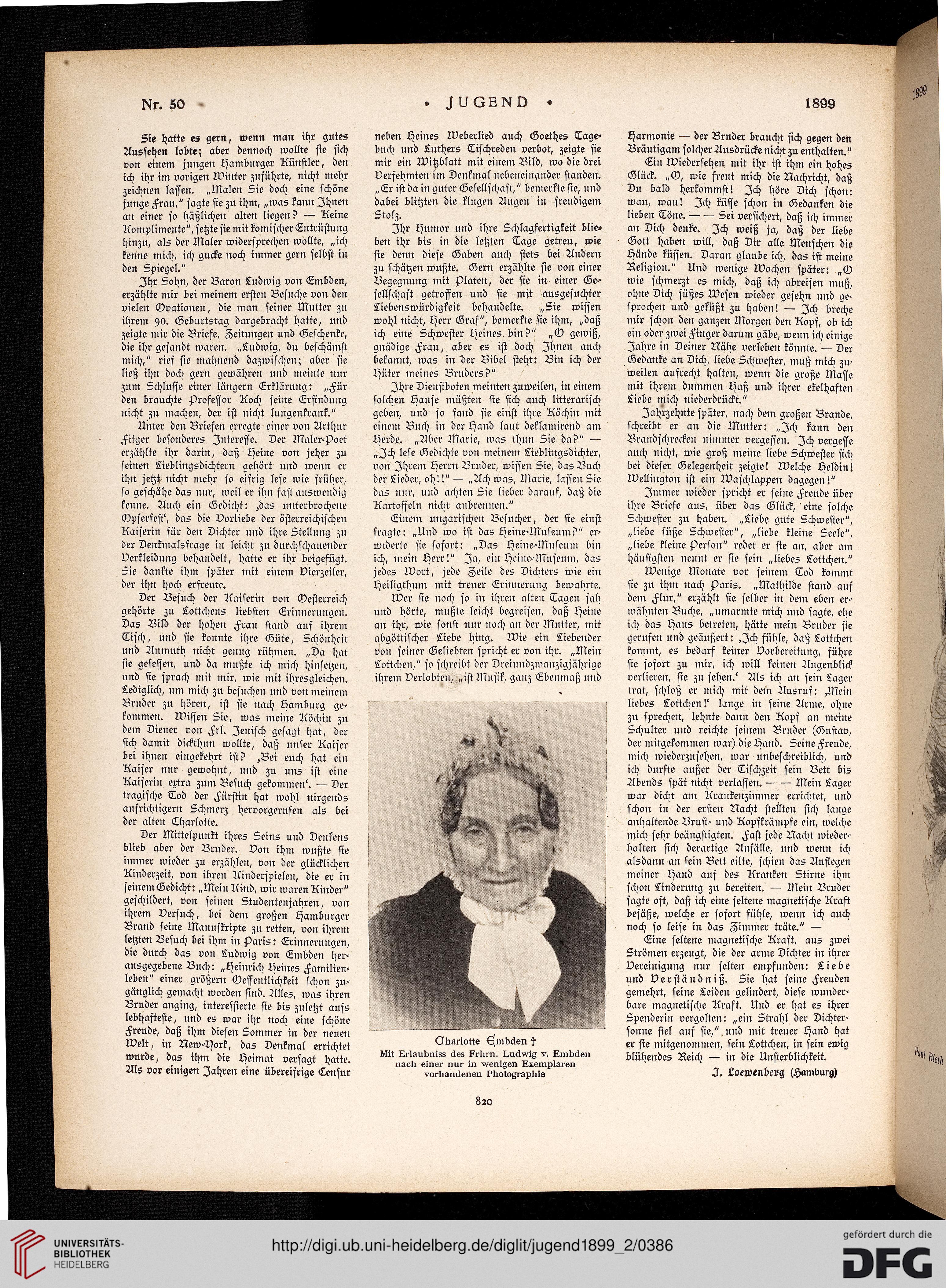Nr. 50
JUGEND
«
1899
Sie halte es gern, wenn man ihr gutes
Aussehen lobte; aber dennoch wollte sie sich
von einem jungen Hamburger Künstler, den
ich ihr im vorigen Winter zuführte, nicht mehr
zeichnen lassen. „Malen Sie doch eine schöne
junge Frau." sagte sie zu ihm, „was kann Ihnen
an einer so häßlichen alten liegen? — Keine
Komplimente", setzte sie mit komischer Entrüstung
hinzu, als der Maler widersprechen wollte, „ich
kenne mich, ich gucke noch immer gern selbst in
den Spiegel."
Ihr Sohn, der Baron Ludwig von Embden,
erzählte mir bei meinem ersten Besuche von den
vielen Ovationen, die man seiner Mutter zu
ihrem 90. Geburtstag dargebracht hatte, und
zeigte mir die Briefe, Zeitungen und Geschenke,
die ihr gesandt waren. „Ludwig, du beschämst
mich," rief sie mahnend dazwischen; aber sie
ließ ihn doch gern gewähren und meinte nur
zum Schlüsse einer längern Erklärung: „Für
den brauchte Professor Koch seine Erfindung
riicht zu machen, der ist nicht lungenkrank."
Unter den Briefen erregte einer von Arthur
Fitger besonderes Interesse. Der Maler-Poet
erzählte ihr darin, daß Heine von jeher zu
seinen Lieblingsdichtern gehört und wenn er
ihn jetzt nicht mehr so eifrig lese wie früher,
so geschähe das nur, weil er ihn fast auswendig
kenne. Auch ein Gedicht: -das unterbrochene
Opferfest', das die Vorliebe der österreichischen
Kaiserin für den Dichter und ihre Stellung zu
der Denkmalsfrage in leicht zu durchschauender
Verkleidung behandelt, hatte er ihr beigefügt.
Sie dankte ihm später mit einein Vierzeiler,
der ihn hoch erfreute.
Der Besuch der Kaiserin von Oesterreich
gehörte zu Lottchens liebsten Erinnerungen.
Das Bild der hohen Frau stand auf ihrem
Tisch, und sie konnte ihre Güte, Schönheit
und Anmuth nicht genug rühmen. „Da hat
sie gesessen, und da mußte ich mich hinsetzen,
und sie sprach mit mir, wie mit ihresgleichen.
Lediglich, um mich zu besuchen und von meinem
Bruder zu hören, ist sie nach Hamburg ge-
kommen. wissen Sie, was meine Köchin zu
dem Diener von Frl. Ionisch gesagt hat, der
sich damit dickthun wollte, daß unser Kaiser
bei ihnen eingekehrt ist? -Bei euch hat ein
Kaiser nur gewohnt, und zu uns ist eine
Kaiserin extra zum Besuch gekommen'. — Der
tragische Tod der Fürstin hat wohl nirgends
aufrichtigern Schmerz hervorgerufen als bei
der alten Charlotte.
Der Mittelpunkt ihres Seins und Denkens
blieb aber der Bruder, von ihm wußte sie
immer wieder zu erzählen, von der glücklichen
Kinderzeit, von ihren Kinderspielen, die er in
seinemGedicht: „Mein Kind, wir waren Kinder"
geschildert, von seinen Studentenjahren, von
ihrem versuch, bei dem großen Hamburger
Brand seine Manuskripte zu retten, von ihrem
letzten Besuch bei ihm in Paris: Erinnerungen,
die durch das von Ludwig von Embden her-
ausgegebene Buch: „Heinrich seines Familien-
lebens einer größern Oeffentlichkeit schon zu-
gänglich gemacht worden sind. Alles, was ihren
Bruder anging, interessierte sie bis zuletzt aufs
lebhafteste, und es war ihr noch eine schöne
Freude, daß ihm diesen Sommer in der neuen
Welt, in New-Hork, das Denkmal errichtet
wurde, das ihm die Heimat versagt hatte.
Als vor einigen Jahren eine übereifrige Lensur
neben fernes Weberlied auch Goethes Tage-
buch und Luthers Tischreden verbot, zeigte sie
mir ein Witzblatt mit einem Bild, wo die drei
verfehmten im Denkmal nebeneinander standen.
„Er ist da in guter Gesellschaft," bemerkte sie, und
dabei blitzten die klugen Augen in freudigem
Stolz.
Ihr Humor und ihre Schlagfertigkeit blie-
ben ihr bis in die letzten Tage getreu, wie
sie denn diese Gaben auch stets bei Andern
zu schätzen wußte. Gern erzählte sie von einer
Begegnung mit platen, der sie in einer Ge-
sellschaft getroffen und sie mit ausgesuchter
Liebenswürdigkeit behandelte. „Sie wissen
wohl nicht, Herr Graf", bemerkte sie ihm, „daß
ich eine Schwester seines bin?" „O gewiß,
gnädige Frau, aber es ist doch Ihnen auch
bekannt, was in der Bibel steht: Bin ich der
Hüter meines Bruders?"
Ihre Diettstboten meinten zuweilen, in einem
solchen krause müßten sie sich auch litterarisch
geben, und so fand sie einst ihre Köchin mit
einem Buch in der Hand laut deklamirend am
Herde. „Aber Marie, was thun Sie da?" —
„Ich lese Gedichte von meinem Lieblingsdichter,
von Ihrem Herrn Bruder, wissen Sie, das Buch
der Lieder, oh!l" — „Ach was, Marie, lassen Sie
das nur, und achten Sie lieber darauf, daß die
Kartoffeln nicht anbrennen."
Einem ungarischen Besucher, der sie einst
fragte: „Und wo ist das Heine-Museum?" er-
widerte sie sofort: „Das Heine-Museum bin
ich, mein Herr!" Ja, ein Heine-Museum, das
jedes Wort, jede Zeile des Dichters wie eilt
Heiligthum mit treuer Erinnerung bewahrte.
wer sie noch so tti ihren alten Tagen sah
und hörte, mußte leicht begreifen, daß Heine
an ihr, wie sonst nur noch an der Mutter, mit
abgöttischer Liebe hing, wie ein Liebender
von seiner Geliebten spricht er von ihr. „Mein
Lottchen," so schreibt der Dreiundzwanzigjährige
ihren: Verlobten, „ist Musik, ganz Ebenmaß und
Gharlotte €{mbden f
Mit Erlaubniss des Frhrn. Ludwig v. Embden
nach einer nur in wenigen Exemplaren
vorhandenen Photographie
Harmonie — der Bruder braucht sich gegen den
Bräutigam solcher Ausdrücke nicht zu enthalten."
Ein Wiedersehen mit ihr ist ihm ein hohes
Glück. „O, wie freut mich die Nachricht, daß
Du bald herkommst! Ich höre Dich schon:
wau, wau! Ich küsse schon in Gedanken die
lieben Töne.-Sei versichert, daß ich immer
an Dich denke. Ich weiß ja, daß der liebe
Gott haben will, daß Dir alle Menschen die
Hände küssen. Daran glaube ich, das ist meine
Religion." Und wenige Wochen später: „O
wie schmerzt es mich, daß ich abreisen muß,
ohne Dich süßes Wesen wieder gesehn und ge-
sprochen und geküßt zu haben! — Ich breche
mir schon den ganzen Morgen den Kopf, ob ich
ein oder zwei Finger darum gäbe, wenn ich einige
Jahre in Deiner Nähe verleben könnte. — Der
Gedanke an Dich, liebe Schwester, muß mich zu-
weilen aufrecht halten, wenn die große Masse
mit ihrem dummen Haß und ihrer ekelhaften
Liebe mich niederdrückt."
Jahrzehnte später, nach dem großen Brande,
schreibt er an die Mutter: „Ich kann den
Brandschrecken nimmer vergessen. Ich vergesse
auch nicht, wie groß meine liebe Schwester sich
bei dieser Gelegenheit zeigte! welche Heldin!
Wellington ist ein Waschlappen dagegen!"
Immer wieder spricht er seine Freude über
ihre Briefe aus, über das Glück, ' eine solche
Schwester zu haben. „Liebe gute Schwester",
„liebe süße Schwester", „liebe kleine Seele",
„liebe kleine Person" redet er sie an, aber am
häufigsten nennt er sie sein „liebes Lottchen."
wenige Monate vor seinem Tod kommt
sie zu ihm nach Paris. „Mathilde stand auf
dem Flur," erzählt sie selber in dem eben er-
wähnten Buche, „umarmte mich und sagte, ehe
ich das Haus betreten, hätte mein Bruder sie
gerufen und geäußert: ,Ich fühle, daß Lottchen
kommt, es bedarf keiner Vorbereitung, führe
sie sofort zu mir, ich will keinen Augenblick
verlieren, sie zu sehen.' Als ich an sein Lager
trat, schloß er mich mit dem Ausruf: -Mein
liebes Lottchen!' lange in seine Arme, ohne
zu sprechen, lehnte dann den Kopf an meine
Schulter und reichte seinem Bruder (Gustav,
der mitgekommen war) die Hand. Seine Freude,
mich wiederzusehen, war unbeschreiblich, und
ich durfte außer der Tischzeit sein Bett bis
Abends spät nicht verlassen.-Mein Lager
war dicht am Krankenzimmer errichtet, und
schon in der ersten Nacht stellten sich lange
anhaltende Brust- unb Kopfkrämpfe ein, welche
mich sehr beängstigten. Fast jede Nacht wieder-
holten sich derartige Anfälle, und wenn ich
alsdann an sein Bett eilte, schien das Auflegen
meiner Hand auf des Kranken Stirne ihm
schon Linderung zu bereiten. — Mein Bruder
sagte oft, daß ich eine seltene magnetische Kraft
besäße, welche er sofort fühle, wenn ich auch
noch so leise in das Zimmer träte." —
Eine seltene magnetische Kraft, aus zwei
Strömen erzeugt, die der arme Dichter in ihrer
Vereinigung nur selten empfunden: Liebe
und verständniß. Sie hat seine Freuden
gemehrt, seine Leiden gelindert, diese wunder-
bare magnetische Kraft. Und er hat es ihrer
Spenderin vergolten: „ein Strahl der Dichter-
sonne fiel auf sie," und mit treuer Hand hat
er sie mitgenommen, sein Lottchen, in sein ewig
blühendes Reich — in die Unsterblichkeit.
I. Loewenberg (Hamburg)
820
JUGEND
«
1899
Sie halte es gern, wenn man ihr gutes
Aussehen lobte; aber dennoch wollte sie sich
von einem jungen Hamburger Künstler, den
ich ihr im vorigen Winter zuführte, nicht mehr
zeichnen lassen. „Malen Sie doch eine schöne
junge Frau." sagte sie zu ihm, „was kann Ihnen
an einer so häßlichen alten liegen? — Keine
Komplimente", setzte sie mit komischer Entrüstung
hinzu, als der Maler widersprechen wollte, „ich
kenne mich, ich gucke noch immer gern selbst in
den Spiegel."
Ihr Sohn, der Baron Ludwig von Embden,
erzählte mir bei meinem ersten Besuche von den
vielen Ovationen, die man seiner Mutter zu
ihrem 90. Geburtstag dargebracht hatte, und
zeigte mir die Briefe, Zeitungen und Geschenke,
die ihr gesandt waren. „Ludwig, du beschämst
mich," rief sie mahnend dazwischen; aber sie
ließ ihn doch gern gewähren und meinte nur
zum Schlüsse einer längern Erklärung: „Für
den brauchte Professor Koch seine Erfindung
riicht zu machen, der ist nicht lungenkrank."
Unter den Briefen erregte einer von Arthur
Fitger besonderes Interesse. Der Maler-Poet
erzählte ihr darin, daß Heine von jeher zu
seinen Lieblingsdichtern gehört und wenn er
ihn jetzt nicht mehr so eifrig lese wie früher,
so geschähe das nur, weil er ihn fast auswendig
kenne. Auch ein Gedicht: -das unterbrochene
Opferfest', das die Vorliebe der österreichischen
Kaiserin für den Dichter und ihre Stellung zu
der Denkmalsfrage in leicht zu durchschauender
Verkleidung behandelt, hatte er ihr beigefügt.
Sie dankte ihm später mit einein Vierzeiler,
der ihn hoch erfreute.
Der Besuch der Kaiserin von Oesterreich
gehörte zu Lottchens liebsten Erinnerungen.
Das Bild der hohen Frau stand auf ihrem
Tisch, und sie konnte ihre Güte, Schönheit
und Anmuth nicht genug rühmen. „Da hat
sie gesessen, und da mußte ich mich hinsetzen,
und sie sprach mit mir, wie mit ihresgleichen.
Lediglich, um mich zu besuchen und von meinem
Bruder zu hören, ist sie nach Hamburg ge-
kommen. wissen Sie, was meine Köchin zu
dem Diener von Frl. Ionisch gesagt hat, der
sich damit dickthun wollte, daß unser Kaiser
bei ihnen eingekehrt ist? -Bei euch hat ein
Kaiser nur gewohnt, und zu uns ist eine
Kaiserin extra zum Besuch gekommen'. — Der
tragische Tod der Fürstin hat wohl nirgends
aufrichtigern Schmerz hervorgerufen als bei
der alten Charlotte.
Der Mittelpunkt ihres Seins und Denkens
blieb aber der Bruder, von ihm wußte sie
immer wieder zu erzählen, von der glücklichen
Kinderzeit, von ihren Kinderspielen, die er in
seinemGedicht: „Mein Kind, wir waren Kinder"
geschildert, von seinen Studentenjahren, von
ihrem versuch, bei dem großen Hamburger
Brand seine Manuskripte zu retten, von ihrem
letzten Besuch bei ihm in Paris: Erinnerungen,
die durch das von Ludwig von Embden her-
ausgegebene Buch: „Heinrich seines Familien-
lebens einer größern Oeffentlichkeit schon zu-
gänglich gemacht worden sind. Alles, was ihren
Bruder anging, interessierte sie bis zuletzt aufs
lebhafteste, und es war ihr noch eine schöne
Freude, daß ihm diesen Sommer in der neuen
Welt, in New-Hork, das Denkmal errichtet
wurde, das ihm die Heimat versagt hatte.
Als vor einigen Jahren eine übereifrige Lensur
neben fernes Weberlied auch Goethes Tage-
buch und Luthers Tischreden verbot, zeigte sie
mir ein Witzblatt mit einem Bild, wo die drei
verfehmten im Denkmal nebeneinander standen.
„Er ist da in guter Gesellschaft," bemerkte sie, und
dabei blitzten die klugen Augen in freudigem
Stolz.
Ihr Humor und ihre Schlagfertigkeit blie-
ben ihr bis in die letzten Tage getreu, wie
sie denn diese Gaben auch stets bei Andern
zu schätzen wußte. Gern erzählte sie von einer
Begegnung mit platen, der sie in einer Ge-
sellschaft getroffen und sie mit ausgesuchter
Liebenswürdigkeit behandelte. „Sie wissen
wohl nicht, Herr Graf", bemerkte sie ihm, „daß
ich eine Schwester seines bin?" „O gewiß,
gnädige Frau, aber es ist doch Ihnen auch
bekannt, was in der Bibel steht: Bin ich der
Hüter meines Bruders?"
Ihre Diettstboten meinten zuweilen, in einem
solchen krause müßten sie sich auch litterarisch
geben, und so fand sie einst ihre Köchin mit
einem Buch in der Hand laut deklamirend am
Herde. „Aber Marie, was thun Sie da?" —
„Ich lese Gedichte von meinem Lieblingsdichter,
von Ihrem Herrn Bruder, wissen Sie, das Buch
der Lieder, oh!l" — „Ach was, Marie, lassen Sie
das nur, und achten Sie lieber darauf, daß die
Kartoffeln nicht anbrennen."
Einem ungarischen Besucher, der sie einst
fragte: „Und wo ist das Heine-Museum?" er-
widerte sie sofort: „Das Heine-Museum bin
ich, mein Herr!" Ja, ein Heine-Museum, das
jedes Wort, jede Zeile des Dichters wie eilt
Heiligthum mit treuer Erinnerung bewahrte.
wer sie noch so tti ihren alten Tagen sah
und hörte, mußte leicht begreifen, daß Heine
an ihr, wie sonst nur noch an der Mutter, mit
abgöttischer Liebe hing, wie ein Liebender
von seiner Geliebten spricht er von ihr. „Mein
Lottchen," so schreibt der Dreiundzwanzigjährige
ihren: Verlobten, „ist Musik, ganz Ebenmaß und
Gharlotte €{mbden f
Mit Erlaubniss des Frhrn. Ludwig v. Embden
nach einer nur in wenigen Exemplaren
vorhandenen Photographie
Harmonie — der Bruder braucht sich gegen den
Bräutigam solcher Ausdrücke nicht zu enthalten."
Ein Wiedersehen mit ihr ist ihm ein hohes
Glück. „O, wie freut mich die Nachricht, daß
Du bald herkommst! Ich höre Dich schon:
wau, wau! Ich küsse schon in Gedanken die
lieben Töne.-Sei versichert, daß ich immer
an Dich denke. Ich weiß ja, daß der liebe
Gott haben will, daß Dir alle Menschen die
Hände küssen. Daran glaube ich, das ist meine
Religion." Und wenige Wochen später: „O
wie schmerzt es mich, daß ich abreisen muß,
ohne Dich süßes Wesen wieder gesehn und ge-
sprochen und geküßt zu haben! — Ich breche
mir schon den ganzen Morgen den Kopf, ob ich
ein oder zwei Finger darum gäbe, wenn ich einige
Jahre in Deiner Nähe verleben könnte. — Der
Gedanke an Dich, liebe Schwester, muß mich zu-
weilen aufrecht halten, wenn die große Masse
mit ihrem dummen Haß und ihrer ekelhaften
Liebe mich niederdrückt."
Jahrzehnte später, nach dem großen Brande,
schreibt er an die Mutter: „Ich kann den
Brandschrecken nimmer vergessen. Ich vergesse
auch nicht, wie groß meine liebe Schwester sich
bei dieser Gelegenheit zeigte! welche Heldin!
Wellington ist ein Waschlappen dagegen!"
Immer wieder spricht er seine Freude über
ihre Briefe aus, über das Glück, ' eine solche
Schwester zu haben. „Liebe gute Schwester",
„liebe süße Schwester", „liebe kleine Seele",
„liebe kleine Person" redet er sie an, aber am
häufigsten nennt er sie sein „liebes Lottchen."
wenige Monate vor seinem Tod kommt
sie zu ihm nach Paris. „Mathilde stand auf
dem Flur," erzählt sie selber in dem eben er-
wähnten Buche, „umarmte mich und sagte, ehe
ich das Haus betreten, hätte mein Bruder sie
gerufen und geäußert: ,Ich fühle, daß Lottchen
kommt, es bedarf keiner Vorbereitung, führe
sie sofort zu mir, ich will keinen Augenblick
verlieren, sie zu sehen.' Als ich an sein Lager
trat, schloß er mich mit dem Ausruf: -Mein
liebes Lottchen!' lange in seine Arme, ohne
zu sprechen, lehnte dann den Kopf an meine
Schulter und reichte seinem Bruder (Gustav,
der mitgekommen war) die Hand. Seine Freude,
mich wiederzusehen, war unbeschreiblich, und
ich durfte außer der Tischzeit sein Bett bis
Abends spät nicht verlassen.-Mein Lager
war dicht am Krankenzimmer errichtet, und
schon in der ersten Nacht stellten sich lange
anhaltende Brust- unb Kopfkrämpfe ein, welche
mich sehr beängstigten. Fast jede Nacht wieder-
holten sich derartige Anfälle, und wenn ich
alsdann an sein Bett eilte, schien das Auflegen
meiner Hand auf des Kranken Stirne ihm
schon Linderung zu bereiten. — Mein Bruder
sagte oft, daß ich eine seltene magnetische Kraft
besäße, welche er sofort fühle, wenn ich auch
noch so leise in das Zimmer träte." —
Eine seltene magnetische Kraft, aus zwei
Strömen erzeugt, die der arme Dichter in ihrer
Vereinigung nur selten empfunden: Liebe
und verständniß. Sie hat seine Freuden
gemehrt, seine Leiden gelindert, diese wunder-
bare magnetische Kraft. Und er hat es ihrer
Spenderin vergolten: „ein Strahl der Dichter-
sonne fiel auf sie," und mit treuer Hand hat
er sie mitgenommen, sein Lottchen, in sein ewig
blühendes Reich — in die Unsterblichkeit.
I. Loewenberg (Hamburg)
820