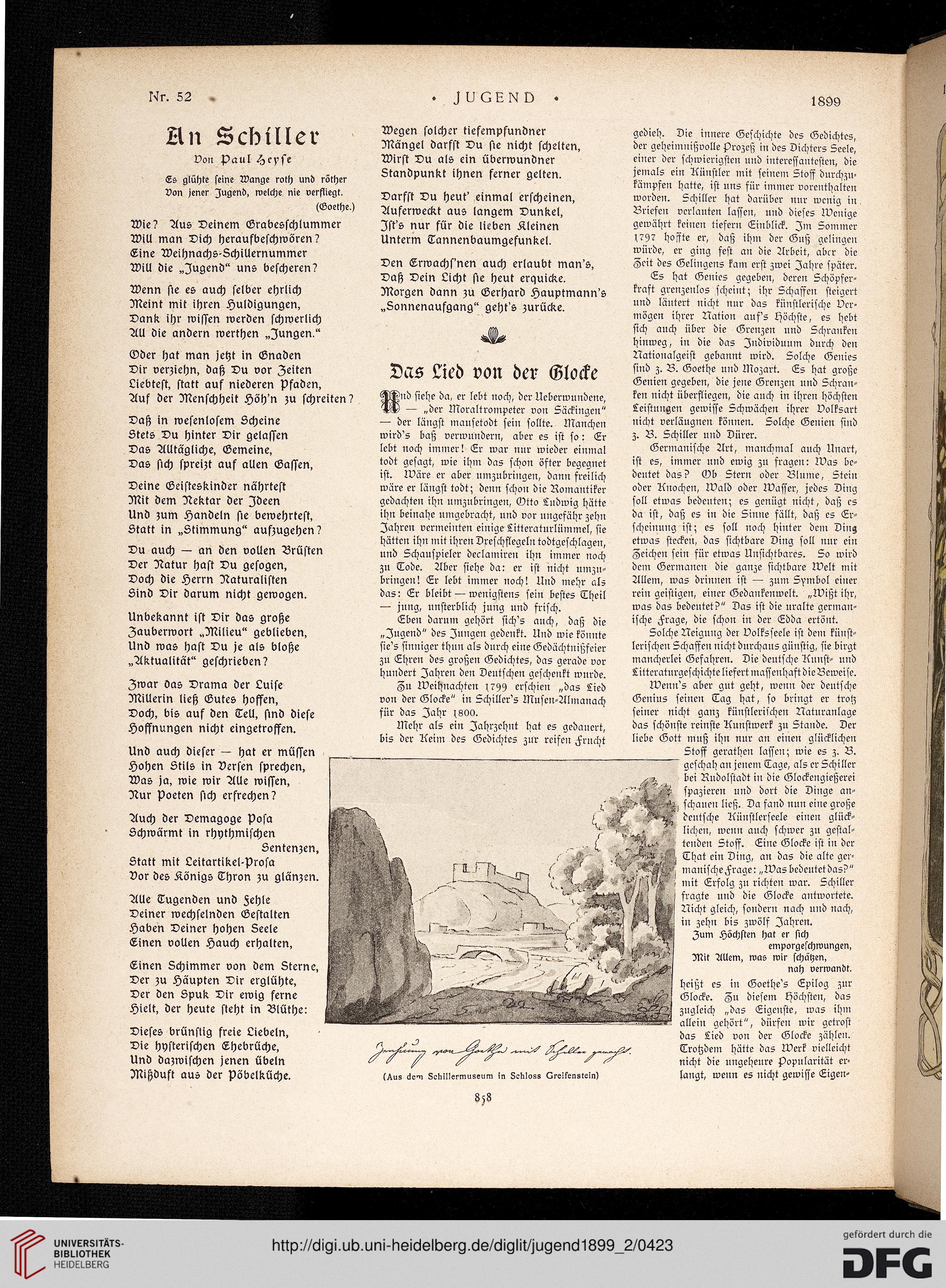Nr. 52
JUGEND
1899
Hn Schüler
von Paul Heyse
Ls glühte seine Wange roth und röther
von jener fugend, welche nie verfliegt.
(Goethe.)
wie? Aus Deinem Grabesschlummer
Will man Dich heraufbeschwören?
Line Weihnachs-SchiUernummer
will die „Jugend" uns bescheren?
wenn sie es auch selber ehrlich
Meint mit ihren Huldigungen,
Dank ihr wissen werden schwerlich
AU die andern werthen „Jungen."
Dder hat man jetzt in Gnaden
Dir vergehn, daß Du vor Zeiten
Liebtest, statt auf niederen Pfaden,
Auf der Menschheit Höh'n zu schreiten?
Daß in wesenlosem Scheine
Stets Du hinter Dir gelassen
Das Alltägliche, Gemeine,
Das sich spreizt auf allen Gassen,
Deine Geisteskinder nährtest
Mit dem Nektar der Ideen
Und zum Handeln sie bewehrtest,
Statt in „Stimmung" auszugehen?
Du auch — an den vollen Brüsten
Der Natur hast Du gesogen,
Doch die Herrn Naturalisten
Sind Dir darum nicht gewogen.
Unbekannt ist Dir das große
Zauberwort „Milieu" geblieben,
Und was hast Du je als bloße
„Aktualität" geschrieben?
Zwar das Drama der Luise
Millerin ließ Gutes hoffen,
Doch, bis auf den Tell, find diese
Hoffnungen nicht eingetroffen.
Und auch dieser — hat er müssen
Hohen Stils in Versen sprechen,
was ja, wie wir Alle wissen,
Nur Poeten sich erfrechen?
Auch der Demagoge posa
Schwärmt in rhythmischen
Sentenzen,
Statt mit Leitartikel-Prosa
Vor des Königs Thron zu glänzen.
Alle Tugenden und Zehle
Deiner wechselnden Gestalten
Haben Deiner hohen Seele
Linen vollen Hauch erhalten,
Linen Schimmer von dem Sterne,
Der zu Häupten Dir erglühte,
Der den Spuk Dir ewig ferne
Hielt, der heute steht in Blüthe:
Dieses brünstig freie Liebeln,
Die hysterischen Lhebrüche,
Und dazwischen jenen Übeln
Mißduft aus der Pöbelküche.
wegen solcher tiefempfundner
Mängel darfst Du sie nicht schelten,
wirst Du als ein überwundner
Standpunkt ihnen ferner gelten.
Darfst Du heut' einmal erscheinen,
Auferweckt aus langem Dunkel,
Ist's nur für die lieben Kleinen
Unterm Tannenbaumgefunkel.
Den Lrwachs'nen auch erlaubt man's,
Daß Dein Licht sie heut erquicke.
Morgen dann zu Gerhard Hauptmann's
„Sonnenaufgang" geht's zurücke.
Das £ie<> von der Glocke
Mud siehe da, er lebt noch, der Ueberwundene,
M — „der Moraltrompeter von Säckingen"
— der längst mausetodt sein sollte. Manchen
wird's baß verwundern, aber es ist so: Er
lebt noch immer! Er war nur wieder einmal
todt gesagt, wie ihm das schon öfter begegnet
ist. wäre er aber umzubringen, dann freilich
wäre er längst todt; denn schon die Romantiker
gedachten ihn umzubringen, Otto Ludwig hätte
ihn beinahe umgebracht, und vor ungefähr zehn
Jahren vermeinten einige Litteraturlümmel, sie
hätten ihn mit ihren Dreschflegeln todtgeschlagen,
und Schauspieler declamiren ihn immer noch
zu Tode. Aber siehe da: er ist nicht umzu-
bringen! Er lebt immer noch! Und mehr als
das: Er bleibt — wenigstens sein bestes Theil
— jung, unsterblich jung und frisch.
Eben darum gehört sich's auch, daß die
„Jugend" des Jungen gedenkt. Und wie könnte
sie's sinniger thun als durch eine Gedächtnißfeier
zu Ehren des großen Gedichtes, das gerade vor
hundert Jahren den Deutschen geschenkt wurde.
Zu Weihnachten l?99 erschien „das Lied
von der Glocke" in Schiller's Musen-Almanach
für das Jahr *800.
Mehr als ein Jahrzehnt hat es gedauert,
bis der Reim des Gedichtes zur reifeil Frucht
(Aus dem Schillermuseum in Schloss Greifenstein)
8)8
gedieh. Die innere Geschichte des Gedichtes,
der geheimnißvolle Prozeß in des Dichters Seele,
einer der schwierigsten und interessantesten, die
jemals ein Künstler mit seinem Stoff durchzn-
kämpfen hatte, ist uns für immer vorenthalten
worden. Schiller hat darüber nur wenig in
Briefen verlauten lassen, und dieses wenige
gewährt keinen tieferir Einblick. In: Sommer
^797 hoffte er, daß ihm der Guß gelingen
würde, er ging fest an die Arbeit, aber die
Zeit des Gelingens kam erst zwei Jahre später.
Es hat Genies gegeben, deren Schöpfer-
kraft grenzenlos scheint; ihr Schaffen steigert
und läutert nicht nur das künstlerische ver-
mögen ihrer Nation auf's höchste, es hebt
sich auch über die Grenzen und Schranken
hinweg, in die das Individuum durch den
Nationalgeist gebannt wird. Solche Genies
sind z. B. Goethe und Mozart. Es hat große
Genien gegeben, die jene Grenzen und Schran-
ken nicht überfliegen, die auch in ihren höchsten
Leistungen gewisse Schwächen ihrer Volksart
nicht verläugnen können. Solche Genien sind
z. B. Schiller und Dürer.
Germanische Art, manchmal auch Unart,
ist es, immer und ewig zu fragen: was be-
deutet das? Mb Stern oder Blume, Stein
oder Knochen, Wald oder Wasser, jedes Ding
soll etwas bedeuten; es genügt nicht, daß es
da ist, daß es in die Sinne fällt, daß es Er-
scheinung ist; es soll noch hinter den: Ding
etwas stecken, das sichtbare Ding soll nur ein
Zeichen sein für etwas Unsichtbares. So wird
dem Germanen die ganze sichtbare Welt mit
Allem, was drinnen ist — zum Symbol einer-
rein geistigen, einer Gedankenwelt, „wißt ihr,
was das bedeutet?" Das ist die uralte german-
ische Frage, die schon in der Edda ertönt.
Solche Neigung der Volksseele ist dein künst-
lerischen Schaffen nicht durchaus günstig, sie birgt
mancherlei Gefahren. Die deutsche Kunst- und
Literaturgeschichte liefert massenhaft die Beweise.
wenn's aber gut geht, wenn der deutsche
Genius seinen Tag hat, so bringt er trotz
seiner nicht ganz künstlerischen Naturanlage
das schönste reinste Kunstwerk zu Stande. Der
liebe Gott muß ihn nur an einen glücklichen
Stoff gerathen lassen; wie es z. B.
geschah an jenem Tage, als er Schiller
bei Rudolstadt in die Glockengießerei
spazieren und dort die Dinge an-
schauen ließ. Da fand nun eine große
deutsche Künstlerseele einen glück-
lichen, wenn auch schwer zu gestal-
tenden Stoff. Eine Glocke ist in der
That ein Ding, an das die alte ger-
' ^ manische Frage: „was bedeutet das?"
' ***'• iN isC-y Epfolg zu richten war. Schiller
fragte und die Glocke antwortete.
Nicht gleich, sondern nach und nach,
in zehn bis zwölf Jahren.
Jum Höchsten hat er sich
emporgeschwungen,
Mit Allem, was wir schätzen,
nah verwandt.
heißt es in Goethe's Epilog zur
Glocke. Zu diesem Höchsten, das
zugleich „das Eigenste, was ihm
allein gehört", dürfen wir getrost
das Lied von der Glocke zählen.
Trotzdem hätte das Werk vielleicht
nicht die ungeheure Popularität er-
langt, wenn es nicht gewisse Eigen-
JUGEND
1899
Hn Schüler
von Paul Heyse
Ls glühte seine Wange roth und röther
von jener fugend, welche nie verfliegt.
(Goethe.)
wie? Aus Deinem Grabesschlummer
Will man Dich heraufbeschwören?
Line Weihnachs-SchiUernummer
will die „Jugend" uns bescheren?
wenn sie es auch selber ehrlich
Meint mit ihren Huldigungen,
Dank ihr wissen werden schwerlich
AU die andern werthen „Jungen."
Dder hat man jetzt in Gnaden
Dir vergehn, daß Du vor Zeiten
Liebtest, statt auf niederen Pfaden,
Auf der Menschheit Höh'n zu schreiten?
Daß in wesenlosem Scheine
Stets Du hinter Dir gelassen
Das Alltägliche, Gemeine,
Das sich spreizt auf allen Gassen,
Deine Geisteskinder nährtest
Mit dem Nektar der Ideen
Und zum Handeln sie bewehrtest,
Statt in „Stimmung" auszugehen?
Du auch — an den vollen Brüsten
Der Natur hast Du gesogen,
Doch die Herrn Naturalisten
Sind Dir darum nicht gewogen.
Unbekannt ist Dir das große
Zauberwort „Milieu" geblieben,
Und was hast Du je als bloße
„Aktualität" geschrieben?
Zwar das Drama der Luise
Millerin ließ Gutes hoffen,
Doch, bis auf den Tell, find diese
Hoffnungen nicht eingetroffen.
Und auch dieser — hat er müssen
Hohen Stils in Versen sprechen,
was ja, wie wir Alle wissen,
Nur Poeten sich erfrechen?
Auch der Demagoge posa
Schwärmt in rhythmischen
Sentenzen,
Statt mit Leitartikel-Prosa
Vor des Königs Thron zu glänzen.
Alle Tugenden und Zehle
Deiner wechselnden Gestalten
Haben Deiner hohen Seele
Linen vollen Hauch erhalten,
Linen Schimmer von dem Sterne,
Der zu Häupten Dir erglühte,
Der den Spuk Dir ewig ferne
Hielt, der heute steht in Blüthe:
Dieses brünstig freie Liebeln,
Die hysterischen Lhebrüche,
Und dazwischen jenen Übeln
Mißduft aus der Pöbelküche.
wegen solcher tiefempfundner
Mängel darfst Du sie nicht schelten,
wirst Du als ein überwundner
Standpunkt ihnen ferner gelten.
Darfst Du heut' einmal erscheinen,
Auferweckt aus langem Dunkel,
Ist's nur für die lieben Kleinen
Unterm Tannenbaumgefunkel.
Den Lrwachs'nen auch erlaubt man's,
Daß Dein Licht sie heut erquicke.
Morgen dann zu Gerhard Hauptmann's
„Sonnenaufgang" geht's zurücke.
Das £ie<> von der Glocke
Mud siehe da, er lebt noch, der Ueberwundene,
M — „der Moraltrompeter von Säckingen"
— der längst mausetodt sein sollte. Manchen
wird's baß verwundern, aber es ist so: Er
lebt noch immer! Er war nur wieder einmal
todt gesagt, wie ihm das schon öfter begegnet
ist. wäre er aber umzubringen, dann freilich
wäre er längst todt; denn schon die Romantiker
gedachten ihn umzubringen, Otto Ludwig hätte
ihn beinahe umgebracht, und vor ungefähr zehn
Jahren vermeinten einige Litteraturlümmel, sie
hätten ihn mit ihren Dreschflegeln todtgeschlagen,
und Schauspieler declamiren ihn immer noch
zu Tode. Aber siehe da: er ist nicht umzu-
bringen! Er lebt immer noch! Und mehr als
das: Er bleibt — wenigstens sein bestes Theil
— jung, unsterblich jung und frisch.
Eben darum gehört sich's auch, daß die
„Jugend" des Jungen gedenkt. Und wie könnte
sie's sinniger thun als durch eine Gedächtnißfeier
zu Ehren des großen Gedichtes, das gerade vor
hundert Jahren den Deutschen geschenkt wurde.
Zu Weihnachten l?99 erschien „das Lied
von der Glocke" in Schiller's Musen-Almanach
für das Jahr *800.
Mehr als ein Jahrzehnt hat es gedauert,
bis der Reim des Gedichtes zur reifeil Frucht
(Aus dem Schillermuseum in Schloss Greifenstein)
8)8
gedieh. Die innere Geschichte des Gedichtes,
der geheimnißvolle Prozeß in des Dichters Seele,
einer der schwierigsten und interessantesten, die
jemals ein Künstler mit seinem Stoff durchzn-
kämpfen hatte, ist uns für immer vorenthalten
worden. Schiller hat darüber nur wenig in
Briefen verlauten lassen, und dieses wenige
gewährt keinen tieferir Einblick. In: Sommer
^797 hoffte er, daß ihm der Guß gelingen
würde, er ging fest an die Arbeit, aber die
Zeit des Gelingens kam erst zwei Jahre später.
Es hat Genies gegeben, deren Schöpfer-
kraft grenzenlos scheint; ihr Schaffen steigert
und läutert nicht nur das künstlerische ver-
mögen ihrer Nation auf's höchste, es hebt
sich auch über die Grenzen und Schranken
hinweg, in die das Individuum durch den
Nationalgeist gebannt wird. Solche Genies
sind z. B. Goethe und Mozart. Es hat große
Genien gegeben, die jene Grenzen und Schran-
ken nicht überfliegen, die auch in ihren höchsten
Leistungen gewisse Schwächen ihrer Volksart
nicht verläugnen können. Solche Genien sind
z. B. Schiller und Dürer.
Germanische Art, manchmal auch Unart,
ist es, immer und ewig zu fragen: was be-
deutet das? Mb Stern oder Blume, Stein
oder Knochen, Wald oder Wasser, jedes Ding
soll etwas bedeuten; es genügt nicht, daß es
da ist, daß es in die Sinne fällt, daß es Er-
scheinung ist; es soll noch hinter den: Ding
etwas stecken, das sichtbare Ding soll nur ein
Zeichen sein für etwas Unsichtbares. So wird
dem Germanen die ganze sichtbare Welt mit
Allem, was drinnen ist — zum Symbol einer-
rein geistigen, einer Gedankenwelt, „wißt ihr,
was das bedeutet?" Das ist die uralte german-
ische Frage, die schon in der Edda ertönt.
Solche Neigung der Volksseele ist dein künst-
lerischen Schaffen nicht durchaus günstig, sie birgt
mancherlei Gefahren. Die deutsche Kunst- und
Literaturgeschichte liefert massenhaft die Beweise.
wenn's aber gut geht, wenn der deutsche
Genius seinen Tag hat, so bringt er trotz
seiner nicht ganz künstlerischen Naturanlage
das schönste reinste Kunstwerk zu Stande. Der
liebe Gott muß ihn nur an einen glücklichen
Stoff gerathen lassen; wie es z. B.
geschah an jenem Tage, als er Schiller
bei Rudolstadt in die Glockengießerei
spazieren und dort die Dinge an-
schauen ließ. Da fand nun eine große
deutsche Künstlerseele einen glück-
lichen, wenn auch schwer zu gestal-
tenden Stoff. Eine Glocke ist in der
That ein Ding, an das die alte ger-
' ^ manische Frage: „was bedeutet das?"
' ***'• iN isC-y Epfolg zu richten war. Schiller
fragte und die Glocke antwortete.
Nicht gleich, sondern nach und nach,
in zehn bis zwölf Jahren.
Jum Höchsten hat er sich
emporgeschwungen,
Mit Allem, was wir schätzen,
nah verwandt.
heißt es in Goethe's Epilog zur
Glocke. Zu diesem Höchsten, das
zugleich „das Eigenste, was ihm
allein gehört", dürfen wir getrost
das Lied von der Glocke zählen.
Trotzdem hätte das Werk vielleicht
nicht die ungeheure Popularität er-
langt, wenn es nicht gewisse Eigen-