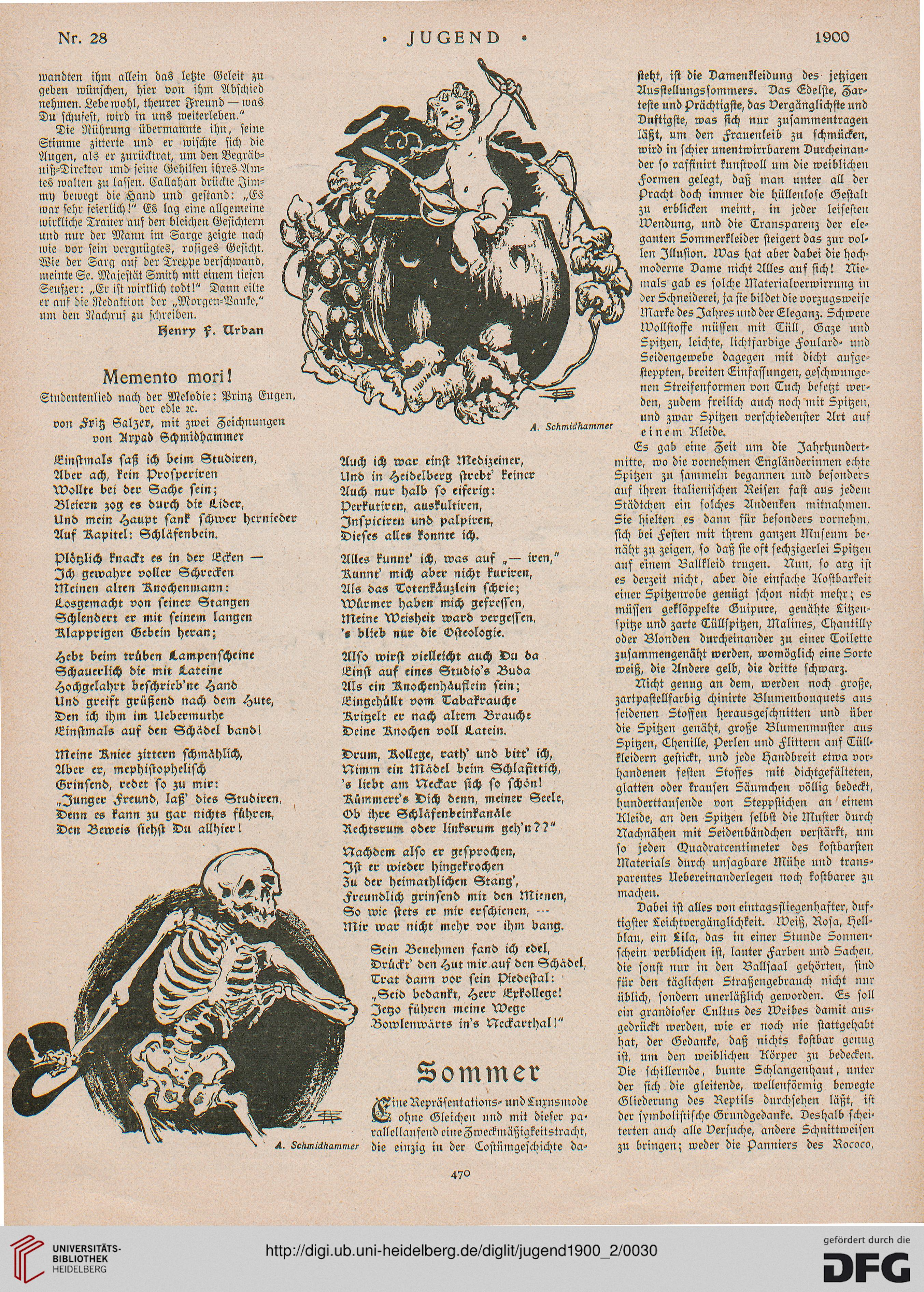Nr. 28
JUGEND
1900
wandten ihm allein das letzte Geleit zu
geben wünschen, hier von ihm Abschied
nehmen. Lebewohl, theurer Freund — ivas
Du schufest, wird in uns weitcrleben."
Die Rührung übermannte ihn, seine
Stimme zitterte und er wischte sich die
Augen, als er zurücktrat, um den Begräb-
niß-Direktor und seine Gehilfen ihres Am-
tes walten zu lassen. Callahan drückte Jim-
mh beivegt die Hand und gestand: „ES
>vnr sehr feierlich!" Es lag eine allgemeine
wirkliche Trauer aus den bleichen Gesichtern
und nur der Mann im Sarge zeigte nach
wie vor sein vergnügtes, rosiges Gesicht.
Wie der Sarg aus der Treppe verschwand,
meinte Sc. Majestät Smith mit einem tiefen
Seufzer: „Er ist wirklich tobt!" Dann eilte
er ans die Redaktion der „Morgen-Pauke,"
um den Nachruf zu schreiben.
Henry f. Urban
Memento mori!
Stndcntenlicd nach der Melodie: Prinz Eugen
der edle rc.
von Fritz Salzer, mit zwei Zcichmingen
von Arpad Schmidhammer
Einstmals saß ich beim Studiren,
Aber ach, kein Prospcriren
wollte bei dev Sache sein;
Bleiern zog cs durch die Lider,
Und mein Haupt sank schwer hernieder
Auf Rapitcl: Schläfenbein.
plötzlich knackt cs in der Ecken —
Ich gewahre voller Schrecken
Meinen alten Rnochenmann:
Losgemacht von seiner Stangen
Schlendert er mit seinem langen
Klapprigen Gebein heran;
Hebt beim trüben Lampcnscheine
Schauerlich die mit Latrine
Hochgclahrt bcschricb'nc Hand
Und greift grüßend nach dem Hute,
Den ich ihm im Ucbcrmuthe
Einstmals auf den Schädel bandl
Meine Rniee zittern schmählich,
Aber er, mephistophelisch
Grinsend, redet so zu mir:
»Junger Freund, laß' dies Studiren,
Denn es kann zu gar nichts führen,
Den Beweis siehst Du allhier l
Ä. Schmidhammer
A. Schmidhammer
Auch ich war einst Medizeiner,
Und in Heidelberg strebt' keiner
Auch nur halb so eiferig:
pcrkutiren, auskulriren,
Inspiciren und palpiren,
Dieses alle» konnte ich.
Alles kunnt' ich, was auf ieen,"
Aunnt' mich aber nicht kurircn,
211« das Dotcnkäuzlcin schrie;
Würmer haben mich gefressen,
Meine Weisheit ward vergessen,
'» blieb nur die Osteologie.
Also wirst vielleicht auch Du da
Einst auf eine» Studio'» Buda
Als ein Rnschenhäuflein sein;
Eingchüllt vom Tabakrauche
'Kritzelt er nach altem Brauche
Deine Rnochcn voll Latein.
Drum, Rollcge, rath' und bitt' ich,
Nimm ein Mädel beim Schlafittich,
's liebt am Neckar sich so schön!
'Kümmert'» Dich denn, meiner Seele,
Ob ihre Schläfenbeinkanäle
Acchtsrum oder linksrum gch'n??"
Nachdem also er gesprochen,
Ist er wieder hingekrochcn
Zu der hcimathlichen Stang',
Freundlich grinsend mit den Mienen,
So wie stets er mir erschienen,
Mir war nicht mehr vor ihm bang.
Sein Benehmen fand ich edel,
Drückt' den Hut mir.auf den Schädel,
Trat dann vor sein picdcstal:
„Seid bedankt, Herr Exkollcge!
Jetzo führen meine Wege
Bowlenwärts in's Ncckarthall"
Sommer
kine Repräsentations- und Lnxusmode
ohne Gleichen und mit dieser pa-
rallellaufend cineZweckmäßigkeitstracht,
die einzig in der Loftümgeschichte da-
steht, ist die Damenkleidung des jetzigen
Ausstellungssommers. Das Edelste, Zar-
teste und prächtigste, das vergänglichste und
Duftigste, was stch nur Zusammentragen
läßt, um den Frauenleib zu schmücken,
wird in schier unentwirrbarem Durcheinan-
der so raffinirt kunstvoll um die weiblichen
Formen gelegt, daß man unter all der
Pracht doch immer die hüllenlose Gestalt
zu erblicken meint, in jeder leisesten
Wendung, und die Transparenz der ele-
ganten Sommerkleider steigert das zur vol-
len Illusion, was hat aber dabei die hoch-
moderne Dame nicht 2llles auf sich! Nie-
mals gab es solche Materialverwirrung in
der Schneiderei, ja sie bildet die vorzugsweise
Marke des Jahres und der Eleganz. Schwere
Wollstoffe müssen mit Tüll, Gaze und
Spitzen, leichte, lichtfarbige Foulard- und
Seidengewebe dagegen mit dicht aufge
steppten, breiten Einfassungen, geschwunge-
nen Sireifenformen von Tuch besetzt wer-
den, zudem freilich auch noch mit Spitzen,
und zwar Spitzen verschiedenster 2Irt auf
eine m Kleide.
Es gab eine Zeit um die Jahrhundert-
mitte, wo die vornehmen Engländerinnen echte
Spitzen zu sammeln begannen und besonders
auf ihren italienischen Reisen fast aus jedem
Städtchen ein solches 2lndenken Mitnahmen.
Sie hielten es dann für besonders vornehm,
sich bei Festen mit ihrem ganzen Museum be-
näht zu zeigen, so daß sie oft sechzigcrlci Spitzen
auf einem Ballkleid trugen. Nun, so arg ist
es derzeit nicht, aber die einfache Kostbarkeit
einer Spitzenrobe genügt schon nicht mehr; es
müssen geklöppelte Guipure, genähte Litzen-
spitzc und zarte Tüllspihen, Malines, Chantilly
oder Blonden durcheinander zu einer Toilette
zusammengenäht werden, womöglich eine Sorte
weiß, die Andere gelb, die dritte schwarz.
Nicht genug an dem, werden noch große,
zartpastellfarbig chinirte Blnmcnbouquets ans
seidenen Stoffen herausgeschnittcn und über
die Spitzen genäht, große Blnmenmnstcr ans
Spitzen, Chenille, perlen und Flittern auf Tüll-
klcidern gestickt, und jede Handbreit etwa vor-
handenen festen Stoffes mit dichtgefälteten,
glatten oder krausen Säumchen völlig bedeckt,
hunderttausende von Steppstichen an einem
Kleide, an den Spitzen selbst die Muster durch
Nachnähen mit Seidenbändchen verstärkt, um
so jeden (Yuadratcentimeter des kostbarsten
Materials durch unsagbare Mühe und trans-
parentes Uebereinanderlegeu noch kostbarer zu
machen.
Dabei ist alles von eintagsfliegenhafter, duf-
tigster Leichtvergänglichkeit, weiß, Rosa, Hell-
blan, ein Lila, das in einer Stunde Sonnen-
schein verblichen ist, lauter Farben und Sachen,
die sonst nur in den Ballsaal gehörten, sind
für den täglichen Straßengebrauch nicht nur
üblich, sondern unerläßlich geworden. Es soll
ein grandioser Lultus des Weibes damit aus-
gedrückt werden, wie er noch nie stattgehabt
hat, der Gedanke, daß nichts kostbar genug
ist, um den weiblichen Körper zu bedecken.
Die schillernde, bunte Schlaugcuhaut, untcr
der sich die gleitende, wellenförmig bewegte
Gliederung des Reptils durchsehen läßt, ist
der symbolistische Grundgedanke. Deshalb schei-
terten auch alle versuche, andere Schnittweisen
zu bringen; weder die Panniers des Rococo,
4?o
JUGEND
1900
wandten ihm allein das letzte Geleit zu
geben wünschen, hier von ihm Abschied
nehmen. Lebewohl, theurer Freund — ivas
Du schufest, wird in uns weitcrleben."
Die Rührung übermannte ihn, seine
Stimme zitterte und er wischte sich die
Augen, als er zurücktrat, um den Begräb-
niß-Direktor und seine Gehilfen ihres Am-
tes walten zu lassen. Callahan drückte Jim-
mh beivegt die Hand und gestand: „ES
>vnr sehr feierlich!" Es lag eine allgemeine
wirkliche Trauer aus den bleichen Gesichtern
und nur der Mann im Sarge zeigte nach
wie vor sein vergnügtes, rosiges Gesicht.
Wie der Sarg aus der Treppe verschwand,
meinte Sc. Majestät Smith mit einem tiefen
Seufzer: „Er ist wirklich tobt!" Dann eilte
er ans die Redaktion der „Morgen-Pauke,"
um den Nachruf zu schreiben.
Henry f. Urban
Memento mori!
Stndcntenlicd nach der Melodie: Prinz Eugen
der edle rc.
von Fritz Salzer, mit zwei Zcichmingen
von Arpad Schmidhammer
Einstmals saß ich beim Studiren,
Aber ach, kein Prospcriren
wollte bei dev Sache sein;
Bleiern zog cs durch die Lider,
Und mein Haupt sank schwer hernieder
Auf Rapitcl: Schläfenbein.
plötzlich knackt cs in der Ecken —
Ich gewahre voller Schrecken
Meinen alten Rnochenmann:
Losgemacht von seiner Stangen
Schlendert er mit seinem langen
Klapprigen Gebein heran;
Hebt beim trüben Lampcnscheine
Schauerlich die mit Latrine
Hochgclahrt bcschricb'nc Hand
Und greift grüßend nach dem Hute,
Den ich ihm im Ucbcrmuthe
Einstmals auf den Schädel bandl
Meine Rniee zittern schmählich,
Aber er, mephistophelisch
Grinsend, redet so zu mir:
»Junger Freund, laß' dies Studiren,
Denn es kann zu gar nichts führen,
Den Beweis siehst Du allhier l
Ä. Schmidhammer
A. Schmidhammer
Auch ich war einst Medizeiner,
Und in Heidelberg strebt' keiner
Auch nur halb so eiferig:
pcrkutiren, auskulriren,
Inspiciren und palpiren,
Dieses alle» konnte ich.
Alles kunnt' ich, was auf ieen,"
Aunnt' mich aber nicht kurircn,
211« das Dotcnkäuzlcin schrie;
Würmer haben mich gefressen,
Meine Weisheit ward vergessen,
'» blieb nur die Osteologie.
Also wirst vielleicht auch Du da
Einst auf eine» Studio'» Buda
Als ein Rnschenhäuflein sein;
Eingchüllt vom Tabakrauche
'Kritzelt er nach altem Brauche
Deine Rnochcn voll Latein.
Drum, Rollcge, rath' und bitt' ich,
Nimm ein Mädel beim Schlafittich,
's liebt am Neckar sich so schön!
'Kümmert'» Dich denn, meiner Seele,
Ob ihre Schläfenbeinkanäle
Acchtsrum oder linksrum gch'n??"
Nachdem also er gesprochen,
Ist er wieder hingekrochcn
Zu der hcimathlichen Stang',
Freundlich grinsend mit den Mienen,
So wie stets er mir erschienen,
Mir war nicht mehr vor ihm bang.
Sein Benehmen fand ich edel,
Drückt' den Hut mir.auf den Schädel,
Trat dann vor sein picdcstal:
„Seid bedankt, Herr Exkollcge!
Jetzo führen meine Wege
Bowlenwärts in's Ncckarthall"
Sommer
kine Repräsentations- und Lnxusmode
ohne Gleichen und mit dieser pa-
rallellaufend cineZweckmäßigkeitstracht,
die einzig in der Loftümgeschichte da-
steht, ist die Damenkleidung des jetzigen
Ausstellungssommers. Das Edelste, Zar-
teste und prächtigste, das vergänglichste und
Duftigste, was stch nur Zusammentragen
läßt, um den Frauenleib zu schmücken,
wird in schier unentwirrbarem Durcheinan-
der so raffinirt kunstvoll um die weiblichen
Formen gelegt, daß man unter all der
Pracht doch immer die hüllenlose Gestalt
zu erblicken meint, in jeder leisesten
Wendung, und die Transparenz der ele-
ganten Sommerkleider steigert das zur vol-
len Illusion, was hat aber dabei die hoch-
moderne Dame nicht 2llles auf sich! Nie-
mals gab es solche Materialverwirrung in
der Schneiderei, ja sie bildet die vorzugsweise
Marke des Jahres und der Eleganz. Schwere
Wollstoffe müssen mit Tüll, Gaze und
Spitzen, leichte, lichtfarbige Foulard- und
Seidengewebe dagegen mit dicht aufge
steppten, breiten Einfassungen, geschwunge-
nen Sireifenformen von Tuch besetzt wer-
den, zudem freilich auch noch mit Spitzen,
und zwar Spitzen verschiedenster 2Irt auf
eine m Kleide.
Es gab eine Zeit um die Jahrhundert-
mitte, wo die vornehmen Engländerinnen echte
Spitzen zu sammeln begannen und besonders
auf ihren italienischen Reisen fast aus jedem
Städtchen ein solches 2lndenken Mitnahmen.
Sie hielten es dann für besonders vornehm,
sich bei Festen mit ihrem ganzen Museum be-
näht zu zeigen, so daß sie oft sechzigcrlci Spitzen
auf einem Ballkleid trugen. Nun, so arg ist
es derzeit nicht, aber die einfache Kostbarkeit
einer Spitzenrobe genügt schon nicht mehr; es
müssen geklöppelte Guipure, genähte Litzen-
spitzc und zarte Tüllspihen, Malines, Chantilly
oder Blonden durcheinander zu einer Toilette
zusammengenäht werden, womöglich eine Sorte
weiß, die Andere gelb, die dritte schwarz.
Nicht genug an dem, werden noch große,
zartpastellfarbig chinirte Blnmcnbouquets ans
seidenen Stoffen herausgeschnittcn und über
die Spitzen genäht, große Blnmenmnstcr ans
Spitzen, Chenille, perlen und Flittern auf Tüll-
klcidern gestickt, und jede Handbreit etwa vor-
handenen festen Stoffes mit dichtgefälteten,
glatten oder krausen Säumchen völlig bedeckt,
hunderttausende von Steppstichen an einem
Kleide, an den Spitzen selbst die Muster durch
Nachnähen mit Seidenbändchen verstärkt, um
so jeden (Yuadratcentimeter des kostbarsten
Materials durch unsagbare Mühe und trans-
parentes Uebereinanderlegeu noch kostbarer zu
machen.
Dabei ist alles von eintagsfliegenhafter, duf-
tigster Leichtvergänglichkeit, weiß, Rosa, Hell-
blan, ein Lila, das in einer Stunde Sonnen-
schein verblichen ist, lauter Farben und Sachen,
die sonst nur in den Ballsaal gehörten, sind
für den täglichen Straßengebrauch nicht nur
üblich, sondern unerläßlich geworden. Es soll
ein grandioser Lultus des Weibes damit aus-
gedrückt werden, wie er noch nie stattgehabt
hat, der Gedanke, daß nichts kostbar genug
ist, um den weiblichen Körper zu bedecken.
Die schillernde, bunte Schlaugcuhaut, untcr
der sich die gleitende, wellenförmig bewegte
Gliederung des Reptils durchsehen läßt, ist
der symbolistische Grundgedanke. Deshalb schei-
terten auch alle versuche, andere Schnittweisen
zu bringen; weder die Panniers des Rococo,
4?o