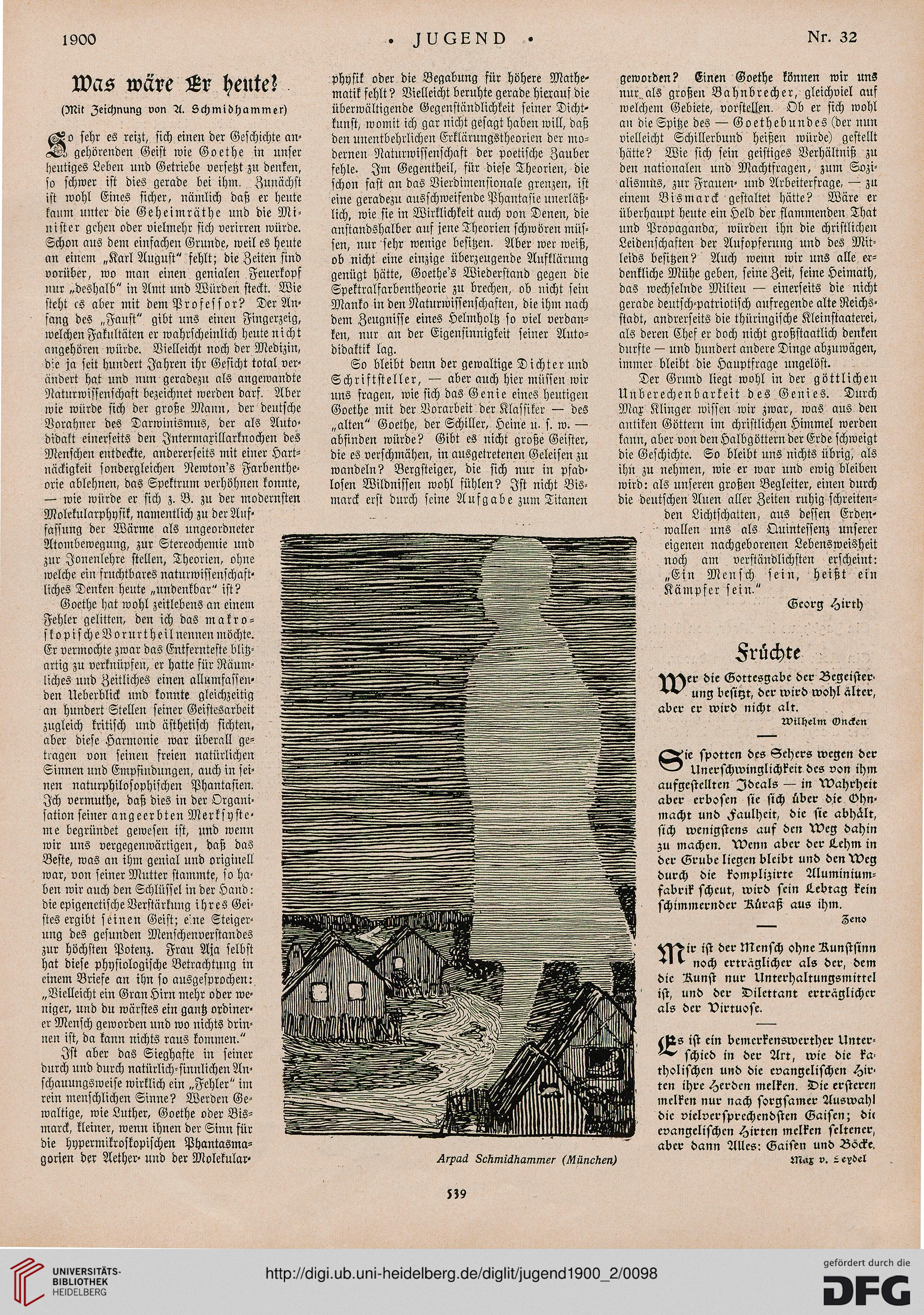1900
JUGEND
Nr. 32
was wäre Er heute!
(Mit Zeichnung von A. Schmidhammer)
Eo sehr es reizt, sich einen der Geschichte an-
sM gehörenden Geist wie Goethe in unser
heutiges Leben und Getriebe verseht zn denken,
so schwer ist dies gerade bei ihm. Zunächst
ist wohl Eines sicher, nämlich daß er heute
kaum unter die Geheimräthe und die Mi-
nister gehen oder vielmehr sich verirren würde.
Schon aus dem einfachen Grunde, weil es heute
an einem „Karl August" fehlt; die Zeiten sind
vorüber, wo man einen. genialen .Feuerkopf
nur „deshalb" in Anit und Würden steckt. Wie
steht cs aber mit dem Professor? Der An-
fang des „Faust" gibt uns einen Fingerzeig,
welchen Fakultäten er wahrscheinlich heute nicht
angehören würde. Vielleicht noch der Medizin,
die ja seit hundert Jahren ihr Gesicht total ver-
ändert hat und nun geradezu als angewandte
Naturwissenschaft bezeichnet werden darf. Aber
wie würde sich der große Mann, der deutsche
Vorahner des Darwinismus, der als Auto-
didakt einerseits den Intermaxillarknochen des
Menschen entdeckte, andererseits mit einer Hart-
näckigkeit sondergleichen Newton's Farbenthe-
orie ablehnen, das Spektrum verhöhnen konnte,
— wie würde er sich z. B. zu der modernsten
Molekularphysik, namentlich zu der Auf-
fassung der Wärme als ungeordneter
Utombewegung, zur Stercochemie und
zur Jonenlehre stellen, Theorien, ohne
welche ein fruchtbares naturwissenschaft-
liches Denken heute „undenkbar" ist?
Goethe hat wohl zeitlebens an einem
Fehler gelitten, den ich das makro-
s k o p i s ch e V o rurt h e il nennen möchte.
Er vermochte zwar das Entfernteste blitz-
artig zu verknüpfen, er hatte für Räum-
liches und Zeitliches einen allunifassen-
den Ueberblick und konnte gleichzeitig
an hundert Stellen seiner Geistesarbeit
zugleich kritisch und ästhetisch sichten,
aber diese Harmonie war überall ge-
tragen von seinen freien natürlichen
Sinnen und Empfindungen, auch in sei-
nen naturphilosophischen Phantasien.
Ich vcrmuthe, daß dies in der Organi-
sation seiner angeerbten Merksyste-
me begründet gewesen ist, und wenn
wir uns vergegenwärtigen, daß das
Beste, was an ihm genial und originell
war, von seiner Mutter stammte, so ha-
ben wir auch den Schlüssel in der Hand:
die epigenetische Verstärkung ihres Gei-
stes ergibt seinen Geist; eine Steiger-
ung des gesunden Menschenverstandes
zur höchsten Potenz. Frau Aja selbst
hat diese physiologische Betrachtung in
einem Briefe an ihn so ausgesprochen:
„Vielleicht ein Gran Hirn mehr oder we-
niger, und du wärstes ein gantz ordiner-
er Mensch geworden und wo nichts drin-
nen ist, da kann nichts raus kommen."
Ist aber das Sieghafte in seiner
durch und durch natürlich-sinnlichen An-
schauungsweise wirklich ein „Fehler" im
rein menschlichen Sinne? Werden Ge-
waltige, wie Luther, Goethe oder Bis-
marck, kleiner, wenn ihnen der Sinn für
die hypermikroskopischen Phantasma-
gorien der Aether- und der Molekular-
physik oder die Begabung für höhere Mathe-
matik fehlt? Vielleicht beruhte gerade hierauf die
überwältigende Gegenständlichkeit seiner Dicht-
kunst, womit ich gar nicht gesagt haben will, daß
den unentbehrlichen Erklärungstheorien der mo-
dernen Naturwissenschaft der poetische Zauber
fehle. Im Gegentheil, für diese Theorien, die
schon fast an das Vierdimensionale grenzen, ist
eine geradezu ausschweifende Phantasie unerläß-
lich, wie sie in Wirklichkeit auch von Denen, die
anstandshalber ans jene Theorien schwören müs-
sen, nur sehr wenige besitzen. Aber wer weiß,
ob nicht eine einzige überzeugende Aufklärung
genügt hätte, Goethe's Wiederstand gegen die
Spektralfarbentheorie zu brechen, ob nicht sein
Manko in den Naturwissenschaften, die ihm nach
dem Zeugnisse eines Helmholtz so viel verdan-
ken, nur an der Eigensinnigkeit seiner Auto-
didaktik lag.
So bleibt denn der gewaltige Dichter und
Schriftsteller, — aber auch hier müssen wir
uns fragen, wie sich das Genie eines heutigen
Goethe mit der Vorarbeit der Klassiker — des
„alten" Goethe, der Schiller, Heine u. s. w. —
abfinden würde? Gibt es nicht große Geister,
die es verschmähen, in ausgetretenen Geleisen zu
wandeln? Bergsteiger, die sich nur in pfad-
losen Wildnissen wohl fühlen? Ist nicht Bis-
marck erst durch seine Aufgabe zum Titanen
geworden? Einen Goethe können wir un?
nur als großen Bahnbrecher, gleichviel auf
welchem Gebiete, vorstechen. Ob er sich wohl
an die Spitze des — Goethebundes (der nun
vielleicht Schillerbund heißen würde) gestellt
hätte? Wie sich sein geistiges Verhältniß zu
den nationalen und Machtfragen, zum Sozi-
alismüs, zur Frauen- und Arbeiterfrage, — zu
einem Bismarck gestaltet hätte? Wäre er
überhaupt heute ein Held der flammenden That
und Propaganda, würden ihn die christlichen
Leidenschaften der Aufopferung und des Mit-
leids besitzen? Auch wenn wir uns alle er-
denkliche Mühe geben, seine Zeit, seine Heimath,
das wechselnde Milieu — einerseits die nicht
gerade deutsch-patriotisch aufregende alte Reichs-
stadt, andrerseits die thüringische Kleinstaaterei,
als deren Chef er doch nicht großstaatlich denken
durfte — und hundert andere Dinge abzuwägen,
immer bleibt die Hauptfrage ungelöst.
Der Grund liegt wohl in der göttlichen
Unberechenbarkeit des Genies. Durch
Max Klinger wissen wir zwar, was aus den
antiken Göttern im christlichen Himmel werden
kann, aber von den Halbgöttern der Erde schweigt
die Geschichte. So bleibt uns nichts übrig, als
ihn zu nehmen, wie er war und ewig bleiben
wird: als unseren großen Begleiter, einen durch
die deutschen Auen aller Zeiten ruhig schreiten-
den Lichtschatten, aus dessen Erden-
wallen uns als Quintessenz unserer
eigenen nachgeborenen Lebensweisheit
noch am verständlichsten erscheint:
„Ein Mensch sein, heißt ein
Kämpfer sein."
Georg Hirth
Früchte
Arpad Schmidhammer (München)
VY\er die Gorresgabc der Begcistee-
ung besitzt, der wird wohl älter,
aber er wird nicht alt.
Wilhelm ©tiden
spotten des Sehers wegen der
Unerschwinglichkeit des von ihm
ausgestellten Ideals — in Wahrheit
aber erbosen sie sich über die Ohn-
macht und Faulheit, die sie abhält,
sich wenigstens «uf den weg dahin
zu machen, wenn aber der Lehm in
der Grube liegen bleibt und den weg
durch die komplizirte Aluminium-
fabrik scheut, wird sein Lebtag kein
schimmernder Lüraß aus ihm.
Zeno
mir ist der Mensch ohne Kunstsinn
noch erträglicher als der, dem
die Runst nur Unterhaltungsmittel
ist, und der Dilettant erträglicher
als der Virtuose.
ssLs ist ein bcmcrkenswcrther Unter-
^ schied in der Art, wie die ka-
tholischen und die evangelischen Hir-
ten ihre Herden melken. Die erstcrcn
melken nur nach sorgsamer Auswahl
die vielversprechendsten Gaise»; dil
evangelischen Hirten melken seltener,
aber dann Alles: Gaisen und Böcke.
Max v. Lexd-l
539
JUGEND
Nr. 32
was wäre Er heute!
(Mit Zeichnung von A. Schmidhammer)
Eo sehr es reizt, sich einen der Geschichte an-
sM gehörenden Geist wie Goethe in unser
heutiges Leben und Getriebe verseht zn denken,
so schwer ist dies gerade bei ihm. Zunächst
ist wohl Eines sicher, nämlich daß er heute
kaum unter die Geheimräthe und die Mi-
nister gehen oder vielmehr sich verirren würde.
Schon aus dem einfachen Grunde, weil es heute
an einem „Karl August" fehlt; die Zeiten sind
vorüber, wo man einen. genialen .Feuerkopf
nur „deshalb" in Anit und Würden steckt. Wie
steht cs aber mit dem Professor? Der An-
fang des „Faust" gibt uns einen Fingerzeig,
welchen Fakultäten er wahrscheinlich heute nicht
angehören würde. Vielleicht noch der Medizin,
die ja seit hundert Jahren ihr Gesicht total ver-
ändert hat und nun geradezu als angewandte
Naturwissenschaft bezeichnet werden darf. Aber
wie würde sich der große Mann, der deutsche
Vorahner des Darwinismus, der als Auto-
didakt einerseits den Intermaxillarknochen des
Menschen entdeckte, andererseits mit einer Hart-
näckigkeit sondergleichen Newton's Farbenthe-
orie ablehnen, das Spektrum verhöhnen konnte,
— wie würde er sich z. B. zu der modernsten
Molekularphysik, namentlich zu der Auf-
fassung der Wärme als ungeordneter
Utombewegung, zur Stercochemie und
zur Jonenlehre stellen, Theorien, ohne
welche ein fruchtbares naturwissenschaft-
liches Denken heute „undenkbar" ist?
Goethe hat wohl zeitlebens an einem
Fehler gelitten, den ich das makro-
s k o p i s ch e V o rurt h e il nennen möchte.
Er vermochte zwar das Entfernteste blitz-
artig zu verknüpfen, er hatte für Räum-
liches und Zeitliches einen allunifassen-
den Ueberblick und konnte gleichzeitig
an hundert Stellen seiner Geistesarbeit
zugleich kritisch und ästhetisch sichten,
aber diese Harmonie war überall ge-
tragen von seinen freien natürlichen
Sinnen und Empfindungen, auch in sei-
nen naturphilosophischen Phantasien.
Ich vcrmuthe, daß dies in der Organi-
sation seiner angeerbten Merksyste-
me begründet gewesen ist, und wenn
wir uns vergegenwärtigen, daß das
Beste, was an ihm genial und originell
war, von seiner Mutter stammte, so ha-
ben wir auch den Schlüssel in der Hand:
die epigenetische Verstärkung ihres Gei-
stes ergibt seinen Geist; eine Steiger-
ung des gesunden Menschenverstandes
zur höchsten Potenz. Frau Aja selbst
hat diese physiologische Betrachtung in
einem Briefe an ihn so ausgesprochen:
„Vielleicht ein Gran Hirn mehr oder we-
niger, und du wärstes ein gantz ordiner-
er Mensch geworden und wo nichts drin-
nen ist, da kann nichts raus kommen."
Ist aber das Sieghafte in seiner
durch und durch natürlich-sinnlichen An-
schauungsweise wirklich ein „Fehler" im
rein menschlichen Sinne? Werden Ge-
waltige, wie Luther, Goethe oder Bis-
marck, kleiner, wenn ihnen der Sinn für
die hypermikroskopischen Phantasma-
gorien der Aether- und der Molekular-
physik oder die Begabung für höhere Mathe-
matik fehlt? Vielleicht beruhte gerade hierauf die
überwältigende Gegenständlichkeit seiner Dicht-
kunst, womit ich gar nicht gesagt haben will, daß
den unentbehrlichen Erklärungstheorien der mo-
dernen Naturwissenschaft der poetische Zauber
fehle. Im Gegentheil, für diese Theorien, die
schon fast an das Vierdimensionale grenzen, ist
eine geradezu ausschweifende Phantasie unerläß-
lich, wie sie in Wirklichkeit auch von Denen, die
anstandshalber ans jene Theorien schwören müs-
sen, nur sehr wenige besitzen. Aber wer weiß,
ob nicht eine einzige überzeugende Aufklärung
genügt hätte, Goethe's Wiederstand gegen die
Spektralfarbentheorie zu brechen, ob nicht sein
Manko in den Naturwissenschaften, die ihm nach
dem Zeugnisse eines Helmholtz so viel verdan-
ken, nur an der Eigensinnigkeit seiner Auto-
didaktik lag.
So bleibt denn der gewaltige Dichter und
Schriftsteller, — aber auch hier müssen wir
uns fragen, wie sich das Genie eines heutigen
Goethe mit der Vorarbeit der Klassiker — des
„alten" Goethe, der Schiller, Heine u. s. w. —
abfinden würde? Gibt es nicht große Geister,
die es verschmähen, in ausgetretenen Geleisen zu
wandeln? Bergsteiger, die sich nur in pfad-
losen Wildnissen wohl fühlen? Ist nicht Bis-
marck erst durch seine Aufgabe zum Titanen
geworden? Einen Goethe können wir un?
nur als großen Bahnbrecher, gleichviel auf
welchem Gebiete, vorstechen. Ob er sich wohl
an die Spitze des — Goethebundes (der nun
vielleicht Schillerbund heißen würde) gestellt
hätte? Wie sich sein geistiges Verhältniß zu
den nationalen und Machtfragen, zum Sozi-
alismüs, zur Frauen- und Arbeiterfrage, — zu
einem Bismarck gestaltet hätte? Wäre er
überhaupt heute ein Held der flammenden That
und Propaganda, würden ihn die christlichen
Leidenschaften der Aufopferung und des Mit-
leids besitzen? Auch wenn wir uns alle er-
denkliche Mühe geben, seine Zeit, seine Heimath,
das wechselnde Milieu — einerseits die nicht
gerade deutsch-patriotisch aufregende alte Reichs-
stadt, andrerseits die thüringische Kleinstaaterei,
als deren Chef er doch nicht großstaatlich denken
durfte — und hundert andere Dinge abzuwägen,
immer bleibt die Hauptfrage ungelöst.
Der Grund liegt wohl in der göttlichen
Unberechenbarkeit des Genies. Durch
Max Klinger wissen wir zwar, was aus den
antiken Göttern im christlichen Himmel werden
kann, aber von den Halbgöttern der Erde schweigt
die Geschichte. So bleibt uns nichts übrig, als
ihn zu nehmen, wie er war und ewig bleiben
wird: als unseren großen Begleiter, einen durch
die deutschen Auen aller Zeiten ruhig schreiten-
den Lichtschatten, aus dessen Erden-
wallen uns als Quintessenz unserer
eigenen nachgeborenen Lebensweisheit
noch am verständlichsten erscheint:
„Ein Mensch sein, heißt ein
Kämpfer sein."
Georg Hirth
Früchte
Arpad Schmidhammer (München)
VY\er die Gorresgabc der Begcistee-
ung besitzt, der wird wohl älter,
aber er wird nicht alt.
Wilhelm ©tiden
spotten des Sehers wegen der
Unerschwinglichkeit des von ihm
ausgestellten Ideals — in Wahrheit
aber erbosen sie sich über die Ohn-
macht und Faulheit, die sie abhält,
sich wenigstens «uf den weg dahin
zu machen, wenn aber der Lehm in
der Grube liegen bleibt und den weg
durch die komplizirte Aluminium-
fabrik scheut, wird sein Lebtag kein
schimmernder Lüraß aus ihm.
Zeno
mir ist der Mensch ohne Kunstsinn
noch erträglicher als der, dem
die Runst nur Unterhaltungsmittel
ist, und der Dilettant erträglicher
als der Virtuose.
ssLs ist ein bcmcrkenswcrther Unter-
^ schied in der Art, wie die ka-
tholischen und die evangelischen Hir-
ten ihre Herden melken. Die erstcrcn
melken nur nach sorgsamer Auswahl
die vielversprechendsten Gaise»; dil
evangelischen Hirten melken seltener,
aber dann Alles: Gaisen und Böcke.
Max v. Lexd-l
539