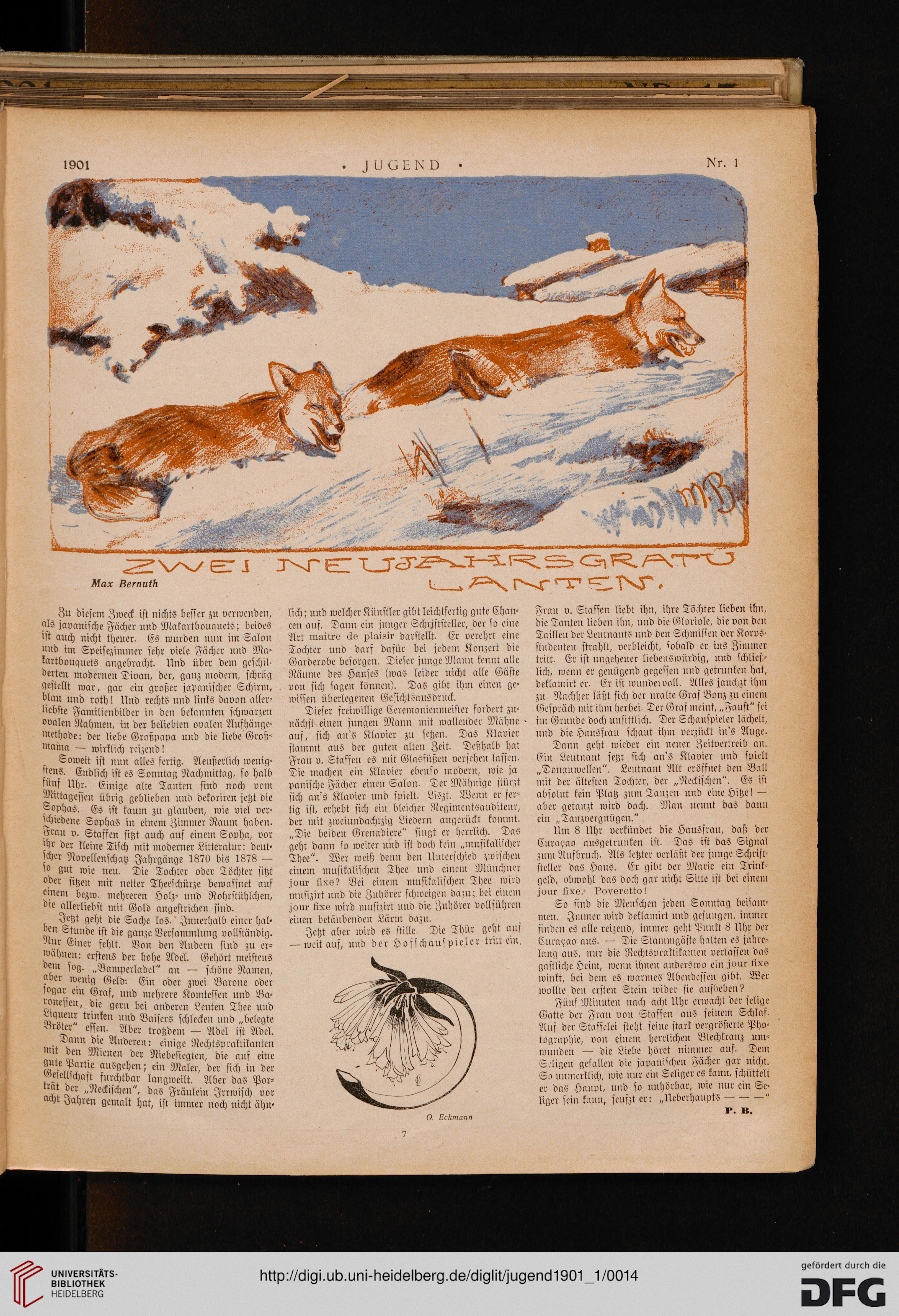1901 • JUGEND Nr. 1
8u diesem Zweck ist nichts besser zu verwenden
als japanische Fächer und Makartbougucts; beide,
ist auch nicht theuer. Es wurden nun im ^aloi
»nd im Speisezimmer sehr viele Fächer und Ma
kartbouquets angebracht. Und über dem gcschil
derten modernen Divan, der, ganz modern, schräg
gestellt war, gar ein großer japanischer Schirm
blau und roth! Und rechts und links davon aller
liebste Familienbildcr in den bekannten schwarzei
ovalen Rahmen, in der beliebten ovalen Aushänge
Methode: der liebe Großpapa und die liebe Groß
Mama — wirklich reizend I
Soweit ist nun alles fertig. Aeußerlich wenig
itens. Endlich ist es Sonntag Nachmittag, so hall
fünf Uhr. Einige alte Tanten sind noch von
Mittagessen übrig geblieben und dckorircn jetzt di,
Sophas. Es ist kaum zu glauben, wie viel ver
ichiedene Sophas in einem Zimmer Raum haben
Frau v. Staffen sitzt auch auf einem Sopha, vo:
ihr der kleine Tisch mit moderner Litteratur: dcnt
lcher Novellenschatz Jahrgänge 1870 bis 1878 —
so gut wie neu. Die Tochter oder Töchter sitz
oder sitzen mit netter Theeschürze bewaffnet au
einem bezw. mehreren Holz- und Rohrstühlchen
die allerliebst mit Gold angestrichen sind.
Jetzt geht die Sache los.' Innerhalb einer Hai
ben Stunde ist die ganze Versammlung vollständig
Oiur Einer fehlt. Von den Andern sind zu er-
wähnen: erstens der hohe Adel. Gehört meisten«
dem sog. „Bamperladel" an — schöne Namen
aber wenig Geld-. Ein oder zwei Barone obci
logar ein Graf, und mehrere Komtessen und Ba-
ronessen, die gern bei anderen Leuten Thcc unl
Liqueur trinken und Baisers schlecken und „belegt,
Brüter" essen. Aber trotzdem — Adel ist Adel
Dann die Anderen: einige Rechtspraktikantei
mit den Mienen der Riebesicgtcn, die auf ein,
gute Partie ausgchen; ein Maler, der sich in de,
Gesellschaft furchtbar langweilt. Aber das Por
* »Neckischen", das Fräulein Irrwisch vo,
acht Jahren gemalt hat, ist immer noch nicht ähn
lieh; und welcher Künstler gibt leichtfertig gute Chan-
cen auf. Dann ein junger Schriftsteller, der so eine
Art inaitrs de plaisir darstellt. Er verehrt eine
Tochter und darf dafür bei jedem Konzert die
Garderobe besorgen. Dieser junge Mann kennt alle
Räume des Hauses (was leider nicht alle Gäste
von sich sagen können). Das gibt ihm einen ge-
wissen überlegenen GefichtSausdruck.
Dieser freiwillige Ceremonienmeister fordert zu-
nächst einen jungen Mann mit wallender Mahne
auf, sich an's Klavier zu setzen. Das Klavier
stammt aus der guten allen Zeit. Deßhalb hat
Frau v. Staffen es mit Glasfüßen versehen lassen.
Die machen ein Klavier ebenso modern, wie ja
panische Fächer einen Salon. Der Mähnige stürzt
sich an's Klavier und spielt. Liszt. Wenn er fer-
tig ist, erhebt sich ein bleicher RcgimcntSauditcur,
der mit zweiundachtzig Liedern angcrückt kommt.
„Die beiden Grenadiere" singt er herrlich. Das
geht dann so weiter und ist doch kein „musikalischer
Thee". Wer weiß denn den Unterschied zwischen
einem musikalischen Thee und einem Münchner
jour fixe? Bei einem musikalischen Thee wird
musizirt und die Zuhörer schweigen dazu; bei einem
jour fixe wird musizirt und die Zuhörer vollführen
einen betäubenden Lärm dazu.
Jetzt aber wird es stille. Die Thür geht auf
— weitaus, und der Hofschauspieler tritt ein.
Frau v. Staffen liebt ihn, ihre Töchter lieben ihn,
die Tanten lieben ihn, »nd die Gloriole, die von den
Taillen der Leutnants und den Schmissen der Korps-
studenten strahlt, verbleicht, sobald er ins Zimmer
tritt. Er ist ungeheuer liebenswürdig, und schließ-
lich, wenn er genügend gegessen und getrunken hat,
deklamirt er. Er ist wundervoll. Alles jauchzt ihm
zu Nachher läßt sich der uralte Graf Bonz zu einem
Gespräch mit ihm herbei. Ter Graf meint, „Faust" sei
im Grunde doch unsittlich. Der Schauspieler lächelt,
und die Hausfrau schaut ihm verzückt in's Auge.
Dann geht wieder ein neuer Zeitvertreib an.
Ein Leutnant setzt sich an's Klavier und spielt
„Douauwellen". Leutnant Alt eröffnet den Ball
mit der ältesten Tochter, der „Neckischen". Es ist
absolut kein Platz zum Tanzen und eine Hitze! —
aber getanzt wird doch. Man nennt das dann
ein „Tanzvergnügen."
Ilm 8 Uhr verkündet die Hausfrau, daß der
Curasao ansgetrunken ist. Das ist das Signal
zum Aufbruch. Als letzter verläßt der jitnge Schrift-
steller das Hans. Er gibt der Marie ein Trink-
geld, obwohl das doch gar nicht Sitte ist bei einem
jour fixe.' Poveretto!
So sind die Menschen jeden Sonntag beisam-
men. Immer wird deklamirt und gesungen, immer
finden cs alle reizend, immer geht Punkt 8 Uhr der
Curatzao aus. — Die Stammgäste halten e-° jahre-
lang ans, nur die Rechtspraktikanten verlasse» das
gastliche Heim, wenn ihnen anderswo ein jour fixe
winkt, bei dem es warmes Abendessen gibt. Wer
wolltc den ersten Stein wider sie aufbeben?
Fünf Minuten nach acht Uhr erwacht der selige
Gatte der Frau von Staffen aus seinem Schlaf.
Auf der Staffelei steht seine stark vergrößerte Pho-
tographie, von einem herrlichen Blechkranz um-
wunden — die Liebe höret nimmer auf. Dem
Seligen gefallen die japanischen Fächer gar nicht.
So »»merklich, wie nur ein Seligeres kann, schüttelt
er das Haupt, und so unhörbar, wie nur ein Se-
liger sein kann, seufzt er: „Ueberhaupts-"
i*. ii.
7
8u diesem Zweck ist nichts besser zu verwenden
als japanische Fächer und Makartbougucts; beide,
ist auch nicht theuer. Es wurden nun im ^aloi
»nd im Speisezimmer sehr viele Fächer und Ma
kartbouquets angebracht. Und über dem gcschil
derten modernen Divan, der, ganz modern, schräg
gestellt war, gar ein großer japanischer Schirm
blau und roth! Und rechts und links davon aller
liebste Familienbildcr in den bekannten schwarzei
ovalen Rahmen, in der beliebten ovalen Aushänge
Methode: der liebe Großpapa und die liebe Groß
Mama — wirklich reizend I
Soweit ist nun alles fertig. Aeußerlich wenig
itens. Endlich ist es Sonntag Nachmittag, so hall
fünf Uhr. Einige alte Tanten sind noch von
Mittagessen übrig geblieben und dckorircn jetzt di,
Sophas. Es ist kaum zu glauben, wie viel ver
ichiedene Sophas in einem Zimmer Raum haben
Frau v. Staffen sitzt auch auf einem Sopha, vo:
ihr der kleine Tisch mit moderner Litteratur: dcnt
lcher Novellenschatz Jahrgänge 1870 bis 1878 —
so gut wie neu. Die Tochter oder Töchter sitz
oder sitzen mit netter Theeschürze bewaffnet au
einem bezw. mehreren Holz- und Rohrstühlchen
die allerliebst mit Gold angestrichen sind.
Jetzt geht die Sache los.' Innerhalb einer Hai
ben Stunde ist die ganze Versammlung vollständig
Oiur Einer fehlt. Von den Andern sind zu er-
wähnen: erstens der hohe Adel. Gehört meisten«
dem sog. „Bamperladel" an — schöne Namen
aber wenig Geld-. Ein oder zwei Barone obci
logar ein Graf, und mehrere Komtessen und Ba-
ronessen, die gern bei anderen Leuten Thcc unl
Liqueur trinken und Baisers schlecken und „belegt,
Brüter" essen. Aber trotzdem — Adel ist Adel
Dann die Anderen: einige Rechtspraktikantei
mit den Mienen der Riebesicgtcn, die auf ein,
gute Partie ausgchen; ein Maler, der sich in de,
Gesellschaft furchtbar langweilt. Aber das Por
* »Neckischen", das Fräulein Irrwisch vo,
acht Jahren gemalt hat, ist immer noch nicht ähn
lieh; und welcher Künstler gibt leichtfertig gute Chan-
cen auf. Dann ein junger Schriftsteller, der so eine
Art inaitrs de plaisir darstellt. Er verehrt eine
Tochter und darf dafür bei jedem Konzert die
Garderobe besorgen. Dieser junge Mann kennt alle
Räume des Hauses (was leider nicht alle Gäste
von sich sagen können). Das gibt ihm einen ge-
wissen überlegenen GefichtSausdruck.
Dieser freiwillige Ceremonienmeister fordert zu-
nächst einen jungen Mann mit wallender Mahne
auf, sich an's Klavier zu setzen. Das Klavier
stammt aus der guten allen Zeit. Deßhalb hat
Frau v. Staffen es mit Glasfüßen versehen lassen.
Die machen ein Klavier ebenso modern, wie ja
panische Fächer einen Salon. Der Mähnige stürzt
sich an's Klavier und spielt. Liszt. Wenn er fer-
tig ist, erhebt sich ein bleicher RcgimcntSauditcur,
der mit zweiundachtzig Liedern angcrückt kommt.
„Die beiden Grenadiere" singt er herrlich. Das
geht dann so weiter und ist doch kein „musikalischer
Thee". Wer weiß denn den Unterschied zwischen
einem musikalischen Thee und einem Münchner
jour fixe? Bei einem musikalischen Thee wird
musizirt und die Zuhörer schweigen dazu; bei einem
jour fixe wird musizirt und die Zuhörer vollführen
einen betäubenden Lärm dazu.
Jetzt aber wird es stille. Die Thür geht auf
— weitaus, und der Hofschauspieler tritt ein.
Frau v. Staffen liebt ihn, ihre Töchter lieben ihn,
die Tanten lieben ihn, »nd die Gloriole, die von den
Taillen der Leutnants und den Schmissen der Korps-
studenten strahlt, verbleicht, sobald er ins Zimmer
tritt. Er ist ungeheuer liebenswürdig, und schließ-
lich, wenn er genügend gegessen und getrunken hat,
deklamirt er. Er ist wundervoll. Alles jauchzt ihm
zu Nachher läßt sich der uralte Graf Bonz zu einem
Gespräch mit ihm herbei. Ter Graf meint, „Faust" sei
im Grunde doch unsittlich. Der Schauspieler lächelt,
und die Hausfrau schaut ihm verzückt in's Auge.
Dann geht wieder ein neuer Zeitvertreib an.
Ein Leutnant setzt sich an's Klavier und spielt
„Douauwellen". Leutnant Alt eröffnet den Ball
mit der ältesten Tochter, der „Neckischen". Es ist
absolut kein Platz zum Tanzen und eine Hitze! —
aber getanzt wird doch. Man nennt das dann
ein „Tanzvergnügen."
Ilm 8 Uhr verkündet die Hausfrau, daß der
Curasao ansgetrunken ist. Das ist das Signal
zum Aufbruch. Als letzter verläßt der jitnge Schrift-
steller das Hans. Er gibt der Marie ein Trink-
geld, obwohl das doch gar nicht Sitte ist bei einem
jour fixe.' Poveretto!
So sind die Menschen jeden Sonntag beisam-
men. Immer wird deklamirt und gesungen, immer
finden cs alle reizend, immer geht Punkt 8 Uhr der
Curatzao aus. — Die Stammgäste halten e-° jahre-
lang ans, nur die Rechtspraktikanten verlasse» das
gastliche Heim, wenn ihnen anderswo ein jour fixe
winkt, bei dem es warmes Abendessen gibt. Wer
wolltc den ersten Stein wider sie aufbeben?
Fünf Minuten nach acht Uhr erwacht der selige
Gatte der Frau von Staffen aus seinem Schlaf.
Auf der Staffelei steht seine stark vergrößerte Pho-
tographie, von einem herrlichen Blechkranz um-
wunden — die Liebe höret nimmer auf. Dem
Seligen gefallen die japanischen Fächer gar nicht.
So »»merklich, wie nur ein Seligeres kann, schüttelt
er das Haupt, und so unhörbar, wie nur ein Se-
liger sein kann, seufzt er: „Ueberhaupts-"
i*. ii.
7