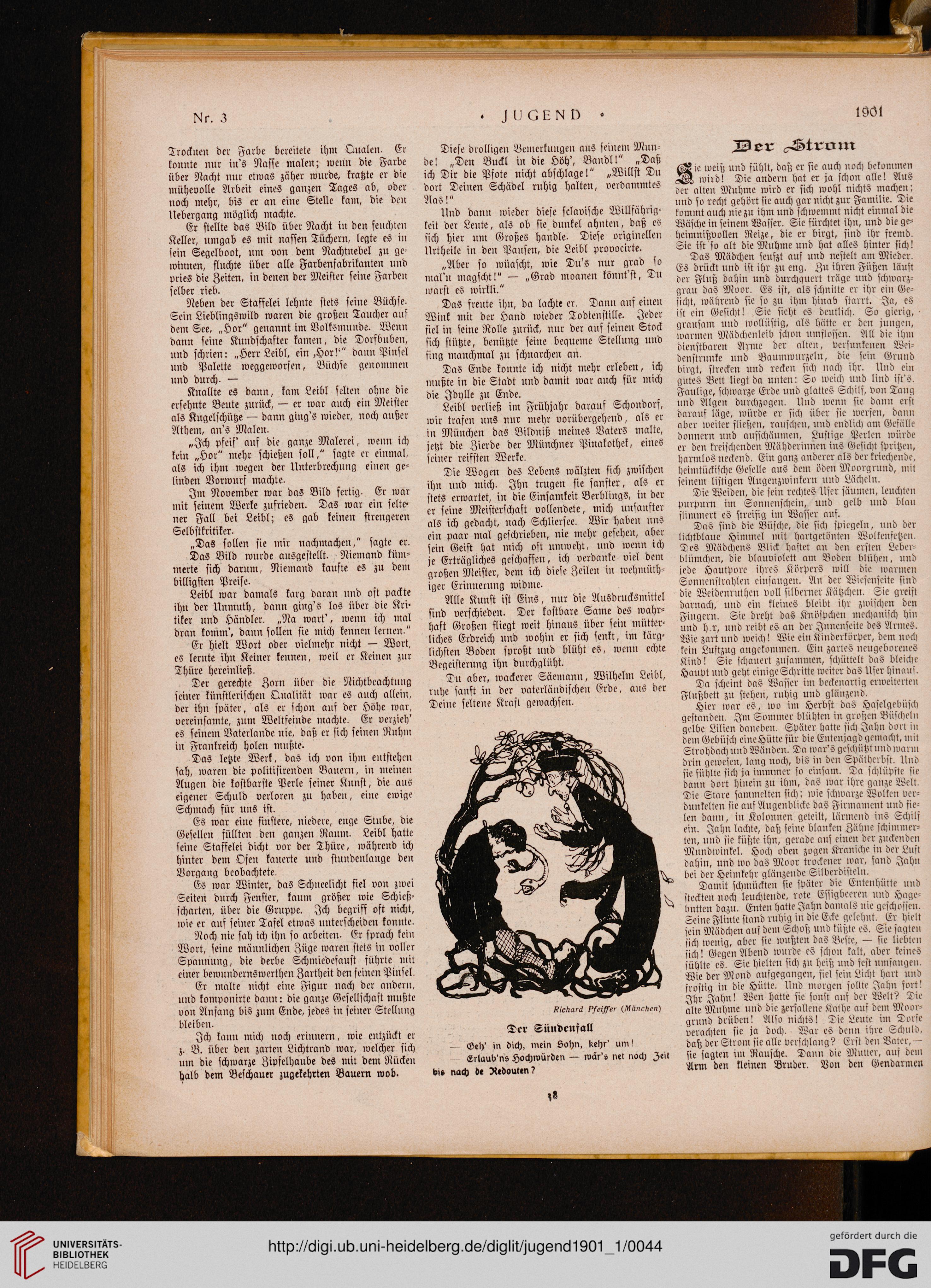Nr. Z
. JUGEND
19Ö1
Trocknen der Farbe bereitete ihm Qualen. Er
konnte nur ins Nasse malen; wenn die Farbe
über Nacht nur etwas zäher wurde, kratzte er die
mühevolle Arbeit eines ganzen Tages ab, oder
noch mehr, bis er an eine Stelle kam, die den
Uebergang möglich machte.
Er stellte das Bild über Nacht in den feuchten
Keller, umgab es mit nassen Tüchern, legte es in
sein Segelboot, um von dem Nachtnebel zu ge-
winnen, fluchte über alle Farbenfabrikanten und
pries die Zeiten, in denen der Meister seine Farben
selber rieb.
Neben der Staffelei lehnte stets seine Büchse.
Sein Lieblingswild waren die großen Taucher ans
dem See, „Hör" genannt im Volksmunde. Wenn
dann seine Kundschafter kamen, die Dorfbuben,
und schrien: „Herr Leibl, ein ,Hör!'" dann Pinsel
und Palette weggeworfen, Büchse genommen
und durch. —
Knallte es dann, kam Leibl selten ohne die
ersehnte Beute zurück, — er war auch ein Meister
als Kugelschütze — dann ging's wieder, noch außer
Athem, an's Malen.
„Ich pfeif' ans die ganze Malerei, wenn ich
kein „Hör" mehr schießen soll," sagte er einmal,
als ich ihm wegen der Unterbrechung einen ge-
linden Vorwurf machte.
Im November war das Bild fertig. Er war
mit seinem Werke zufrieden. Das war ein selte-
ner Fall bei Leibl; es gab keinen strengeren
Selbstkritiker.
„Das sollen sic mir nachmachen," sagte er.
Das Bild wurde ansgestellt. Niemand küm-
merte sich darum, Niemand kaufte es zu deni
billigsten Preise.
Leibl war damals karg daran und oft packte
ihn der Unmuth, dann ging's los über die Kri-
tiker und Händler. „Na wart', wenn ich mal
dran komm', dann sollen sie mich kennen lernen."
Er hielt Wort oder vielmehr nicht — Wort,
es lernte ihn Keiner kennen, weil er Keinen zur
Thüre hereinließ.
Der gerechte Zorn über die Nichtbeachtung
seiner künstlerischen Qualität war es auch allein,
der ihn später, als er schon auf der Höhe war,
vereinsamte, zum Weltfeinde machte. Er verzieh'
es seinem Vaterlande nie, daß er sich seinen Ruhm
in Frankreich holen mußte.
Das letzte Werk, das ich von ihm entstehen
sah, waren die politisirenden Bauern, in meinen
Augen die kostbarste Perle seiner Kunst, die aus
eigener Schuld verloren zu haben, eine ewige
Schmach für uns ist.
Es war eine finstere, niedere, enge Stube, die
Gesellen füllten den ganzen Raum. Leibl hatte
seine Staffelei dicht vor der Thüre, während ich
hinter dem Ofen kauerte und stundenlange den
Vorgang beobachtete.
Es war Winter, das Schncelicht siel von zwei
Seiten durch Fenster, kaum größer wie Schieß-
scharten, über die Gruppe. Ich begriff oft nicht,
wie er auf seiner Tafel etwas unterscheiden konnte.
Noch nie sah ich ihn so arbeiten- Er sprach kein
Wort, seine männlichen Züge waren stets in voller
Spannung, die derbe Schiniedefaust führte mit
einer bewundernswerthen Zartheit den feinen Pinsel.
Er malte nicht eine Figur nach der andern,
und komponirte dann: die ganze Gesellschaft mußte
von Anfang bis zum Ende, jedes in seiner Stellung
bleiben.
Ich kann mich noch erinnern, wie entzückt er
z. B. über den zarten Lichtrand war, welcher sich
um die schwarze Zipfelhaube des mit dem Rücken
halb dem Beschauer zugekehrten Bauern wob.
Diese drolligen Bemerkungen aus seinem Mun-
det „Den Buckl in die Höh', Bandit" „Daß
ich Dir die Pfote nicht abschlage I" „Willst Du
dort Deinen Schädel ruhig halten, verdammtes
Aas!"
Ilnd dann wieder diese sclavische Willfährig-
keit der Leute, als ob sie dunkel ahnten, daß es
sich hier um Großes handle. Diese originellen
Ilrtheile in den Pansen, die Leibl provocirte.
„Aber so wünscht, wie Du's nur grad so
mal'» magschtt" — „Grad moanen könnt'st, Du
warst es wirkli."
Das freute ihn, da lachte er. Dann auf einen
Wink mit der Hand wieder Todtenstille. Jeder
siel in seine Rolle zurück, nur der auf seinen Stock
sich stützte, benützte seine bequeme Stellung und
fing manchmal zu schnarchen an.
Das Ende konnte ich nicht mehr erleben, ich
mußte in die Stadt und damit war auch für mich
die Idylle zu Ende.
Leibl verließ im Frühjahr darauf Schondorf,
wir trafen uns nur mehr vorübergehend, als er
in München das Bildniß meines Vaters malte,
jetzt die Zierde der Münchner Pinakothek, eines
seiner reifsten Werke.
Die Wogen des Lebens wälzten sich zwischen
ihn und mich. Ihn trugen sie sanfter, als er
stets erwartet, in die Einsamkeit Berblings, in der
er seine Meisterschaft vollendete, mich unsanfter
als ich gedacht, nach Schlicrsee. Wir haben uns
ein paar mal geschrieben, nie mehr gesehen, aber
sein Geist hat mich oft umweht, und wenn ich
je Erträgliches geschaffen, ich verdanke viel dem
großen Meister, dem ich diese Zeilen in wehmüth-
iger Erinnerung widme.
Alle Kunst ist Eins, nur die Ausdrucksmittel
sind verschieden. Der kostbare Same des wahr-
haft Großen fliegt weit hinaus über sein mütter-
liches Erdreich und wohin er sich senkt, im kärg-
lichsten Boden sproßt und blüht es, wenn echte
Begeisterung ihn durchglüht.
Du aber, wackerer Säemann, Wilhelm Leibl,
ruhe sanft in der vaterländischen Erde, ans der
Deine seltene Kraft gewachsen.
Richard Pfeiffer (München)
Der Tündensall
Setz' in dich, mein Sohn, kehr' um!
Lrlaub'ns Hochwürden — wär's ne! noch Heit
di» nach de Redouten?
JBcv
fie weiß und fühlt, daß er sic auch noch bekommen
_, wird! Die andern hat er ja schon alle! Aus
der alten Muhme wird er sich wohl nichts machen;
und so recht gehört sie auch gar nicht zur Familie. Die
kommt auch nie zu ihm und schwemmt nicht einmal die
Wäsche in seinem Wasser. Sie ftirchtet ihn, und die ge-
heimnißvollen Reize, die er birgt, sind ihr fremd.
Sie ist so alt die Muhme und hat alles hinter sich!
Das Mädchen seufzt auf und nestelt am Mieder.
Es drückt und ist ihr zu eng. Zu ihren Füßen läuft
der Fluß dahin und durchquert träge und schwarz-
grau das Moor. Es ist, als schnitte er ihr ein Ge-
sicht, während sie so zu ihm hinab starrt. Ja, es
ist ein Gesicht! Sie sieht es deutlich. So gierig,
grausam und wollüstig, als hätte er den jungen,
warmen Mädchenleib schon umflossen. All die ihm
dienstbaren Arme der alten, versunkenen Wei-
denstrunke und Baumwurzeln, die sein Grund
birgt, strecken und recken sich nach ihr. Und ein
gutes Bett liegt da unten: Sv weich und lind ist's.
Faulige, schwarze Erde und glattes Schilf, von Taug
und Algen durchzogen. Und wenn sie dann erst
darauf läge, würde er sich über sie werfen, dann
aber lveiter fließen, rauschen, und endlich am Gefälle
donnern und ausschäumen, Lustige Perlen würde
er den kreischenden Mähderinnen ins Gesicht spritzen,
harmlos neckend. Ein ganz anderer als der kriechende,
heimtückische Geselle aus dem öden Moorgrund, mit
seinem listigen Augenzwinkern und Lächeln.
Die Weiden, die sein rechtes User säumen, leuchten
purpurn im Sonnenschein, und gelb und blau
flimmert es streifig im Wasser auf.
Das sind die Büsche, die sich spiegeln, und der
lichtblaue Himmel mit hartgetönten Wolkenfetzen.
Des Mädchens Blick hastet an den ersten Leber-
blümchen, die blauviolett am Boden blühen, und
jede Hautpore ihres Körpers will die warmen
Sonnenstrahlen einsaugen. An der Wiesenscite sind
die Weidenruthcn voll silberner Kätzchen. Sie greift
darnach, und ein kleines bleibt ihr zwischen den
Fingern. Sie dreht das Knöspchen mechanisch hin
und h.r, und reibt es an der Innenseite des Armes.
Wie zart und weich! Wie ein .Kinderkörper, dem noch
kein Lustzug angekommen. Ein zartes neugeborenes
Kind! Sie schauert zusammen, schüttelt das bleiche
Haupt und geht einigcSchritte weiter das User hinaus.
Da scheint das Wasser im beckenartig erweiterten
Flußbett zu stehen, ruhig und glänzend.
Hier war cs, wo im Herbst das Haselgebiisch
gestanden. Im Sommer blühten in großen Büscheln
gelbe Lilien daneben. Später hatte sich Jahn dort in
dem Gebüsch cineHütte sür die Entenjagd gemacht, mit
Strohdach und Wänden. Da war's geschützt und wann
drin gewesen, lang noch, bis in de» Spätherbst. Und
sie fühlte sich ja immmer so einsam. Da schlüpfte sie
dann dort hinein zu ihm, das war ihre ganze Welt.
Die Stare sammelten sich; wie schwarze Wolken ver-
dunkelten sie aus Augenblicke das Firmament und sie-
len dann, in Kolonnen geteilt, lärmend ins Schilf
ein. Jahn lachte, daß seine blanken Zähne schimmer-
ten, und sie küßte ihn, gerade aus einen der zuckende»
Mundwinkel. Hoch oben zogen Kraniche in der Lust
dahin, und wo das Moor trockener war, fand Jahn
bei der Heimkehr glänzende Silberdisteln.
Damit schmückten sie später die Entenhütte und
steckten »och leuchtende, rote Essigbeeren und Hage-
butten dazu. Enten hatte Jahn damals nie geschossen.
Seine Flinte stand ruhig in die Ecke gelehnt. Er hielt
sein Mädchen aus dem Schoß und küßte es. Sie sagten
sich wenig, aber sie wußten das Beste, — sie liebten
sich! Gegen Abend wurde es schon kalt, aber keines
fühlte cs. Sie hielten sich zu heiß und fest umfangen.
Wie der Mond aufgegangen, fiel sein Licht hart und
frostig in die Hütte. Und morgen sollte Jahn fort!
Ihr Jahn! Wen hatte sie sonst aus der Welt? Die
alte Muhme und die zerfallene Käthe auf dein Moor-
grund drüben! Also nichts! Die Leute im Dorfe
verachten sie ja doch. War cs denn ihre Schuld,
daß der Strom sie alle verschlang? Erst den Vater,—
sie sagten im Rausche. Dann die Mutter, aus dem
Arm den kleinen Bruder. Von den Gendarmen
1»
. JUGEND
19Ö1
Trocknen der Farbe bereitete ihm Qualen. Er
konnte nur ins Nasse malen; wenn die Farbe
über Nacht nur etwas zäher wurde, kratzte er die
mühevolle Arbeit eines ganzen Tages ab, oder
noch mehr, bis er an eine Stelle kam, die den
Uebergang möglich machte.
Er stellte das Bild über Nacht in den feuchten
Keller, umgab es mit nassen Tüchern, legte es in
sein Segelboot, um von dem Nachtnebel zu ge-
winnen, fluchte über alle Farbenfabrikanten und
pries die Zeiten, in denen der Meister seine Farben
selber rieb.
Neben der Staffelei lehnte stets seine Büchse.
Sein Lieblingswild waren die großen Taucher ans
dem See, „Hör" genannt im Volksmunde. Wenn
dann seine Kundschafter kamen, die Dorfbuben,
und schrien: „Herr Leibl, ein ,Hör!'" dann Pinsel
und Palette weggeworfen, Büchse genommen
und durch. —
Knallte es dann, kam Leibl selten ohne die
ersehnte Beute zurück, — er war auch ein Meister
als Kugelschütze — dann ging's wieder, noch außer
Athem, an's Malen.
„Ich pfeif' ans die ganze Malerei, wenn ich
kein „Hör" mehr schießen soll," sagte er einmal,
als ich ihm wegen der Unterbrechung einen ge-
linden Vorwurf machte.
Im November war das Bild fertig. Er war
mit seinem Werke zufrieden. Das war ein selte-
ner Fall bei Leibl; es gab keinen strengeren
Selbstkritiker.
„Das sollen sic mir nachmachen," sagte er.
Das Bild wurde ansgestellt. Niemand küm-
merte sich darum, Niemand kaufte es zu deni
billigsten Preise.
Leibl war damals karg daran und oft packte
ihn der Unmuth, dann ging's los über die Kri-
tiker und Händler. „Na wart', wenn ich mal
dran komm', dann sollen sie mich kennen lernen."
Er hielt Wort oder vielmehr nicht — Wort,
es lernte ihn Keiner kennen, weil er Keinen zur
Thüre hereinließ.
Der gerechte Zorn über die Nichtbeachtung
seiner künstlerischen Qualität war es auch allein,
der ihn später, als er schon auf der Höhe war,
vereinsamte, zum Weltfeinde machte. Er verzieh'
es seinem Vaterlande nie, daß er sich seinen Ruhm
in Frankreich holen mußte.
Das letzte Werk, das ich von ihm entstehen
sah, waren die politisirenden Bauern, in meinen
Augen die kostbarste Perle seiner Kunst, die aus
eigener Schuld verloren zu haben, eine ewige
Schmach für uns ist.
Es war eine finstere, niedere, enge Stube, die
Gesellen füllten den ganzen Raum. Leibl hatte
seine Staffelei dicht vor der Thüre, während ich
hinter dem Ofen kauerte und stundenlange den
Vorgang beobachtete.
Es war Winter, das Schncelicht siel von zwei
Seiten durch Fenster, kaum größer wie Schieß-
scharten, über die Gruppe. Ich begriff oft nicht,
wie er auf seiner Tafel etwas unterscheiden konnte.
Noch nie sah ich ihn so arbeiten- Er sprach kein
Wort, seine männlichen Züge waren stets in voller
Spannung, die derbe Schiniedefaust führte mit
einer bewundernswerthen Zartheit den feinen Pinsel.
Er malte nicht eine Figur nach der andern,
und komponirte dann: die ganze Gesellschaft mußte
von Anfang bis zum Ende, jedes in seiner Stellung
bleiben.
Ich kann mich noch erinnern, wie entzückt er
z. B. über den zarten Lichtrand war, welcher sich
um die schwarze Zipfelhaube des mit dem Rücken
halb dem Beschauer zugekehrten Bauern wob.
Diese drolligen Bemerkungen aus seinem Mun-
det „Den Buckl in die Höh', Bandit" „Daß
ich Dir die Pfote nicht abschlage I" „Willst Du
dort Deinen Schädel ruhig halten, verdammtes
Aas!"
Ilnd dann wieder diese sclavische Willfährig-
keit der Leute, als ob sie dunkel ahnten, daß es
sich hier um Großes handle. Diese originellen
Ilrtheile in den Pansen, die Leibl provocirte.
„Aber so wünscht, wie Du's nur grad so
mal'» magschtt" — „Grad moanen könnt'st, Du
warst es wirkli."
Das freute ihn, da lachte er. Dann auf einen
Wink mit der Hand wieder Todtenstille. Jeder
siel in seine Rolle zurück, nur der auf seinen Stock
sich stützte, benützte seine bequeme Stellung und
fing manchmal zu schnarchen an.
Das Ende konnte ich nicht mehr erleben, ich
mußte in die Stadt und damit war auch für mich
die Idylle zu Ende.
Leibl verließ im Frühjahr darauf Schondorf,
wir trafen uns nur mehr vorübergehend, als er
in München das Bildniß meines Vaters malte,
jetzt die Zierde der Münchner Pinakothek, eines
seiner reifsten Werke.
Die Wogen des Lebens wälzten sich zwischen
ihn und mich. Ihn trugen sie sanfter, als er
stets erwartet, in die Einsamkeit Berblings, in der
er seine Meisterschaft vollendete, mich unsanfter
als ich gedacht, nach Schlicrsee. Wir haben uns
ein paar mal geschrieben, nie mehr gesehen, aber
sein Geist hat mich oft umweht, und wenn ich
je Erträgliches geschaffen, ich verdanke viel dem
großen Meister, dem ich diese Zeilen in wehmüth-
iger Erinnerung widme.
Alle Kunst ist Eins, nur die Ausdrucksmittel
sind verschieden. Der kostbare Same des wahr-
haft Großen fliegt weit hinaus über sein mütter-
liches Erdreich und wohin er sich senkt, im kärg-
lichsten Boden sproßt und blüht es, wenn echte
Begeisterung ihn durchglüht.
Du aber, wackerer Säemann, Wilhelm Leibl,
ruhe sanft in der vaterländischen Erde, ans der
Deine seltene Kraft gewachsen.
Richard Pfeiffer (München)
Der Tündensall
Setz' in dich, mein Sohn, kehr' um!
Lrlaub'ns Hochwürden — wär's ne! noch Heit
di» nach de Redouten?
JBcv
fie weiß und fühlt, daß er sic auch noch bekommen
_, wird! Die andern hat er ja schon alle! Aus
der alten Muhme wird er sich wohl nichts machen;
und so recht gehört sie auch gar nicht zur Familie. Die
kommt auch nie zu ihm und schwemmt nicht einmal die
Wäsche in seinem Wasser. Sie ftirchtet ihn, und die ge-
heimnißvollen Reize, die er birgt, sind ihr fremd.
Sie ist so alt die Muhme und hat alles hinter sich!
Das Mädchen seufzt auf und nestelt am Mieder.
Es drückt und ist ihr zu eng. Zu ihren Füßen läuft
der Fluß dahin und durchquert träge und schwarz-
grau das Moor. Es ist, als schnitte er ihr ein Ge-
sicht, während sie so zu ihm hinab starrt. Ja, es
ist ein Gesicht! Sie sieht es deutlich. So gierig,
grausam und wollüstig, als hätte er den jungen,
warmen Mädchenleib schon umflossen. All die ihm
dienstbaren Arme der alten, versunkenen Wei-
denstrunke und Baumwurzeln, die sein Grund
birgt, strecken und recken sich nach ihr. Und ein
gutes Bett liegt da unten: Sv weich und lind ist's.
Faulige, schwarze Erde und glattes Schilf, von Taug
und Algen durchzogen. Und wenn sie dann erst
darauf läge, würde er sich über sie werfen, dann
aber lveiter fließen, rauschen, und endlich am Gefälle
donnern und ausschäumen, Lustige Perlen würde
er den kreischenden Mähderinnen ins Gesicht spritzen,
harmlos neckend. Ein ganz anderer als der kriechende,
heimtückische Geselle aus dem öden Moorgrund, mit
seinem listigen Augenzwinkern und Lächeln.
Die Weiden, die sein rechtes User säumen, leuchten
purpurn im Sonnenschein, und gelb und blau
flimmert es streifig im Wasser auf.
Das sind die Büsche, die sich spiegeln, und der
lichtblaue Himmel mit hartgetönten Wolkenfetzen.
Des Mädchens Blick hastet an den ersten Leber-
blümchen, die blauviolett am Boden blühen, und
jede Hautpore ihres Körpers will die warmen
Sonnenstrahlen einsaugen. An der Wiesenscite sind
die Weidenruthcn voll silberner Kätzchen. Sie greift
darnach, und ein kleines bleibt ihr zwischen den
Fingern. Sie dreht das Knöspchen mechanisch hin
und h.r, und reibt es an der Innenseite des Armes.
Wie zart und weich! Wie ein .Kinderkörper, dem noch
kein Lustzug angekommen. Ein zartes neugeborenes
Kind! Sie schauert zusammen, schüttelt das bleiche
Haupt und geht einigcSchritte weiter das User hinaus.
Da scheint das Wasser im beckenartig erweiterten
Flußbett zu stehen, ruhig und glänzend.
Hier war cs, wo im Herbst das Haselgebiisch
gestanden. Im Sommer blühten in großen Büscheln
gelbe Lilien daneben. Später hatte sich Jahn dort in
dem Gebüsch cineHütte sür die Entenjagd gemacht, mit
Strohdach und Wänden. Da war's geschützt und wann
drin gewesen, lang noch, bis in de» Spätherbst. Und
sie fühlte sich ja immmer so einsam. Da schlüpfte sie
dann dort hinein zu ihm, das war ihre ganze Welt.
Die Stare sammelten sich; wie schwarze Wolken ver-
dunkelten sie aus Augenblicke das Firmament und sie-
len dann, in Kolonnen geteilt, lärmend ins Schilf
ein. Jahn lachte, daß seine blanken Zähne schimmer-
ten, und sie küßte ihn, gerade aus einen der zuckende»
Mundwinkel. Hoch oben zogen Kraniche in der Lust
dahin, und wo das Moor trockener war, fand Jahn
bei der Heimkehr glänzende Silberdisteln.
Damit schmückten sie später die Entenhütte und
steckten »och leuchtende, rote Essigbeeren und Hage-
butten dazu. Enten hatte Jahn damals nie geschossen.
Seine Flinte stand ruhig in die Ecke gelehnt. Er hielt
sein Mädchen aus dem Schoß und küßte es. Sie sagten
sich wenig, aber sie wußten das Beste, — sie liebten
sich! Gegen Abend wurde es schon kalt, aber keines
fühlte cs. Sie hielten sich zu heiß und fest umfangen.
Wie der Mond aufgegangen, fiel sein Licht hart und
frostig in die Hütte. Und morgen sollte Jahn fort!
Ihr Jahn! Wen hatte sie sonst aus der Welt? Die
alte Muhme und die zerfallene Käthe auf dein Moor-
grund drüben! Also nichts! Die Leute im Dorfe
verachten sie ja doch. War cs denn ihre Schuld,
daß der Strom sie alle verschlang? Erst den Vater,—
sie sagten im Rausche. Dann die Mutter, aus dem
Arm den kleinen Bruder. Von den Gendarmen
1»