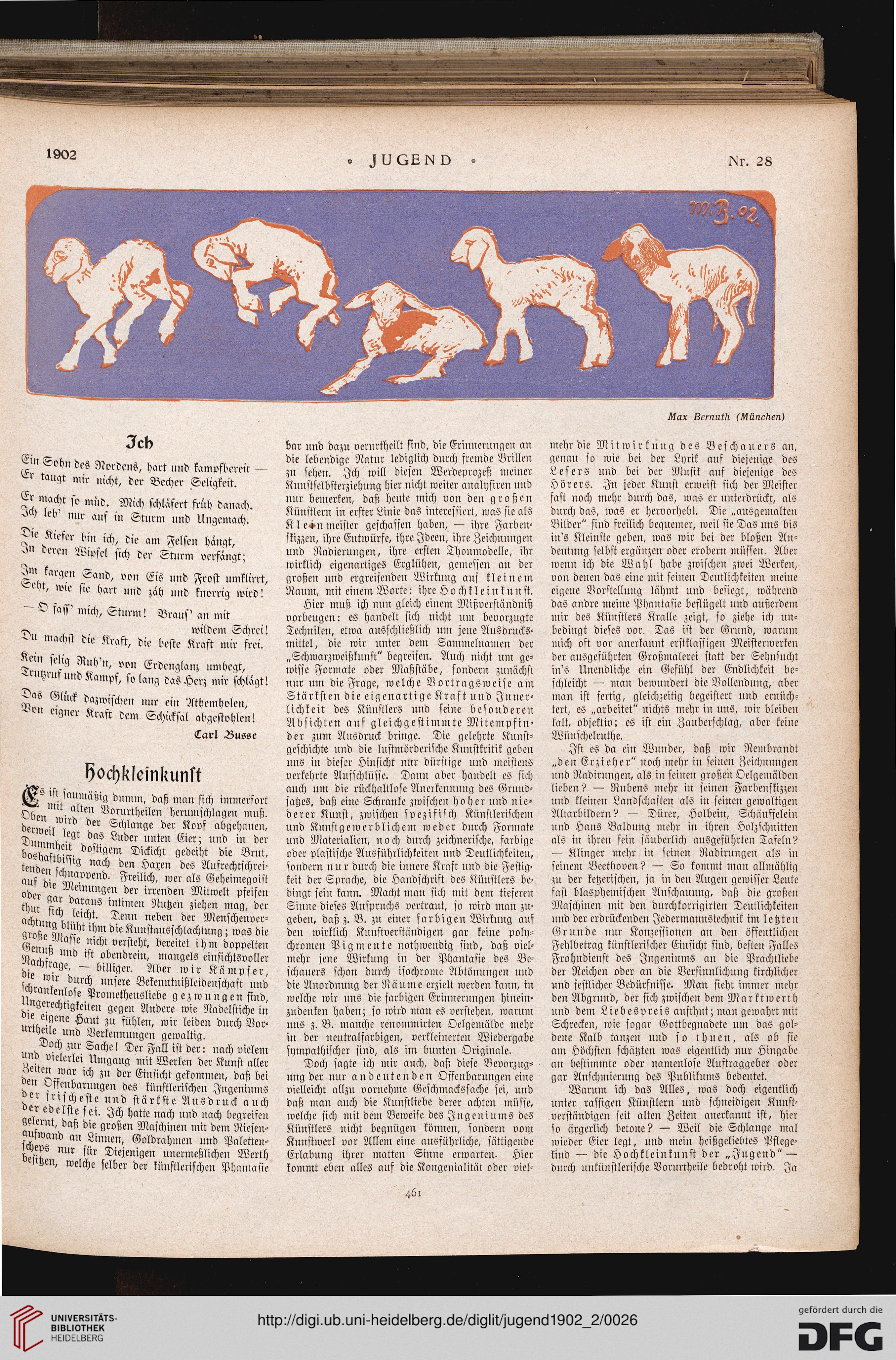1902
JUGEN D
Nr. 28
3ck
Gin Sohn dos Nordens, Kart und kampfbereit —
Gr taugt mir nicht, der Becher Seligkeit.
Gr macht so mild. Mich schläfert früh danach.
2ch leb' nur auf in Sturm und Ungemach.
^ic Kiefer hin ich, die am Felsen hangt,
In deren Wipfel sich der Sturm verfangt;
2m kargen Sand, von Eis und Frost umklirrt,
^teht, wie sic hart und zäh und knorrig wird!
— O fass' mich, Sturm! Braus' an mit
wildem Schrei!
Du machst die Kraft, die beste Kraft mir frei.
Kein selig Nuh'n, von Erdenglanz umhegt,
Trutzrnf und Kampf, so lang daS Herz mir schlagt!
^as Glück dazwischen nur ein Athemholen,
Von eigner Kraft dem Schicksal abgestohlen!
Larl Busse
hochkIeinInmN
s ist saumäßig dumm, daß man sich immerfort
^ mit alten Vorurtheilen herumschlagen muß.
-beu wird der Schlange der Kopf abgehauen,
derweil legt das Luder unten Eier; und in der
Dummheit dostigem Dickicht gedeiht die Brut,
doshastbissig nach den Haxen des Aufrechtschrei-
wnden schnappend. Freilich, wer als Geheimegoist
^uf die Meinungen der irrenden Mitwelt pfeifen
oder gar daraus intimen Nutzen ziehen mag, der
"tut sich leicht. Denn neben der Menschenver-
achtung blüht ihm die Kunstausschlachtung; was die
aroße Masse nicht versteht, bereitet ihm doppelten
ibennß und ist obendrein, mangels einsichtsvoller
Nachfrage, — billiger. Aber wir Kämpfer,
die wir durch unsere Bekenntnißlcidenschaft und
schrankenlose Prometheusliebe gezwungen sind,
Ungerechtigkeiten gegen Andere wie Nadelstiche in
die eigene Haut zu fühlen, wir leiden durch Vor-
urtheile und Verkennungen gewaltig.
Doch zur Sache! Der Fall ist der: nach vielem
und vielerlei Umgang mit Werken der Kunst aller
Feiten war ich zu der Einsicht gekommen, daß bei
den Offenbarungen des künstlerischen Ingeniums
der frischeste und stärkste Ausdruck auch
der edelste sei. Ich hatte nach und nach begreifen
gelernt, daß die großen Maschinen mit dem Riesen-
aufwand an Linnen, Goldrnhmen und Paletten-
scheps nur für Diejenigen unermeßlichen Werth
besitzen, welche selber der künstlerischen Phantasie
bar und dazu verurtheilt sind, die Erinnerungen an
die lebendige Natur lediglich durch fremde Brillen
zu sehen. Ich will diesen Werdeprozeß meiner
Knnstselbsterziehung hier nicht weiter analysiren und
nur bemerken, daß heute mich von den großen
Künstlern in erster Linie das interessiert, was sie als
K l e»n meister geschaffen haben, — ihre Farben-
skizzen, ihre Entwürfe, ihre Ideen, ihre Zeichnungen
und Radierungen, ihre ersten Thonmodelle, ihr
wirklich eigenartiges Erglühen, gemessen an der
großen und ergreifenden Wirkung auf kleinem
Raum, mit einem Worte: ihre H o ch k l e i u k u n st.
Hier muß ich nun gleich einem Mißverständniß
Vorbeugen: es handelt sich nicht um bevorzugte
Techniken, etwa ausschließlich um jene Ansdrucks-
mittel, die wir unter dem Sammelnamen der
„Schwarzweißknust" begreifen. Auch nicht um ge-
wisse Formate oder Maßstäbe, sondern zunächst
nur um die Frage, welche Vortragsweise am
Stärksten die eigenartige Kraft und Inner-
lichkeit des Künstlers und seine besonderen
Absichten auf gleichgestimmte Mitempfin-
der zum Ausdruck bringe. Die gelehrte Kunst-
geschichte und die lustmördcrische Kunstkritik geben
uns in dieser Hinsicht nur dürftige und meistens
verkehrte Aufschlüsse. Tann aber handelt es sich
auch um die rückhaltlose Anerkennung des Grund-
satzes, daß eine Schranke zwischen hoher und nie-
derer Kunst, zwischen spezifisch Künstlerischem
und Kunstgewerblichem weder durch Formate
und Materialien, noch durch zeichnerische, farbige
oder plastische Ausführlichkeiten und Deutlichkeiten,
sondern nur durch die innere Kraft und die Festig-
keit der Sprache, die Handschrift des Künstlers be-
dingt sein kann. Macht man sich mit dem tieferen
Sinne dieses Anspruchs vertraut, so wird man zu-
gebcn, daß z. B. zu einer farbigen Wirkung auf
den wirklich Kunstverständigen gar keine poly-
chromen Pigmente nothwendig sind, daß viel-
mehr jene Wirkung in der Phantasie des Be-
schauers schon durch isochrome Abtönungen und
die Anordnung der Räume erzielt werden kann, in
welche wir uns die farbigen Erinnerungen hinein-
zudenken haben; so wird man es verstehen, warum
uns z. B. manche renommirten Oelgemälde mehr
in der neutralfarbigen, verkleinerten Wiedergabe
sympathischer sind, als im bunten Originale.
Doch sagte ich mir auch, daß diese Bevorzug-
ung der nur andeutenden Offenbarungen eine
vielleicht allzu vornehme Geschmackssache sei, und
daß nian auch die Kunstliebe derer achten müsse,
welche sich mit dem Beweise des Ingeniums des
Künstlers nicht begnügen können, sondern vom
Kunstwerk vor Allem eine ausführliche, sättigende
Erlabung ihrer matten Sinne erwarten. Hier
kommt eben alles auf die Kongenialität oder viel-
Max Bcrnuth (München)
mehr die Mitwirkung des Beschauers an,
genau so wie bei der Lyrik ans diejenige des
Lesers und bei der Musik auf diejenige des
Hörers. In jeder Kunst erweist sich der Meister
fast noch mehr durch das, was er unterdrückt, als
durch das, was er hervorhebt. Die „ausgemalten
Bilder" sind freilich bequemer, weil sie Das uns bis
in's Kleinste geben, was wir bei der bloßen An-
deutung selbst ergänzen oder erobern müssen. Aber
wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Werken,
von denen das eine mit seinen Deutlichkeiten meine
eigene Vorstellung lähmt und besiegt, während
das andre meine Phantasie beflügelt und außerdem
mir des Künstlers Kralle zeigt, so ziehe ich un-
bedingt dieses vor. Das ist der Grund, warum
mich oft vor anerkannt erstklassigen Meisterwerken
der ausgeführten Großmalerei statt der Sehnsucht
in's Unendliche ein Gefühl der Endlichkeit be-
schleicht — man bewundert die Vollendung, aber
man ist fertig, gleichzeitig begeistert und ernüch-
tert, es „arbeitet" nichts mehr in uns, wir bleiben
kalt, objektiv: es ist ein Zanberschlag, aber keine
Wünschelruthe.
Ist es da ein Wunder, daß wir Rembrandt
„den Erzieher" noch mehr in seinen Zeichnungen
und Radirungen, als in seinen großen Oelgcmäldcn
lieben? — Rubens mehr in seinen Farbenskizzen
und kleinen Landschaften als in seinen gewaltigen
Altarbildern? — Dürer, Holbein, Schäuffelein
und Hans Baldung mehr in ihren Holzschnitten
als in ihren fein säuberlich ausgeführten Tafeln?
— Klinger mehr in seinen Radirnngen als in
seinem Beethoven? — So kommt man allmählig
zu der ketzerischen, ja in den Augen gewisser Leute
fast blasphemischen Anschauung, daß die großen
Maschinen mit den durchkorrigirten Deutlichkeiten
und der erdrückenden Jedermannstechnik im letzten
Grunde nur Konzessionen an den öffentlichen
Fehlbetrag künstlerischer Einsicht sind, besten Falles
Frohndienst des Ingeniums an die Prachtliebe
der Reichen oder an die Versinnlichnng kirchlicher
und festlicher Bedürfnisse. Man sieht immer mehr
den Abgrund, der sich zwischen dem Marktwerth
und dem Liebespreis aufthnt; man gewahrt mit
Schrecken, wie sogar Gottbegnadete um das gol-
dene Kalb tanzen und so thuen, als ob sie
am Höchsten schätzten was eigentlich nur Hingabe
an bestimmte oder namenlose Auftraggeber oder-
gar Anschmierung des Publikunis bedeutet.
Warum ich das Alles, was doch eigentlich
unter rassigen Künstlern und schneidigen Kunst-
verständigen seit alten Zeiten anerkannt ist, hier
so ärgerlich betone? — Weil die Schlange mal
wieder Eier legt, und mein heißgeliebtes Pflege-
kind — die Hochkleinkunst der „Jugend" —
durch unkünstlerische Vorurtheile bedroht wird. Ja
461
JUGEN D
Nr. 28
3ck
Gin Sohn dos Nordens, Kart und kampfbereit —
Gr taugt mir nicht, der Becher Seligkeit.
Gr macht so mild. Mich schläfert früh danach.
2ch leb' nur auf in Sturm und Ungemach.
^ic Kiefer hin ich, die am Felsen hangt,
In deren Wipfel sich der Sturm verfangt;
2m kargen Sand, von Eis und Frost umklirrt,
^teht, wie sic hart und zäh und knorrig wird!
— O fass' mich, Sturm! Braus' an mit
wildem Schrei!
Du machst die Kraft, die beste Kraft mir frei.
Kein selig Nuh'n, von Erdenglanz umhegt,
Trutzrnf und Kampf, so lang daS Herz mir schlagt!
^as Glück dazwischen nur ein Athemholen,
Von eigner Kraft dem Schicksal abgestohlen!
Larl Busse
hochkIeinInmN
s ist saumäßig dumm, daß man sich immerfort
^ mit alten Vorurtheilen herumschlagen muß.
-beu wird der Schlange der Kopf abgehauen,
derweil legt das Luder unten Eier; und in der
Dummheit dostigem Dickicht gedeiht die Brut,
doshastbissig nach den Haxen des Aufrechtschrei-
wnden schnappend. Freilich, wer als Geheimegoist
^uf die Meinungen der irrenden Mitwelt pfeifen
oder gar daraus intimen Nutzen ziehen mag, der
"tut sich leicht. Denn neben der Menschenver-
achtung blüht ihm die Kunstausschlachtung; was die
aroße Masse nicht versteht, bereitet ihm doppelten
ibennß und ist obendrein, mangels einsichtsvoller
Nachfrage, — billiger. Aber wir Kämpfer,
die wir durch unsere Bekenntnißlcidenschaft und
schrankenlose Prometheusliebe gezwungen sind,
Ungerechtigkeiten gegen Andere wie Nadelstiche in
die eigene Haut zu fühlen, wir leiden durch Vor-
urtheile und Verkennungen gewaltig.
Doch zur Sache! Der Fall ist der: nach vielem
und vielerlei Umgang mit Werken der Kunst aller
Feiten war ich zu der Einsicht gekommen, daß bei
den Offenbarungen des künstlerischen Ingeniums
der frischeste und stärkste Ausdruck auch
der edelste sei. Ich hatte nach und nach begreifen
gelernt, daß die großen Maschinen mit dem Riesen-
aufwand an Linnen, Goldrnhmen und Paletten-
scheps nur für Diejenigen unermeßlichen Werth
besitzen, welche selber der künstlerischen Phantasie
bar und dazu verurtheilt sind, die Erinnerungen an
die lebendige Natur lediglich durch fremde Brillen
zu sehen. Ich will diesen Werdeprozeß meiner
Knnstselbsterziehung hier nicht weiter analysiren und
nur bemerken, daß heute mich von den großen
Künstlern in erster Linie das interessiert, was sie als
K l e»n meister geschaffen haben, — ihre Farben-
skizzen, ihre Entwürfe, ihre Ideen, ihre Zeichnungen
und Radierungen, ihre ersten Thonmodelle, ihr
wirklich eigenartiges Erglühen, gemessen an der
großen und ergreifenden Wirkung auf kleinem
Raum, mit einem Worte: ihre H o ch k l e i u k u n st.
Hier muß ich nun gleich einem Mißverständniß
Vorbeugen: es handelt sich nicht um bevorzugte
Techniken, etwa ausschließlich um jene Ansdrucks-
mittel, die wir unter dem Sammelnamen der
„Schwarzweißknust" begreifen. Auch nicht um ge-
wisse Formate oder Maßstäbe, sondern zunächst
nur um die Frage, welche Vortragsweise am
Stärksten die eigenartige Kraft und Inner-
lichkeit des Künstlers und seine besonderen
Absichten auf gleichgestimmte Mitempfin-
der zum Ausdruck bringe. Die gelehrte Kunst-
geschichte und die lustmördcrische Kunstkritik geben
uns in dieser Hinsicht nur dürftige und meistens
verkehrte Aufschlüsse. Tann aber handelt es sich
auch um die rückhaltlose Anerkennung des Grund-
satzes, daß eine Schranke zwischen hoher und nie-
derer Kunst, zwischen spezifisch Künstlerischem
und Kunstgewerblichem weder durch Formate
und Materialien, noch durch zeichnerische, farbige
oder plastische Ausführlichkeiten und Deutlichkeiten,
sondern nur durch die innere Kraft und die Festig-
keit der Sprache, die Handschrift des Künstlers be-
dingt sein kann. Macht man sich mit dem tieferen
Sinne dieses Anspruchs vertraut, so wird man zu-
gebcn, daß z. B. zu einer farbigen Wirkung auf
den wirklich Kunstverständigen gar keine poly-
chromen Pigmente nothwendig sind, daß viel-
mehr jene Wirkung in der Phantasie des Be-
schauers schon durch isochrome Abtönungen und
die Anordnung der Räume erzielt werden kann, in
welche wir uns die farbigen Erinnerungen hinein-
zudenken haben; so wird man es verstehen, warum
uns z. B. manche renommirten Oelgemälde mehr
in der neutralfarbigen, verkleinerten Wiedergabe
sympathischer sind, als im bunten Originale.
Doch sagte ich mir auch, daß diese Bevorzug-
ung der nur andeutenden Offenbarungen eine
vielleicht allzu vornehme Geschmackssache sei, und
daß nian auch die Kunstliebe derer achten müsse,
welche sich mit dem Beweise des Ingeniums des
Künstlers nicht begnügen können, sondern vom
Kunstwerk vor Allem eine ausführliche, sättigende
Erlabung ihrer matten Sinne erwarten. Hier
kommt eben alles auf die Kongenialität oder viel-
Max Bcrnuth (München)
mehr die Mitwirkung des Beschauers an,
genau so wie bei der Lyrik ans diejenige des
Lesers und bei der Musik auf diejenige des
Hörers. In jeder Kunst erweist sich der Meister
fast noch mehr durch das, was er unterdrückt, als
durch das, was er hervorhebt. Die „ausgemalten
Bilder" sind freilich bequemer, weil sie Das uns bis
in's Kleinste geben, was wir bei der bloßen An-
deutung selbst ergänzen oder erobern müssen. Aber
wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Werken,
von denen das eine mit seinen Deutlichkeiten meine
eigene Vorstellung lähmt und besiegt, während
das andre meine Phantasie beflügelt und außerdem
mir des Künstlers Kralle zeigt, so ziehe ich un-
bedingt dieses vor. Das ist der Grund, warum
mich oft vor anerkannt erstklassigen Meisterwerken
der ausgeführten Großmalerei statt der Sehnsucht
in's Unendliche ein Gefühl der Endlichkeit be-
schleicht — man bewundert die Vollendung, aber
man ist fertig, gleichzeitig begeistert und ernüch-
tert, es „arbeitet" nichts mehr in uns, wir bleiben
kalt, objektiv: es ist ein Zanberschlag, aber keine
Wünschelruthe.
Ist es da ein Wunder, daß wir Rembrandt
„den Erzieher" noch mehr in seinen Zeichnungen
und Radirungen, als in seinen großen Oelgcmäldcn
lieben? — Rubens mehr in seinen Farbenskizzen
und kleinen Landschaften als in seinen gewaltigen
Altarbildern? — Dürer, Holbein, Schäuffelein
und Hans Baldung mehr in ihren Holzschnitten
als in ihren fein säuberlich ausgeführten Tafeln?
— Klinger mehr in seinen Radirnngen als in
seinem Beethoven? — So kommt man allmählig
zu der ketzerischen, ja in den Augen gewisser Leute
fast blasphemischen Anschauung, daß die großen
Maschinen mit den durchkorrigirten Deutlichkeiten
und der erdrückenden Jedermannstechnik im letzten
Grunde nur Konzessionen an den öffentlichen
Fehlbetrag künstlerischer Einsicht sind, besten Falles
Frohndienst des Ingeniums an die Prachtliebe
der Reichen oder an die Versinnlichnng kirchlicher
und festlicher Bedürfnisse. Man sieht immer mehr
den Abgrund, der sich zwischen dem Marktwerth
und dem Liebespreis aufthnt; man gewahrt mit
Schrecken, wie sogar Gottbegnadete um das gol-
dene Kalb tanzen und so thuen, als ob sie
am Höchsten schätzten was eigentlich nur Hingabe
an bestimmte oder namenlose Auftraggeber oder-
gar Anschmierung des Publikunis bedeutet.
Warum ich das Alles, was doch eigentlich
unter rassigen Künstlern und schneidigen Kunst-
verständigen seit alten Zeiten anerkannt ist, hier
so ärgerlich betone? — Weil die Schlange mal
wieder Eier legt, und mein heißgeliebtes Pflege-
kind — die Hochkleinkunst der „Jugend" —
durch unkünstlerische Vorurtheile bedroht wird. Ja
461