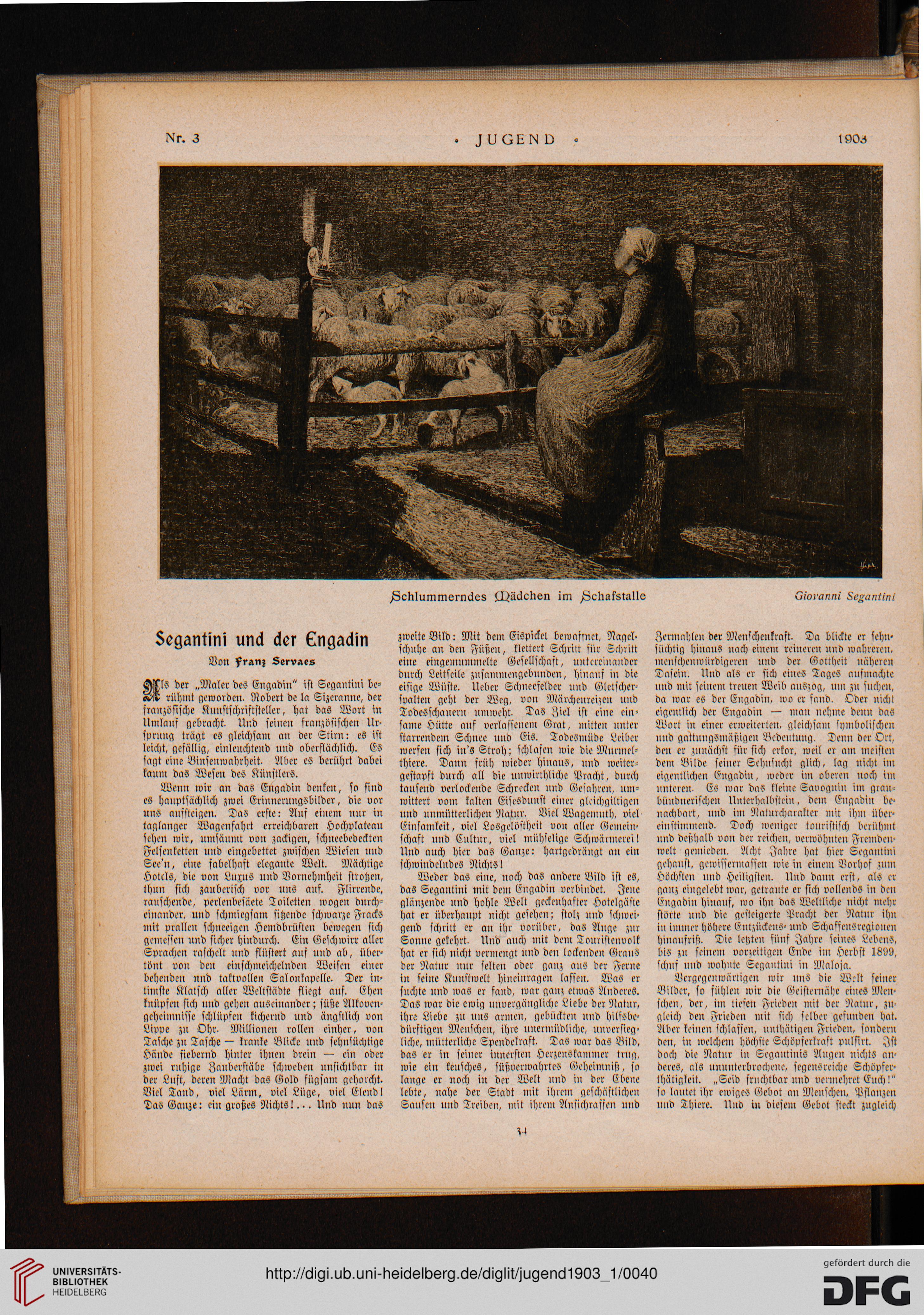Nr. 3
JUGEND
1903
5egan1ini und der Engadin
Von franj Servaes
ÄVlS der „Maler des Engadin" ist Segantini bc-
Klv rühmt geworden. Robert de la Sizeranne, der
französische Kunstschriftsteller, hat das Wort in
Umlauf gebracht. Und seinen französischen Ur-
sprnng trägt es gleichsam an der Stirn: es ist
leicht, gefällig, einleuchtend und oberflächlich. Es
sagt eine Binsenwahrheit- Aber cs berührt dabei
kaum das Wesen des Künstlers.
Wenn wir an das Engadin denken, so sind
es hauptsächlich zwei Erinnerungsbilder, die vor
uns anssteigen. Das erste: Auf einem nur in
taglanger Wagcnfnhrt erreichbaren Hochplateau
sehen wir, umsänmt von zackigen, schneebedeckten
Fclscnketten und eingebettet zwischen Wiesen und
Seen, eine fabelhaft elegante Welt. Mächtige
Hotcls, die von Luxus und Vornehmheit strohe»,
thun sich zauberisch vor uns auf. Flirrende,
rauschende, perlenbesäete Toiletten wogen durch-
einander. und schmiegsam sitzende schwarze Fracks
mit prallen schneeigen Hemdbrüsten bewegen sich
gemessen und sicher hindurch. Ein Geschwirr aller
Sprachen raschelt und flüstrrt auf und ab, über-
tönt von den einschmeichelnden Weisen einer
behenden und taktvollen Salonkapelle. Der in-
timste Klatsch aller Weltstädte fliegt ans. Ehen
knüpfen sich und gehen auseinander; süße Alkoven-
geheimnisse schlüpfen kichernd und ängstlich von
Lippe zu Ohr. Millionen rollen einher, von
Tasche zu Tasche — kranke Blicke und sehnsüchtige
Hände fiebernd hinter ihnen drein — ein oder
zwei ruhige Zanberstäbe schweben unsichtbar in
der Lust, deren Macht das Gold fügsam gehorcht.
Mel Tand, viel Lärm, viel Lüge, viel Elend I
Das Ganze: ein großes NichtsI... Und nun das
^LliIummernäL8 £L>ädchen im jSchafstalle
zweite Bild: Mit dem Eispickel bewaffnet, Nagel-
schuhe an den Füßen, klettert Schritt für Schritt
eine eingcmnminelte Gesellschaft, untereinander
durch Leitseile zusnmmengebunden, hinaus in die
eisige Wüste. Uebcr Schneefelder und Gletscher-
spalte» geht der Weg, von Märchenreizen und
Todesschauern umweht. Das Ziel ist eine ein-
same Hütte auf verlassenem Grat, mitten unter
starrendem Schnee und Eis. Todesmüde Leiber
werfen sich in's Stroh; schlafen wie die Murmel-
thiere. Dann früh wieder hinaus, und weitcr-
gestapft durch all die nnwirthliche Pracht, durch
tausend verlockende Schrecken und Gefahren, um-
wittert vom kalten Eiscsdunst einer gleichgiltigcn
und unmütterlichen Natur. Viel Wagcninth, viel
Einsanikeit, viel Losgelösthcit von aller Gemein-
schaft und Cultur, viel mühselige Schwärmerei!
Und auch hier das Ganze: hartgcdrängt an ein
schwindelndes Nichts!
Weder das eine, noch das andere Bild ist cs,
das Segantini mit dein Engadin verbindet. Jene
glänzende und hohle Welt geckenhafter Hotelgäste
hat er überhaupt nicht gesehen; stolz imb schwei-
gend schritt er an ihr vorüber, das Auge zur
Sonne gekehrt. Und auch mit dem Touristenvolk
hat er sich nicht vermengt itnd den lockenden Grans
der Natur nur selten oder ganz ans der Ferne
in seine Kunstwelt hineinragen lassen. Was er
suchte und was er fand, war ganz etwas Anderes.
Das war die ewig unvergängliche Liebe der Natur,
ihre Liebe zu uns armen, gebückten und hilfsbe-
dürftigen Menschen, ihre unermüdliche, unversieg-
liche, mütterliche Spcndekraft. Das war das Bild,
das er in seiner innersten Herzenskammer trug,
wie ein keusches, süßverwahrtes Geheimniß, so
lange er noch in der Welt und in der Ebene
lebte, nahe der Stadt mit ihrem geschäftlichen
Sausen und Treiben, mit ihrem Ansichraffen und
Z-t
Giovanni Segantini
Zermahlen der Menschenkraft. Da blickte er sehn-
süchtig hinaus nach einem reineren und wahreren,
menschenwürdigeren und der Gottheit näheren
Dasein. Und als er sich eines Tages aufmachte
und mit seinem treuen Weib anszog, um zu suchen,
da war es der Engadin, wo er fand. Oder »ich!
eigentlich der Engadin — man nehme denn das
Wort in einer erweiterten, gleichsam synibolischen
und gattungsmäßigen Bedeutung. Denn der Ort,
den er zunächst für sich erkor, weil er am meisten
dem Bilde seiner Sehnsucht glich, lag nicht im
eigentlichen Engadin, weder im oberen noch im
unteren- Es war das kleine Savognin im grau
bündnerischen Unterhalbstcin, dem Engadin be-
nachbart, und im Naturcharakter mit ihm über-
einstimmend. Doch weniger touristisch berühmt
und deßhalb von der reichen, verwöhnten Frcmden-
welt gemieden. Acht Jahre hat hier Segantini
gehaust, gcwisscrmassen wie in einem Vorhof zum
Höchsten und Heiligsten. Und dann erst, als er
ganz cingelebt war, getraute er sich vollends in den
Engadin hinauf, wo ihn das Weltliche nicht mehr
störte und die gesteigerte Pracht der Natur ihn
in immer höhere Entzückens- und Schaffensregionen
hinanfriß. Die letzten fünf Jahre seines Lebens,
bis zu seinem vorzeitigen Ende im Herbst 1899,
schuf und wohnte Segantini in Blaloja.
Vergegenwärtigen wir uns die Welt seiner
Bilder, so fühlen wir die Geisternähe eines Men-
schen, der, im tiefen Frieden mit der Natur, zu-
gleich den Frieden mit sich selber gefunden hat.
Aber keinen schlassen, nnthätigen Frieden, sondern
den, in welchem höchste Schöpferkraft pnlsirt. Ist
doch die Natur in Segantinis Augen nichts an-
deres, als ununterbrochene, segensreiche Schöpfer-
thätigkeit. „Seid fruchtbar und vermehret Euch!"
so lautet ihr ewiges Gebot an Menschen, Pflanzen
und Thiere. Und in diesem Gebot steckt zugleich
JUGEND
1903
5egan1ini und der Engadin
Von franj Servaes
ÄVlS der „Maler des Engadin" ist Segantini bc-
Klv rühmt geworden. Robert de la Sizeranne, der
französische Kunstschriftsteller, hat das Wort in
Umlauf gebracht. Und seinen französischen Ur-
sprnng trägt es gleichsam an der Stirn: es ist
leicht, gefällig, einleuchtend und oberflächlich. Es
sagt eine Binsenwahrheit- Aber cs berührt dabei
kaum das Wesen des Künstlers.
Wenn wir an das Engadin denken, so sind
es hauptsächlich zwei Erinnerungsbilder, die vor
uns anssteigen. Das erste: Auf einem nur in
taglanger Wagcnfnhrt erreichbaren Hochplateau
sehen wir, umsänmt von zackigen, schneebedeckten
Fclscnketten und eingebettet zwischen Wiesen und
Seen, eine fabelhaft elegante Welt. Mächtige
Hotcls, die von Luxus und Vornehmheit strohe»,
thun sich zauberisch vor uns auf. Flirrende,
rauschende, perlenbesäete Toiletten wogen durch-
einander. und schmiegsam sitzende schwarze Fracks
mit prallen schneeigen Hemdbrüsten bewegen sich
gemessen und sicher hindurch. Ein Geschwirr aller
Sprachen raschelt und flüstrrt auf und ab, über-
tönt von den einschmeichelnden Weisen einer
behenden und taktvollen Salonkapelle. Der in-
timste Klatsch aller Weltstädte fliegt ans. Ehen
knüpfen sich und gehen auseinander; süße Alkoven-
geheimnisse schlüpfen kichernd und ängstlich von
Lippe zu Ohr. Millionen rollen einher, von
Tasche zu Tasche — kranke Blicke und sehnsüchtige
Hände fiebernd hinter ihnen drein — ein oder
zwei ruhige Zanberstäbe schweben unsichtbar in
der Lust, deren Macht das Gold fügsam gehorcht.
Mel Tand, viel Lärm, viel Lüge, viel Elend I
Das Ganze: ein großes NichtsI... Und nun das
^LliIummernäL8 £L>ädchen im jSchafstalle
zweite Bild: Mit dem Eispickel bewaffnet, Nagel-
schuhe an den Füßen, klettert Schritt für Schritt
eine eingcmnminelte Gesellschaft, untereinander
durch Leitseile zusnmmengebunden, hinaus in die
eisige Wüste. Uebcr Schneefelder und Gletscher-
spalte» geht der Weg, von Märchenreizen und
Todesschauern umweht. Das Ziel ist eine ein-
same Hütte auf verlassenem Grat, mitten unter
starrendem Schnee und Eis. Todesmüde Leiber
werfen sich in's Stroh; schlafen wie die Murmel-
thiere. Dann früh wieder hinaus, und weitcr-
gestapft durch all die nnwirthliche Pracht, durch
tausend verlockende Schrecken und Gefahren, um-
wittert vom kalten Eiscsdunst einer gleichgiltigcn
und unmütterlichen Natur. Viel Wagcninth, viel
Einsanikeit, viel Losgelösthcit von aller Gemein-
schaft und Cultur, viel mühselige Schwärmerei!
Und auch hier das Ganze: hartgcdrängt an ein
schwindelndes Nichts!
Weder das eine, noch das andere Bild ist cs,
das Segantini mit dein Engadin verbindet. Jene
glänzende und hohle Welt geckenhafter Hotelgäste
hat er überhaupt nicht gesehen; stolz imb schwei-
gend schritt er an ihr vorüber, das Auge zur
Sonne gekehrt. Und auch mit dem Touristenvolk
hat er sich nicht vermengt itnd den lockenden Grans
der Natur nur selten oder ganz ans der Ferne
in seine Kunstwelt hineinragen lassen. Was er
suchte und was er fand, war ganz etwas Anderes.
Das war die ewig unvergängliche Liebe der Natur,
ihre Liebe zu uns armen, gebückten und hilfsbe-
dürftigen Menschen, ihre unermüdliche, unversieg-
liche, mütterliche Spcndekraft. Das war das Bild,
das er in seiner innersten Herzenskammer trug,
wie ein keusches, süßverwahrtes Geheimniß, so
lange er noch in der Welt und in der Ebene
lebte, nahe der Stadt mit ihrem geschäftlichen
Sausen und Treiben, mit ihrem Ansichraffen und
Z-t
Giovanni Segantini
Zermahlen der Menschenkraft. Da blickte er sehn-
süchtig hinaus nach einem reineren und wahreren,
menschenwürdigeren und der Gottheit näheren
Dasein. Und als er sich eines Tages aufmachte
und mit seinem treuen Weib anszog, um zu suchen,
da war es der Engadin, wo er fand. Oder »ich!
eigentlich der Engadin — man nehme denn das
Wort in einer erweiterten, gleichsam synibolischen
und gattungsmäßigen Bedeutung. Denn der Ort,
den er zunächst für sich erkor, weil er am meisten
dem Bilde seiner Sehnsucht glich, lag nicht im
eigentlichen Engadin, weder im oberen noch im
unteren- Es war das kleine Savognin im grau
bündnerischen Unterhalbstcin, dem Engadin be-
nachbart, und im Naturcharakter mit ihm über-
einstimmend. Doch weniger touristisch berühmt
und deßhalb von der reichen, verwöhnten Frcmden-
welt gemieden. Acht Jahre hat hier Segantini
gehaust, gcwisscrmassen wie in einem Vorhof zum
Höchsten und Heiligsten. Und dann erst, als er
ganz cingelebt war, getraute er sich vollends in den
Engadin hinauf, wo ihn das Weltliche nicht mehr
störte und die gesteigerte Pracht der Natur ihn
in immer höhere Entzückens- und Schaffensregionen
hinanfriß. Die letzten fünf Jahre seines Lebens,
bis zu seinem vorzeitigen Ende im Herbst 1899,
schuf und wohnte Segantini in Blaloja.
Vergegenwärtigen wir uns die Welt seiner
Bilder, so fühlen wir die Geisternähe eines Men-
schen, der, im tiefen Frieden mit der Natur, zu-
gleich den Frieden mit sich selber gefunden hat.
Aber keinen schlassen, nnthätigen Frieden, sondern
den, in welchem höchste Schöpferkraft pnlsirt. Ist
doch die Natur in Segantinis Augen nichts an-
deres, als ununterbrochene, segensreiche Schöpfer-
thätigkeit. „Seid fruchtbar und vermehret Euch!"
so lautet ihr ewiges Gebot an Menschen, Pflanzen
und Thiere. Und in diesem Gebot steckt zugleich