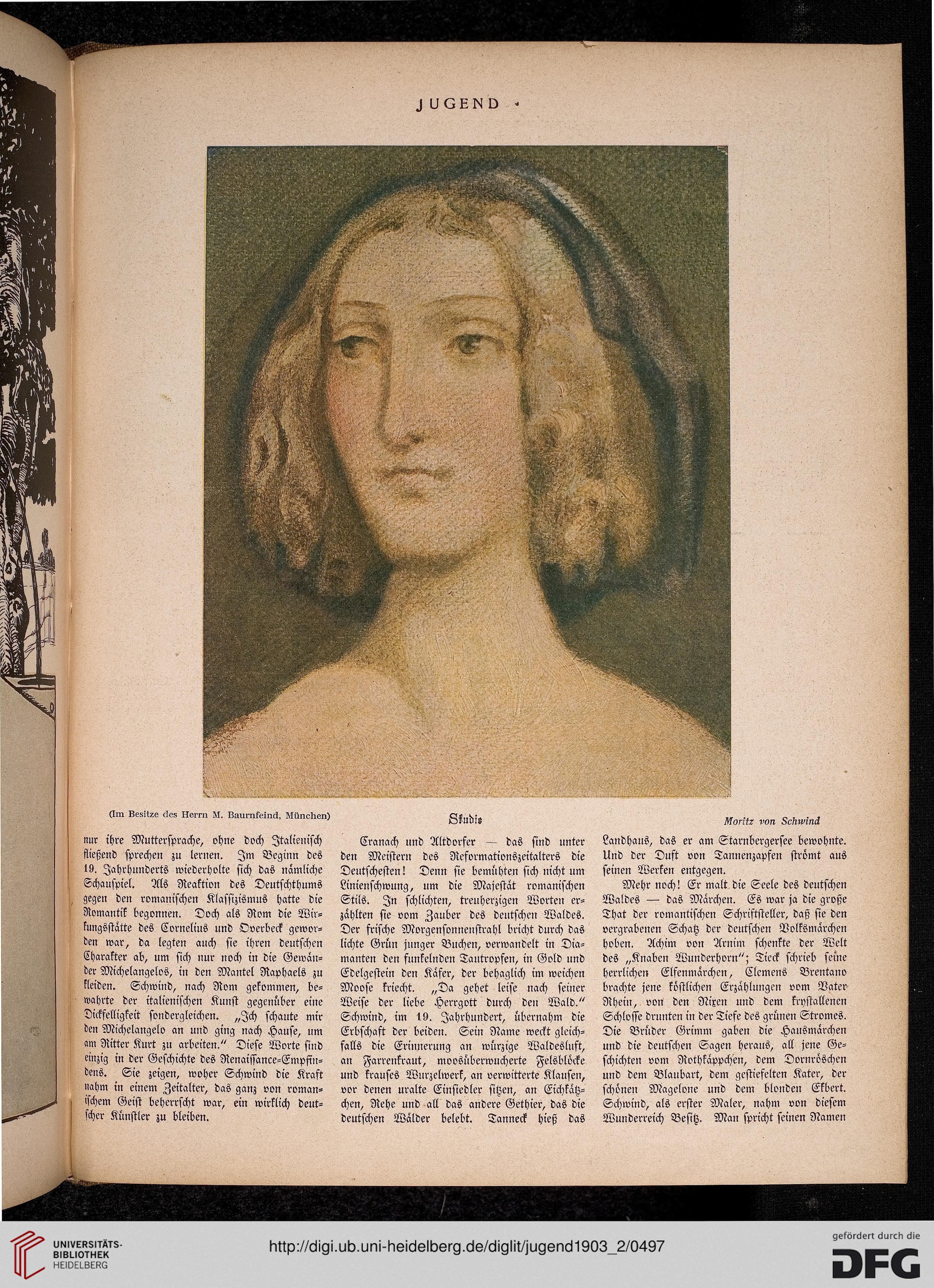(Im Besitze des Herrn M. Baurnfeind, München)
Sfubte
Moritz von Schwind
nur ihre Muttersprache, ohne doch Italienisch
fließend sprechen zu lernen. Im Beginn des
19. Jahrhunderts wiederholte sich das nämliche
Schauspiel. Als Reaktion des Deutschthums
gegen den romanischen Klassizismus hatte die
Romantik begonnen. Doch als Rom die Wir-
kungsstätte des Cornelius und Overbeck gewor-
den war, da legten auch sie ihren dentschen
Charakter ab, um sich nur noch in die Gewän-
der Michelangelos, in den Mantel Raphaels zu
kleiden. Schwind, nach Rom gekommen, be-
wahrte der italienischen Kunst gegenüber eine
Dickfelligkeit sondergleichen. „Ich schaute mir
den Michelangelo an und ging nach Hause, um
am Ritter Kurt zu arbeiten." Diese Worte sind
einzig in der Geschichte des Renaissance-Empfin-
dens. Sie zeigen, woher Schwind die Kraft
»ahm in einem Zeitalter, das ganz von roman-
ischem Geist beherrscht war, ein wirklich deut-
scher Künstler zu bleiben.
Cranach und Altdorfer — das sind unter
den Meistern des Reformationszeitalters die
Deutschesten! Denn sie bemühten sich nicht um
Linienschwung, um die Majestät romanischen
Stils. In schlichten, treuherzigen Worten er-
zählten sie vom Zauber des deutschen Waldes.
Der frische Morgensonnenstrahl bricht durch das
lichte Grün junger Buchen, verwandelt in Dia-
manten den funkelnden Tautropfen, in Gold und
Edelgestein den Kaser, der behaglich im weichen
Moose kriecht. „Da gehet leise nach seiner
Weise der liebe Herrgott durch den Wald."
Schwind, im 19. Jahrhundert, übernahm die
Erbschaft der beiden. Sein Name weckt gleich-
falls die Erinnerung an würzige Waldesluft,
cm Farrenkraut, moosüberwucherte Felsblocke
und krauses Wurzelwerk, an verwitterte Klausen,
vor denen uralte Einsiedler sitzen, an Eichkätz-
chen, Rehe und all das andere Gethier, das die
deutschen Wälder belebt. Tanneck hieß das
Landhaus, das er am Starnbergersee bewohnte.
Und der Duft von Tannenzapfen strömt aus
seinen Werken entgegen.
Mehr noch! Er malt die Seele des deutschen
Waldes — das Märchen. Es war ja die große
That der romantischen Schriftsteller, daß sie den
vergrabenen Schatz der deutschen Volksmärchen
hoben. Achim von Arnim schenkte der Welt
des „Knaben Wunderhorn"; Ticck schrieb seine
herrlichen Elfenmärchen, Clemens Brentano
brachte jene köstlichen Erzählungen vom Vater
Rhein, von den Nixen und dem krystallenen
Schlosse drunten in der Tiefe des grünen Stromes.
Die Brüder Grimm gaben die Hansmarchen
und die deutschen Sagen heraus, all jene Ge-
schichten vom Rothkäppchen, dem Dornröschen
und dem Blaubart, dem gestiefelten Kater, der
schönen Magelone und dem blonden Ekbert.
Schwind, als erster Maler, nahm von diesem
Wunderreich Besitz. Man spricht seinen Namen
Sfubte
Moritz von Schwind
nur ihre Muttersprache, ohne doch Italienisch
fließend sprechen zu lernen. Im Beginn des
19. Jahrhunderts wiederholte sich das nämliche
Schauspiel. Als Reaktion des Deutschthums
gegen den romanischen Klassizismus hatte die
Romantik begonnen. Doch als Rom die Wir-
kungsstätte des Cornelius und Overbeck gewor-
den war, da legten auch sie ihren dentschen
Charakter ab, um sich nur noch in die Gewän-
der Michelangelos, in den Mantel Raphaels zu
kleiden. Schwind, nach Rom gekommen, be-
wahrte der italienischen Kunst gegenüber eine
Dickfelligkeit sondergleichen. „Ich schaute mir
den Michelangelo an und ging nach Hause, um
am Ritter Kurt zu arbeiten." Diese Worte sind
einzig in der Geschichte des Renaissance-Empfin-
dens. Sie zeigen, woher Schwind die Kraft
»ahm in einem Zeitalter, das ganz von roman-
ischem Geist beherrscht war, ein wirklich deut-
scher Künstler zu bleiben.
Cranach und Altdorfer — das sind unter
den Meistern des Reformationszeitalters die
Deutschesten! Denn sie bemühten sich nicht um
Linienschwung, um die Majestät romanischen
Stils. In schlichten, treuherzigen Worten er-
zählten sie vom Zauber des deutschen Waldes.
Der frische Morgensonnenstrahl bricht durch das
lichte Grün junger Buchen, verwandelt in Dia-
manten den funkelnden Tautropfen, in Gold und
Edelgestein den Kaser, der behaglich im weichen
Moose kriecht. „Da gehet leise nach seiner
Weise der liebe Herrgott durch den Wald."
Schwind, im 19. Jahrhundert, übernahm die
Erbschaft der beiden. Sein Name weckt gleich-
falls die Erinnerung an würzige Waldesluft,
cm Farrenkraut, moosüberwucherte Felsblocke
und krauses Wurzelwerk, an verwitterte Klausen,
vor denen uralte Einsiedler sitzen, an Eichkätz-
chen, Rehe und all das andere Gethier, das die
deutschen Wälder belebt. Tanneck hieß das
Landhaus, das er am Starnbergersee bewohnte.
Und der Duft von Tannenzapfen strömt aus
seinen Werken entgegen.
Mehr noch! Er malt die Seele des deutschen
Waldes — das Märchen. Es war ja die große
That der romantischen Schriftsteller, daß sie den
vergrabenen Schatz der deutschen Volksmärchen
hoben. Achim von Arnim schenkte der Welt
des „Knaben Wunderhorn"; Ticck schrieb seine
herrlichen Elfenmärchen, Clemens Brentano
brachte jene köstlichen Erzählungen vom Vater
Rhein, von den Nixen und dem krystallenen
Schlosse drunten in der Tiefe des grünen Stromes.
Die Brüder Grimm gaben die Hansmarchen
und die deutschen Sagen heraus, all jene Ge-
schichten vom Rothkäppchen, dem Dornröschen
und dem Blaubart, dem gestiefelten Kater, der
schönen Magelone und dem blonden Ekbert.
Schwind, als erster Maler, nahm von diesem
Wunderreich Besitz. Man spricht seinen Namen