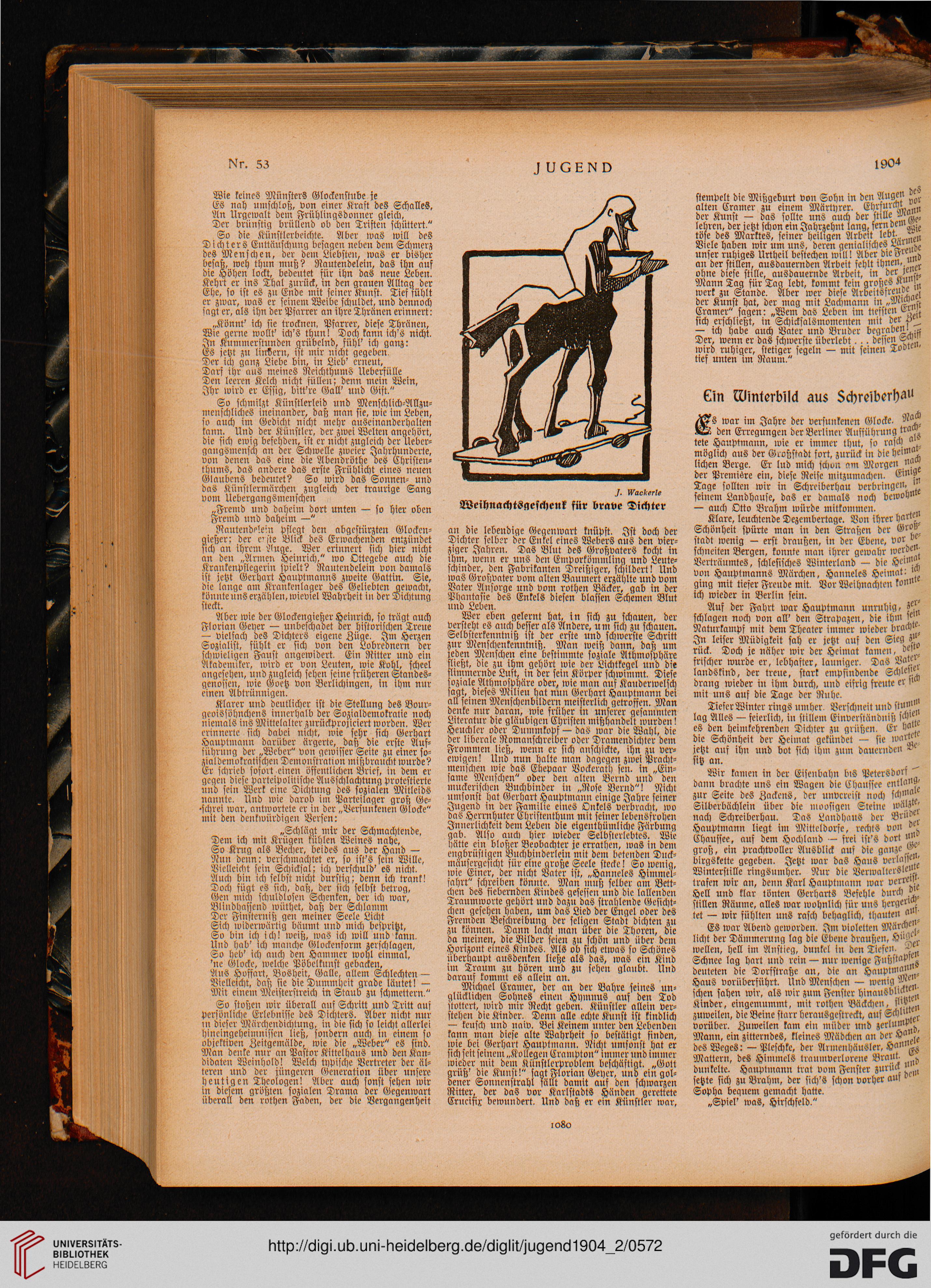Nr. 53
JUGEND
1904
Wie keines Münsters Glockenstube je
Es nah umschloß, von einer Kraft des Schalles,
An Urgewalt dem Frühlingsdonner gleich,
Der brünstig brüllend ob den Tristen schlittert."
So die Künstlerbeichte, Aber was will des
Dichters Enttäuschung besagen neben dem Schmerz
des Menschen, der dem Liebsten, was er bisher
besaß, weh thun muß? Rautendelein, das ihn auf
die Höhen lockt, bedeutet für ihn das neue Leben,
Kehrt er ins Thal zurück, in den grauen Alltag der
Ehe, so ist es zu Ende mit seiner Kunst, Ties sühlt
er zwar, was er seinem Weibe schuldet, und dennoch
sagt er, als ihn der Pfarrer an ihre Thränen erinnert:
„Könnt' ich sie trocknen, Pfarrer, diese Thränen,
Wie gerne wollt' ich's thun! Doch kann ich's nicht.
In Kummerstunden grübelnd, fühl' ich ganz:
Es jetzt zu Nutzern, ist mir nicht gegeben.
Der ich ganz Liebe bin, in Lieb' erneut,
Dars ihr aus meines Reichthums Ueberfülle
Den leeren Kelch nicht füllen; denn mein Wein,
Ihr wird er Essig, bitt're Gall' und Gift."
So schmilzt Künstlerleid und Menschlich-Allzu-
menschliches ineinander, daß man sie, wie im Leben,
so auch im Gedicht nicht mehr auseinanderhalten
kann. Und der Künstler, der zwei Welten angehört,
die sich ewig befehden, ist er nicht zugleich der Ueber-
gaugsmensch an der Schwelle zweier Jahrhunderte,
von denen das eine die Abendröthe des Christen-
thums, das andere das erste Frühlicht eines neuen
Glaubens bedeutet? So wird das Sonnen- und
das Künstlermärchen zugleich der traurige Sang
vom Uebergangsmenschcn
„Frenid und daheim dort unten — so hier oben
Fremd und daheim —"
Rautendelein pflegt den abgcstiirzten Glocken-
gießer; der erste Blick des Erwachenden enlziiudet
sich an ihrem Auge. Wer erinnert sich hier nicht
an den „Armen Heinrich," wo Ottegebe auch die
Krankenpflegerin spielt? Rautendelein von damals
ist jetzt Gerhart Hauptmanns zweite Gattin. Sie,
die lange am.Krankenlager des Geliebten gewacht,
könnte uns erzählen, wieviel Wahrheit tu der Dichtung
steckt.
Aber wie der Glockengießer Heinrich, so trägt auch
Florian Geyer — unbeschadet der historischen Treue
— vielfach des Dichters eigene Züge. Im Herzen
Sozialist, sühlt er sich von den Lobrednern der
schwieligen Faust angewidert. Ein Ritter und ein
Akademiker, wird er von Leuten, wie Kohl, scheel
angesehen, und zugleich sehen seine früheren Standes-
genossen, wie Goetz von Berlichingen, in ihm nur
einen Abtrünnigen.
Klarer und deutlicher ist die Stellung des Bour-
geoissöhnchens innerhalb der Sozialdemokratie noch
niemals ins Mittelalter zurückproficiert worden. Wer
erinnerte sich dabei nicht, wie sehr sich Gerhart
Hauptmann darüber ärgerte, daß die erste Auf-
führung der „Weber" von gewisser Seite zu einer so-
zialdemokratischen Demonstration mißbraucht wurde?
Er schrieb sofort einen öffentlichen Brief, in dem er
gegen diese parteipolitische Ausschlachtung protestierte
und sein Werk eine Dichtung des sozialen Mitleids
nannte. Und wie darob im Parteilager groß Ge-
-schrei war, antwortete er in der „Versunkenen Glocke"
mit den denkwürdigen Versen:
„Schlägt mir der Schmachtende,
Dem ich mit Krügen kühlen Weines nahe,
So Krug als Becher, beides aus der Hand —
Nun denn: verschmachtet er, so ist's sem Wille,
Vielleicht sein Schicksal; ich verschuld' es nicht.
Auch bin ich selbst nicht durstig; denn ich trank!
Doch fügt es sich, daß, der sich selbst betrog,
Gen mich schuldlosen Schenken, der ich war,
Blindhasjcnd wülhct, daß der Schlamm
Der Finiterniß gen meiner Seele Licht
Sich widerwärtig bäumt und mich bespritzt,
So bin ich ich! weiß, was ich will und kann.
Und Hab' ich manche Glockensorm zerschlagen,
So heb' ich auch den Hammer wohl einmal,
'ne Glocke, welche Pöbelkunst gebacken,
Aus Hoffart, Bosheit, Galle, allem Schlechten —
Vielleicht, daß sie die Dummheit grade läutet! —
Mit einem Meisterstreich in Staub zu schmettern."
So stoßen wir überall ans Schritt und Tritt auf
persönliche Erlebnisse des Dichters. Aber nicht nur
in dieser Märchendichtung, in die sich so leicht allerlei
hineingeheimnisscn ließ, sondern auch in einem so
objektiven Zeitgemälde, wie die „Weber" es sind.
Man denke nur an Pastor Kittelhaus und den Kan-
didaten Weinhold! Welch typische Vertreter der äl-
teren und der jüngeren Generation über unsere
heutigen Theologen! Aber auch sonst sehen wir
in diesem größten sozialen Drama der Gegenwart
überall den rothen Faden, der die Vergangenheit
J. Wackerle
Weihnachtsgeschenk für brave Dichter
an die lebendige Gegenwart knüpft. Ist doch der
Dichter selber der Enkel eines Webers aus den vier-
ziger Jahren. Das Blut des Großvaters kocht in
ihm, wenn er uns den Emporkömmling und Leute-
schinder, den Fabrikanten Dreißiger, schildert! Und
was Großvater vom alten Baumert erzählte und vom
Vater Ansorge und vom rothen Bäcker, gab in der
Phantasie des Enkels diesen blassen Schemen Blut
unb Leben.
Wer eben gelernt hat, in sich zu schauen, der
versteht es auch besser als Andere, um sich zu schauen.
Selbsterkenntniß ist der erste und schwerste Schritt
zur Menschenkenntniß. Man weiß dann, daß um
reden Menschen eine bestimmte soziale Athmosphäre
ließt, die zu ihm gehört wie der Lichtkegel und die
limmernde Lust, in der sein Körper schwimmt. Diese
oziale Athmosphäre oder, wie man auf Kauderwelsch
agt, dieses Milieu hat nun Gerhart Hauptmann bei
all seinen Menschenbildern meisterlich getroffen. Man
denke nur daran, wie früher in unserer gesamniten
Literatur die gläubigen Christen mißhandelt wurden!
Heuchler oder Dummkopf — das war die Wahl, die
der liberale Romanschreiber oder Dramendichter dem
Frommen ließ, wenn er sich anschickte, ihn zu ver-
ewigen! Und nun halte man dagegen zwei Pracht-
menschen wie das Ehepaar Vockerath sen. in „Ein-
same Menschen" oder den alten Bernd und den
muckerischen Buchbinder in „Rose Bernd"! Nicht
umsonst hat Gerhart Hauptmann einige Jahre seiner
Jugend in der Familie eines Onkels verbracht, wo
das Herrnhuter Christenthum mit seiner lebensfrohen
Innerlichkeit dem Leben die eigenthümliche Färbung
gab. Also auch hier wieder Selbsterlebtes. Wie
hätte ein bloßer Beobachter je errathen, was in dem
engbrüstigen Buchbinderlein mit dem betenden Duck-
mausergesicht sür eine große Seele stecke l So wenig,
lote Einer, der nicht Vater ist, „Hanneles Himmel-
fahrt" schreiben könnte. Man muß selber am Bett-
chen des fiebernden Kindes gesessen und die lallenden
Traumworte gehört und dazu das strahlende Gesicht-
chen gesehen haben, um das Lied der Engel oder des
Fremden Beschreibung der seligen Stadt dichten zu
zu können. Dann lacht man über die Thoren, die
da meinen, die Bilder seien zu schön und über dem
Horizont eines Kindes. Als ob sich etwas so Schönes
überhaupt ausdenken ließe als das, was ein Kind
im Traum zu hören und zu sehen glaubt. Und
daraus kommt es allein an.
Michael Cramer, der an der Bahre seines un-
glücklichen Sohnes einen Hymnus aus den Tod
stottert, wird mir Recht geben. Künstler allein ver-
stehen die Kinder. Denn alle echte Kunst ist kindlich
— keusch und naiv. Bei Keinem unter den Lebenden
kann man diese alte Wahrheit so bestätigt finden,
wie bei Gerhart Hauptmann. Nicht umsonst hat er
sich seit seinem „Kollegen Crampton" immer und immer
wieder mit dem Künstlerproblem beschäftigt. „Gott
grüß' die Kunst!" sagt Florian Geyer, und ein gol-
dener Sonnenstrahl fällt damit auf den schwarzen
Ritter, der das vor Karlstadts Händen gerettete
Crneifir bewundert. Und daß er ein Kfinstler war,
stempelt die Mißgeburt von Sohn in den Augen .
alten Cramer zu einem Märtyrer. Ehrfurch*
der Kunst — das sollte uns auch der stille ä>»
lehren, der jetzt schon ein Jahrzehnt lang, fern dein^
töse des Marktes, seiner heiligen Arbeit lebt.
Viele haben wir um uns, deren genialisches Lau .
unser ruhiges Urtheil bestechen will! Aber dieF*** ^
MF .1 M ' ' hlt ihnen, nn
in der
Mann Tag für Tag lebt, kommt kein großes
werk zu Stande. Aber wer diese Arbeitsfreude .
an der stillen, ausdauernden Arbeit fehlt ihnen,J*
ohne diese stille, ausdauernde Arbeit, in der Isi
Mann Tag für Tag lebt, kommt kein großes SU*1
werk zu Stande. Aber wer diese Arbeitsfreude .
der Kunst hat, der niag mit Lachmann i>* „Ms?»V
Cramer" sagen: „Wem das Leben im ttessten Er»!.
sich er!
in Schicksalsmomenten mit der
Zeit
ui v^ujiuiuivmumcmcu um r
— ich habe auch Vater und Bruder begrabe» . .
Der, wenn er das schwerste überlebt... dessen
wird ruhiger, stetiger segeln — mit seinen Tod** '
tief unten int Raum."
Gin Winlerbilä aus Zchreiberha«
s war im Jahre der versunkenen Glocke.
^ den Erregungen der Berliner Aufführung tra»»
tete Hauptmann, wie er immer thut, so rasch ®
möglich aus der Großstadt fort, zurück in die hei»***,
lichcn Berge. Er lud mich schon am Morgen »s*
der Premidre ein, diese Reise mitzumachen.
Tage sollte» wir in Schreibcrhau verbringe»,
seinem Landhause, das er damals noch bewoh»
— auch Otto Brahm würde mitkommen. ,
Klare, leuchtende Dezembertage. Von ihrer harte
Schönheit spürte man in den Straßen der Gro»'
stadt wenig — erst draußen, in der Ebene, vor ge-
schneiten Bergen, konnte man ihrer gewahr werde»;
Verträumtes, schlesisches Winterland — die Hei»»
von Hauptmanns Märchen, Hauneles Heimat* *
ging mit tiefer Freude mit. Vor Weihnachten kon»
ich wieder in Berlin sein.
Auf der Fahrt war Hauptmann unruhig,
schlagen noch von all' den Strapazen, die ihm »,
Naturkampf mit dem Theater immer wieder bracht
In leiser Müdigkeit sah er jetzt auf den Sieg ä"
rück. Doch je näher wir der Heimat kamen, de!*
frischer wurde er, lebhastcr, launiger. Das Pate'
landskind, der treue, stark empfindende Schlei»
drang wieder in ihm durch, und eifrig sreute er!>
mit uns aus die Tage der Ruhe.
TiescrWinter rings umher. Verschneit und st»*»"!
lag Alles — feierlich, in stillem Einverständuiß !?!»,
es den heimkehrenden Dichter zu griißen. Er b»»
die Schönheit der Heimat gekündet — sie nwuj,
jetzt auf ihn und bot sich ihm zum dauernde»
sitz an.
Wir kamen in der Eisenbahn bis Petersdors ''
dann brachte uns ein Wagen die Chaussee cntla»w
zur Seite des Zackens, der unvcreist noch sch»'»
Silbcrbächlein über die moosigen Steine »’»!* '
nach Schreiberhau. Das Landhaus der Brüde
Hauptmann liegt im Mitteldorse, rechts von 5e.
CTftnuffep. nuf hpnt SSnrhfmih — frpi hott
Chaussee, auf dem Hochland — frei ist's dort
groß, ein prachtvoller Ausblick aus die ganze 1
birgskette gegeben. Jetzt war das Haus verlasse»'
Winterstille ringsumher. Nur die Verwalters!*»*
trafen wir an, denn Karl Hauptmann war verrc*U
Hell und klar tönten Gerharts Befehle durch
stillen Räume, alles war wohnlich sür uns herge**»
tet — wir fühlten uns rasch behaglich, thauten ***»
Es war Abend geworden. Im violetten MärcheNs
licht der Dämmerung lag die Ebene draußen, H**ä*
wellen, hell im Anstieg, dunkel in den Tiefe».
Schnee lag hart und rein — nur wenige Fnbstap*G
deuteten die Dorfstraße an, die an Haupt»*»»»
Haus vorübersührt. Und Menschen — wenig M°»
schen sahen wir, als wir zum Fenster Hinausblick* '
Kinder, eingemummt, mit rothen Bäckchen, stG*
zuweilen, die Beine starr herausgestreckt, aus Sä!**» r
vorüber. Zuweilen kam ein müder und zerlump.
Mann, ein zitterndes, kleines Mädchen an der
des Weges: — Pleschke, der Armenhäusler, H»»»^K
Maklern, des Himmels traumverlorene Braub „
dunkelte. Hauptmann trat vom Fenster zurück *
setzte sich zu Brahm, der sich's schon vorher a**> *
Sopha bequem gemacht hatte.
„Spiel' was, Hirschfeld."
1080
JUGEND
1904
Wie keines Münsters Glockenstube je
Es nah umschloß, von einer Kraft des Schalles,
An Urgewalt dem Frühlingsdonner gleich,
Der brünstig brüllend ob den Tristen schlittert."
So die Künstlerbeichte, Aber was will des
Dichters Enttäuschung besagen neben dem Schmerz
des Menschen, der dem Liebsten, was er bisher
besaß, weh thun muß? Rautendelein, das ihn auf
die Höhen lockt, bedeutet für ihn das neue Leben,
Kehrt er ins Thal zurück, in den grauen Alltag der
Ehe, so ist es zu Ende mit seiner Kunst, Ties sühlt
er zwar, was er seinem Weibe schuldet, und dennoch
sagt er, als ihn der Pfarrer an ihre Thränen erinnert:
„Könnt' ich sie trocknen, Pfarrer, diese Thränen,
Wie gerne wollt' ich's thun! Doch kann ich's nicht.
In Kummerstunden grübelnd, fühl' ich ganz:
Es jetzt zu Nutzern, ist mir nicht gegeben.
Der ich ganz Liebe bin, in Lieb' erneut,
Dars ihr aus meines Reichthums Ueberfülle
Den leeren Kelch nicht füllen; denn mein Wein,
Ihr wird er Essig, bitt're Gall' und Gift."
So schmilzt Künstlerleid und Menschlich-Allzu-
menschliches ineinander, daß man sie, wie im Leben,
so auch im Gedicht nicht mehr auseinanderhalten
kann. Und der Künstler, der zwei Welten angehört,
die sich ewig befehden, ist er nicht zugleich der Ueber-
gaugsmensch an der Schwelle zweier Jahrhunderte,
von denen das eine die Abendröthe des Christen-
thums, das andere das erste Frühlicht eines neuen
Glaubens bedeutet? So wird das Sonnen- und
das Künstlermärchen zugleich der traurige Sang
vom Uebergangsmenschcn
„Frenid und daheim dort unten — so hier oben
Fremd und daheim —"
Rautendelein pflegt den abgcstiirzten Glocken-
gießer; der erste Blick des Erwachenden enlziiudet
sich an ihrem Auge. Wer erinnert sich hier nicht
an den „Armen Heinrich," wo Ottegebe auch die
Krankenpflegerin spielt? Rautendelein von damals
ist jetzt Gerhart Hauptmanns zweite Gattin. Sie,
die lange am.Krankenlager des Geliebten gewacht,
könnte uns erzählen, wieviel Wahrheit tu der Dichtung
steckt.
Aber wie der Glockengießer Heinrich, so trägt auch
Florian Geyer — unbeschadet der historischen Treue
— vielfach des Dichters eigene Züge. Im Herzen
Sozialist, sühlt er sich von den Lobrednern der
schwieligen Faust angewidert. Ein Ritter und ein
Akademiker, wird er von Leuten, wie Kohl, scheel
angesehen, und zugleich sehen seine früheren Standes-
genossen, wie Goetz von Berlichingen, in ihm nur
einen Abtrünnigen.
Klarer und deutlicher ist die Stellung des Bour-
geoissöhnchens innerhalb der Sozialdemokratie noch
niemals ins Mittelalter zurückproficiert worden. Wer
erinnerte sich dabei nicht, wie sehr sich Gerhart
Hauptmann darüber ärgerte, daß die erste Auf-
führung der „Weber" von gewisser Seite zu einer so-
zialdemokratischen Demonstration mißbraucht wurde?
Er schrieb sofort einen öffentlichen Brief, in dem er
gegen diese parteipolitische Ausschlachtung protestierte
und sein Werk eine Dichtung des sozialen Mitleids
nannte. Und wie darob im Parteilager groß Ge-
-schrei war, antwortete er in der „Versunkenen Glocke"
mit den denkwürdigen Versen:
„Schlägt mir der Schmachtende,
Dem ich mit Krügen kühlen Weines nahe,
So Krug als Becher, beides aus der Hand —
Nun denn: verschmachtet er, so ist's sem Wille,
Vielleicht sein Schicksal; ich verschuld' es nicht.
Auch bin ich selbst nicht durstig; denn ich trank!
Doch fügt es sich, daß, der sich selbst betrog,
Gen mich schuldlosen Schenken, der ich war,
Blindhasjcnd wülhct, daß der Schlamm
Der Finiterniß gen meiner Seele Licht
Sich widerwärtig bäumt und mich bespritzt,
So bin ich ich! weiß, was ich will und kann.
Und Hab' ich manche Glockensorm zerschlagen,
So heb' ich auch den Hammer wohl einmal,
'ne Glocke, welche Pöbelkunst gebacken,
Aus Hoffart, Bosheit, Galle, allem Schlechten —
Vielleicht, daß sie die Dummheit grade läutet! —
Mit einem Meisterstreich in Staub zu schmettern."
So stoßen wir überall ans Schritt und Tritt auf
persönliche Erlebnisse des Dichters. Aber nicht nur
in dieser Märchendichtung, in die sich so leicht allerlei
hineingeheimnisscn ließ, sondern auch in einem so
objektiven Zeitgemälde, wie die „Weber" es sind.
Man denke nur an Pastor Kittelhaus und den Kan-
didaten Weinhold! Welch typische Vertreter der äl-
teren und der jüngeren Generation über unsere
heutigen Theologen! Aber auch sonst sehen wir
in diesem größten sozialen Drama der Gegenwart
überall den rothen Faden, der die Vergangenheit
J. Wackerle
Weihnachtsgeschenk für brave Dichter
an die lebendige Gegenwart knüpft. Ist doch der
Dichter selber der Enkel eines Webers aus den vier-
ziger Jahren. Das Blut des Großvaters kocht in
ihm, wenn er uns den Emporkömmling und Leute-
schinder, den Fabrikanten Dreißiger, schildert! Und
was Großvater vom alten Baumert erzählte und vom
Vater Ansorge und vom rothen Bäcker, gab in der
Phantasie des Enkels diesen blassen Schemen Blut
unb Leben.
Wer eben gelernt hat, in sich zu schauen, der
versteht es auch besser als Andere, um sich zu schauen.
Selbsterkenntniß ist der erste und schwerste Schritt
zur Menschenkenntniß. Man weiß dann, daß um
reden Menschen eine bestimmte soziale Athmosphäre
ließt, die zu ihm gehört wie der Lichtkegel und die
limmernde Lust, in der sein Körper schwimmt. Diese
oziale Athmosphäre oder, wie man auf Kauderwelsch
agt, dieses Milieu hat nun Gerhart Hauptmann bei
all seinen Menschenbildern meisterlich getroffen. Man
denke nur daran, wie früher in unserer gesamniten
Literatur die gläubigen Christen mißhandelt wurden!
Heuchler oder Dummkopf — das war die Wahl, die
der liberale Romanschreiber oder Dramendichter dem
Frommen ließ, wenn er sich anschickte, ihn zu ver-
ewigen! Und nun halte man dagegen zwei Pracht-
menschen wie das Ehepaar Vockerath sen. in „Ein-
same Menschen" oder den alten Bernd und den
muckerischen Buchbinder in „Rose Bernd"! Nicht
umsonst hat Gerhart Hauptmann einige Jahre seiner
Jugend in der Familie eines Onkels verbracht, wo
das Herrnhuter Christenthum mit seiner lebensfrohen
Innerlichkeit dem Leben die eigenthümliche Färbung
gab. Also auch hier wieder Selbsterlebtes. Wie
hätte ein bloßer Beobachter je errathen, was in dem
engbrüstigen Buchbinderlein mit dem betenden Duck-
mausergesicht sür eine große Seele stecke l So wenig,
lote Einer, der nicht Vater ist, „Hanneles Himmel-
fahrt" schreiben könnte. Man muß selber am Bett-
chen des fiebernden Kindes gesessen und die lallenden
Traumworte gehört und dazu das strahlende Gesicht-
chen gesehen haben, um das Lied der Engel oder des
Fremden Beschreibung der seligen Stadt dichten zu
zu können. Dann lacht man über die Thoren, die
da meinen, die Bilder seien zu schön und über dem
Horizont eines Kindes. Als ob sich etwas so Schönes
überhaupt ausdenken ließe als das, was ein Kind
im Traum zu hören und zu sehen glaubt. Und
daraus kommt es allein an.
Michael Cramer, der an der Bahre seines un-
glücklichen Sohnes einen Hymnus aus den Tod
stottert, wird mir Recht geben. Künstler allein ver-
stehen die Kinder. Denn alle echte Kunst ist kindlich
— keusch und naiv. Bei Keinem unter den Lebenden
kann man diese alte Wahrheit so bestätigt finden,
wie bei Gerhart Hauptmann. Nicht umsonst hat er
sich seit seinem „Kollegen Crampton" immer und immer
wieder mit dem Künstlerproblem beschäftigt. „Gott
grüß' die Kunst!" sagt Florian Geyer, und ein gol-
dener Sonnenstrahl fällt damit auf den schwarzen
Ritter, der das vor Karlstadts Händen gerettete
Crneifir bewundert. Und daß er ein Kfinstler war,
stempelt die Mißgeburt von Sohn in den Augen .
alten Cramer zu einem Märtyrer. Ehrfurch*
der Kunst — das sollte uns auch der stille ä>»
lehren, der jetzt schon ein Jahrzehnt lang, fern dein^
töse des Marktes, seiner heiligen Arbeit lebt.
Viele haben wir um uns, deren genialisches Lau .
unser ruhiges Urtheil bestechen will! Aber dieF*** ^
MF .1 M ' ' hlt ihnen, nn
in der
Mann Tag für Tag lebt, kommt kein großes
werk zu Stande. Aber wer diese Arbeitsfreude .
an der stillen, ausdauernden Arbeit fehlt ihnen,J*
ohne diese stille, ausdauernde Arbeit, in der Isi
Mann Tag für Tag lebt, kommt kein großes SU*1
werk zu Stande. Aber wer diese Arbeitsfreude .
der Kunst hat, der niag mit Lachmann i>* „Ms?»V
Cramer" sagen: „Wem das Leben im ttessten Er»!.
sich er!
in Schicksalsmomenten mit der
Zeit
ui v^ujiuiuivmumcmcu um r
— ich habe auch Vater und Bruder begrabe» . .
Der, wenn er das schwerste überlebt... dessen
wird ruhiger, stetiger segeln — mit seinen Tod** '
tief unten int Raum."
Gin Winlerbilä aus Zchreiberha«
s war im Jahre der versunkenen Glocke.
^ den Erregungen der Berliner Aufführung tra»»
tete Hauptmann, wie er immer thut, so rasch ®
möglich aus der Großstadt fort, zurück in die hei»***,
lichcn Berge. Er lud mich schon am Morgen »s*
der Premidre ein, diese Reise mitzumachen.
Tage sollte» wir in Schreibcrhau verbringe»,
seinem Landhause, das er damals noch bewoh»
— auch Otto Brahm würde mitkommen. ,
Klare, leuchtende Dezembertage. Von ihrer harte
Schönheit spürte man in den Straßen der Gro»'
stadt wenig — erst draußen, in der Ebene, vor ge-
schneiten Bergen, konnte man ihrer gewahr werde»;
Verträumtes, schlesisches Winterland — die Hei»»
von Hauptmanns Märchen, Hauneles Heimat* *
ging mit tiefer Freude mit. Vor Weihnachten kon»
ich wieder in Berlin sein.
Auf der Fahrt war Hauptmann unruhig,
schlagen noch von all' den Strapazen, die ihm »,
Naturkampf mit dem Theater immer wieder bracht
In leiser Müdigkeit sah er jetzt auf den Sieg ä"
rück. Doch je näher wir der Heimat kamen, de!*
frischer wurde er, lebhastcr, launiger. Das Pate'
landskind, der treue, stark empfindende Schlei»
drang wieder in ihm durch, und eifrig sreute er!>
mit uns aus die Tage der Ruhe.
TiescrWinter rings umher. Verschneit und st»*»"!
lag Alles — feierlich, in stillem Einverständuiß !?!»,
es den heimkehrenden Dichter zu griißen. Er b»»
die Schönheit der Heimat gekündet — sie nwuj,
jetzt auf ihn und bot sich ihm zum dauernde»
sitz an.
Wir kamen in der Eisenbahn bis Petersdors ''
dann brachte uns ein Wagen die Chaussee cntla»w
zur Seite des Zackens, der unvcreist noch sch»'»
Silbcrbächlein über die moosigen Steine »’»!* '
nach Schreiberhau. Das Landhaus der Brüde
Hauptmann liegt im Mitteldorse, rechts von 5e.
CTftnuffep. nuf hpnt SSnrhfmih — frpi hott
Chaussee, auf dem Hochland — frei ist's dort
groß, ein prachtvoller Ausblick aus die ganze 1
birgskette gegeben. Jetzt war das Haus verlasse»'
Winterstille ringsumher. Nur die Verwalters!*»*
trafen wir an, denn Karl Hauptmann war verrc*U
Hell und klar tönten Gerharts Befehle durch
stillen Räume, alles war wohnlich sür uns herge**»
tet — wir fühlten uns rasch behaglich, thauten ***»
Es war Abend geworden. Im violetten MärcheNs
licht der Dämmerung lag die Ebene draußen, H**ä*
wellen, hell im Anstieg, dunkel in den Tiefe».
Schnee lag hart und rein — nur wenige Fnbstap*G
deuteten die Dorfstraße an, die an Haupt»*»»»
Haus vorübersührt. Und Menschen — wenig M°»
schen sahen wir, als wir zum Fenster Hinausblick* '
Kinder, eingemummt, mit rothen Bäckchen, stG*
zuweilen, die Beine starr herausgestreckt, aus Sä!**» r
vorüber. Zuweilen kam ein müder und zerlump.
Mann, ein zitterndes, kleines Mädchen an der
des Weges: — Pleschke, der Armenhäusler, H»»»^K
Maklern, des Himmels traumverlorene Braub „
dunkelte. Hauptmann trat vom Fenster zurück *
setzte sich zu Brahm, der sich's schon vorher a**> *
Sopha bequem gemacht hatte.
„Spiel' was, Hirschfeld."
1080