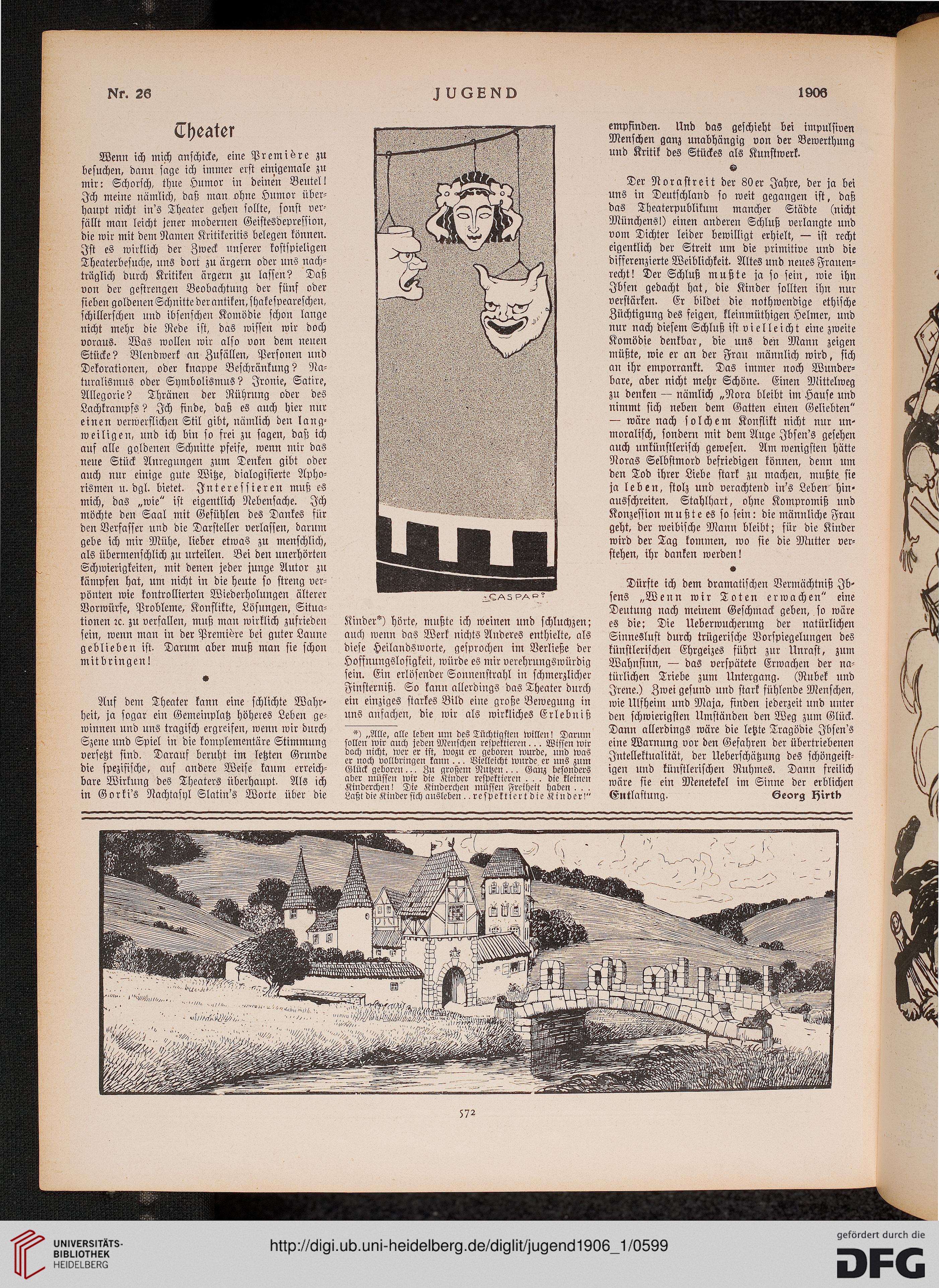Nr. 26
JUGEND
1900
Theater
Wenn ich mich anschicke, eine Premiere zu
besuchen, dann sage ich immer erst einigemale zu
mir: Schorsch, thue Humor in deinen Beutel!
Ich meine nämlich, daß man ohne Humor über-
haupt nicht in's Theater gehen sollte, sonst ver-
fällt man leicht jener modernen Geistesdepression,
die wir mit dem Namen Kritikeritis belegen können.
Ist es wirklich der Zweck unserer kostspieligen
Theaterbesuche, uns dort zu ärgern oder uns nach-
träglich durch Kritiken ärgern zu lassen? Daß
von der gestrengen Beobachtung der fünf oder
sieben goldenen Schnitte der antiken, shakespeareschen,
schillerschen und ibsenschen Komödie schon lange
nicht mehr die Rede ist, das wissen wir doch
voraus. Was wollen wir also von dem neuen
Stücke? Blendwerk an Zufällen, Personen und
Dekorationen, oder knappe Beschränkung? Na-
turalismus oder Symbolismus? Ironie, Satire,
Allegorie? Thränen der Rührung oder des
Lachkrampfs? Ich finde, daß es auch hier nur
einen verwerflichen Stil gibt, nämlich den lang-
weiligen, und ich bin so frei zu sagen, daß ich
auf alle goldenen Schnitte pfeife, wenn mir das
neue Stück Anregungen zum Denken gibt oder
auch nur einige gute Witze, dialogisierte Apho-
rismen u. dgl. bietet. Interessieren muß es
mich, das „wie" ist eigentlich Nebensache. Ich
möchte den Saal mit Gefühlen des Dankes für
den Verfasser und die Darsteller verlassen, darum
gebe ich mir Mühe, lieber etwas zu menschlich,
als übermenschlich zu urteilen. Bei den unerhörten
Schwierigkeiten, mit denen jeder junge Autor zu
kämpfen hat, um nicht in die heute so streng ver-
pönten wie kontrollierten Wiederholungen älterer
Vorwürfe, Probleme, Konflikte, Lösungen, Situa-
tionen re. zu verfallen, muß man wirklich zufrieden
sein, wenn man in der Premiere bei guter Laune
geblieben ist. Darum aber muß man sie schon
mitbringen!
»
Auf dem Theater kann eine schlichte Wahr-
heit, ja sogar ein Gemeinplatz höheres Leben ge-
winnen und uns tragisch ergreifen, wenn wir durch
Szene und Spiel in die komplementäre Stimmung
versetzt sind. Darauf beruht im letzten Grunde
die spezifische, auf andere Weise kaum erreich-
bare Wirkung des Theaters überhaupt. Als ich
in Gorki's Nachtasyl Slatin's Worte über die
juCAS PAP'
Kinder*) hörte, mußte ich weinen und schluchzen;
auch wenn das Werk nichts Anderes enthielte, als
diese Heilandsworte, gesprochen im Verließe der
Hoffnungslosigkeit, würde es mir verehrungswürdig
sein. Ein erlösender Sonnenstrahl in schmerzlicher
Finsterniß. So kann allerdings das Theater durch
ein einziges starkes Bild eine große Bewegung in
uns anfachen, die wir als wirkliches Erlebniß
*) „Alle, alle leben um des Tüchtigsten willen! Darum
sollen wir auch jeden Menschen respektieren... Wissen wir
doch nicht, wer er ist, wozu er geboren wurde, und was
er noch vollbringen kann ... Vielleicht wurde er uns zum
Glück geboren... Zu großem Nutzen... Ganz besonders
aber müssen wir die Kinder respektieren ... die kleinen
Kinderchen! Die Kinderchen müssen Freiheit haben. . .
Laßt die Kinder sich ausleben ..respektiert die Kinder!"
empfinden. Und das geschieht bei impulsiven
Menschen ganz unabhängig von der Bewerbung
und Kritik des Stückes als Kunstwerk.
€>
Der Norastreit der 80er Jahre, der ja bei
uns in Deutschland so weit gegangen ist, daß
das Theaterpublikum mancher Städte (nicht
Münchens!) einen anderen Schluß verlangte und
vom Dichter leider bewilligt erhielt, — ist recht
eigentlich der Streit um die primitive und die
differenzierte Weiblichkeit. Altes und neues Frauen-
recht! Der Schluß mußte ja so sein, wie ihn
Ibsen gedacht hat, die Kinder sollten ihn nur
verstärken. Er bildet die nothwendige ethische
Züchtigung des feigen, kleinmüthigen Helmer, und
nur nach diesem Schluß ist vielleicht eine zweite
Komödie denkbar, die uns den Mann zeigen
müßte, wie er an der Frau männlich wird, sich
an ihr emporrankt. Das immer noch Wunder-
bare, aber nicht mehr Schöne. Einen Mittelweg
zu denken -- nämlich „Nora bleibt im Hause und
nimmt sich neben dem Gatten einen Geliebten"
— wäre nach solchem Konflikt nicht nur un-
moralisch, sondern mit dem Auge Jbsen's gesehen
auch unkünstlerisch gewesen. Am wenigsten hätte
Noras Selbstmord befriedigen können, denn um
den Tod ihrer Liebe stark zu machen, mußte sie
ja leben, stolz und verachtend in's Leben hin-
ausschreiten. Stahlhart, ohne Kompromiß und
Konzession mußte es so sein: die männliche Frau
geht, der weibische Mann bleibt; für die Kinder
wird der Tag kommen, wo sie die Mutter ver-
stehen, ihr danken werden!
»
Dürfte ich dem dramatischen Vermächtniß Ib-
sens „Wenn wir Toten erwachen" eine
Deutung nach meinem Geschmack geben, so wäre
es die; Die Ueberwucherung der natürlichen
Sinneslust durch trügerische Vorspiegelungen des
künstlerischen Ehrgeizes führt zur Unrast, zum
Wahnsinn, — das verspätete Erwachen der na-
türlichen Triebe zum Untergang. (Rubek und
Irene.) Zwei gesund und stark fühlende Menschen,
wie Ulfheim und Maja, finden jederzeit und unter
den schwierigsten Umständen den Weg zum Glück.
Dann allerdings wäre die letzte Tragödie Jbsen's
eine Warnung vor den Gefahren der übertriebenen
Jntellektualität, der Ueberschätzung des schöngeist-
igen und künstlerischen Ruhmes. Dann freilich
wäre sie ein Menetekel im Sinne der erblichen
Entlastung. Georg Rirtb
572
JUGEND
1900
Theater
Wenn ich mich anschicke, eine Premiere zu
besuchen, dann sage ich immer erst einigemale zu
mir: Schorsch, thue Humor in deinen Beutel!
Ich meine nämlich, daß man ohne Humor über-
haupt nicht in's Theater gehen sollte, sonst ver-
fällt man leicht jener modernen Geistesdepression,
die wir mit dem Namen Kritikeritis belegen können.
Ist es wirklich der Zweck unserer kostspieligen
Theaterbesuche, uns dort zu ärgern oder uns nach-
träglich durch Kritiken ärgern zu lassen? Daß
von der gestrengen Beobachtung der fünf oder
sieben goldenen Schnitte der antiken, shakespeareschen,
schillerschen und ibsenschen Komödie schon lange
nicht mehr die Rede ist, das wissen wir doch
voraus. Was wollen wir also von dem neuen
Stücke? Blendwerk an Zufällen, Personen und
Dekorationen, oder knappe Beschränkung? Na-
turalismus oder Symbolismus? Ironie, Satire,
Allegorie? Thränen der Rührung oder des
Lachkrampfs? Ich finde, daß es auch hier nur
einen verwerflichen Stil gibt, nämlich den lang-
weiligen, und ich bin so frei zu sagen, daß ich
auf alle goldenen Schnitte pfeife, wenn mir das
neue Stück Anregungen zum Denken gibt oder
auch nur einige gute Witze, dialogisierte Apho-
rismen u. dgl. bietet. Interessieren muß es
mich, das „wie" ist eigentlich Nebensache. Ich
möchte den Saal mit Gefühlen des Dankes für
den Verfasser und die Darsteller verlassen, darum
gebe ich mir Mühe, lieber etwas zu menschlich,
als übermenschlich zu urteilen. Bei den unerhörten
Schwierigkeiten, mit denen jeder junge Autor zu
kämpfen hat, um nicht in die heute so streng ver-
pönten wie kontrollierten Wiederholungen älterer
Vorwürfe, Probleme, Konflikte, Lösungen, Situa-
tionen re. zu verfallen, muß man wirklich zufrieden
sein, wenn man in der Premiere bei guter Laune
geblieben ist. Darum aber muß man sie schon
mitbringen!
»
Auf dem Theater kann eine schlichte Wahr-
heit, ja sogar ein Gemeinplatz höheres Leben ge-
winnen und uns tragisch ergreifen, wenn wir durch
Szene und Spiel in die komplementäre Stimmung
versetzt sind. Darauf beruht im letzten Grunde
die spezifische, auf andere Weise kaum erreich-
bare Wirkung des Theaters überhaupt. Als ich
in Gorki's Nachtasyl Slatin's Worte über die
juCAS PAP'
Kinder*) hörte, mußte ich weinen und schluchzen;
auch wenn das Werk nichts Anderes enthielte, als
diese Heilandsworte, gesprochen im Verließe der
Hoffnungslosigkeit, würde es mir verehrungswürdig
sein. Ein erlösender Sonnenstrahl in schmerzlicher
Finsterniß. So kann allerdings das Theater durch
ein einziges starkes Bild eine große Bewegung in
uns anfachen, die wir als wirkliches Erlebniß
*) „Alle, alle leben um des Tüchtigsten willen! Darum
sollen wir auch jeden Menschen respektieren... Wissen wir
doch nicht, wer er ist, wozu er geboren wurde, und was
er noch vollbringen kann ... Vielleicht wurde er uns zum
Glück geboren... Zu großem Nutzen... Ganz besonders
aber müssen wir die Kinder respektieren ... die kleinen
Kinderchen! Die Kinderchen müssen Freiheit haben. . .
Laßt die Kinder sich ausleben ..respektiert die Kinder!"
empfinden. Und das geschieht bei impulsiven
Menschen ganz unabhängig von der Bewerbung
und Kritik des Stückes als Kunstwerk.
€>
Der Norastreit der 80er Jahre, der ja bei
uns in Deutschland so weit gegangen ist, daß
das Theaterpublikum mancher Städte (nicht
Münchens!) einen anderen Schluß verlangte und
vom Dichter leider bewilligt erhielt, — ist recht
eigentlich der Streit um die primitive und die
differenzierte Weiblichkeit. Altes und neues Frauen-
recht! Der Schluß mußte ja so sein, wie ihn
Ibsen gedacht hat, die Kinder sollten ihn nur
verstärken. Er bildet die nothwendige ethische
Züchtigung des feigen, kleinmüthigen Helmer, und
nur nach diesem Schluß ist vielleicht eine zweite
Komödie denkbar, die uns den Mann zeigen
müßte, wie er an der Frau männlich wird, sich
an ihr emporrankt. Das immer noch Wunder-
bare, aber nicht mehr Schöne. Einen Mittelweg
zu denken -- nämlich „Nora bleibt im Hause und
nimmt sich neben dem Gatten einen Geliebten"
— wäre nach solchem Konflikt nicht nur un-
moralisch, sondern mit dem Auge Jbsen's gesehen
auch unkünstlerisch gewesen. Am wenigsten hätte
Noras Selbstmord befriedigen können, denn um
den Tod ihrer Liebe stark zu machen, mußte sie
ja leben, stolz und verachtend in's Leben hin-
ausschreiten. Stahlhart, ohne Kompromiß und
Konzession mußte es so sein: die männliche Frau
geht, der weibische Mann bleibt; für die Kinder
wird der Tag kommen, wo sie die Mutter ver-
stehen, ihr danken werden!
»
Dürfte ich dem dramatischen Vermächtniß Ib-
sens „Wenn wir Toten erwachen" eine
Deutung nach meinem Geschmack geben, so wäre
es die; Die Ueberwucherung der natürlichen
Sinneslust durch trügerische Vorspiegelungen des
künstlerischen Ehrgeizes führt zur Unrast, zum
Wahnsinn, — das verspätete Erwachen der na-
türlichen Triebe zum Untergang. (Rubek und
Irene.) Zwei gesund und stark fühlende Menschen,
wie Ulfheim und Maja, finden jederzeit und unter
den schwierigsten Umständen den Weg zum Glück.
Dann allerdings wäre die letzte Tragödie Jbsen's
eine Warnung vor den Gefahren der übertriebenen
Jntellektualität, der Ueberschätzung des schöngeist-
igen und künstlerischen Ruhmes. Dann freilich
wäre sie ein Menetekel im Sinne der erblichen
Entlastung. Georg Rirtb
572