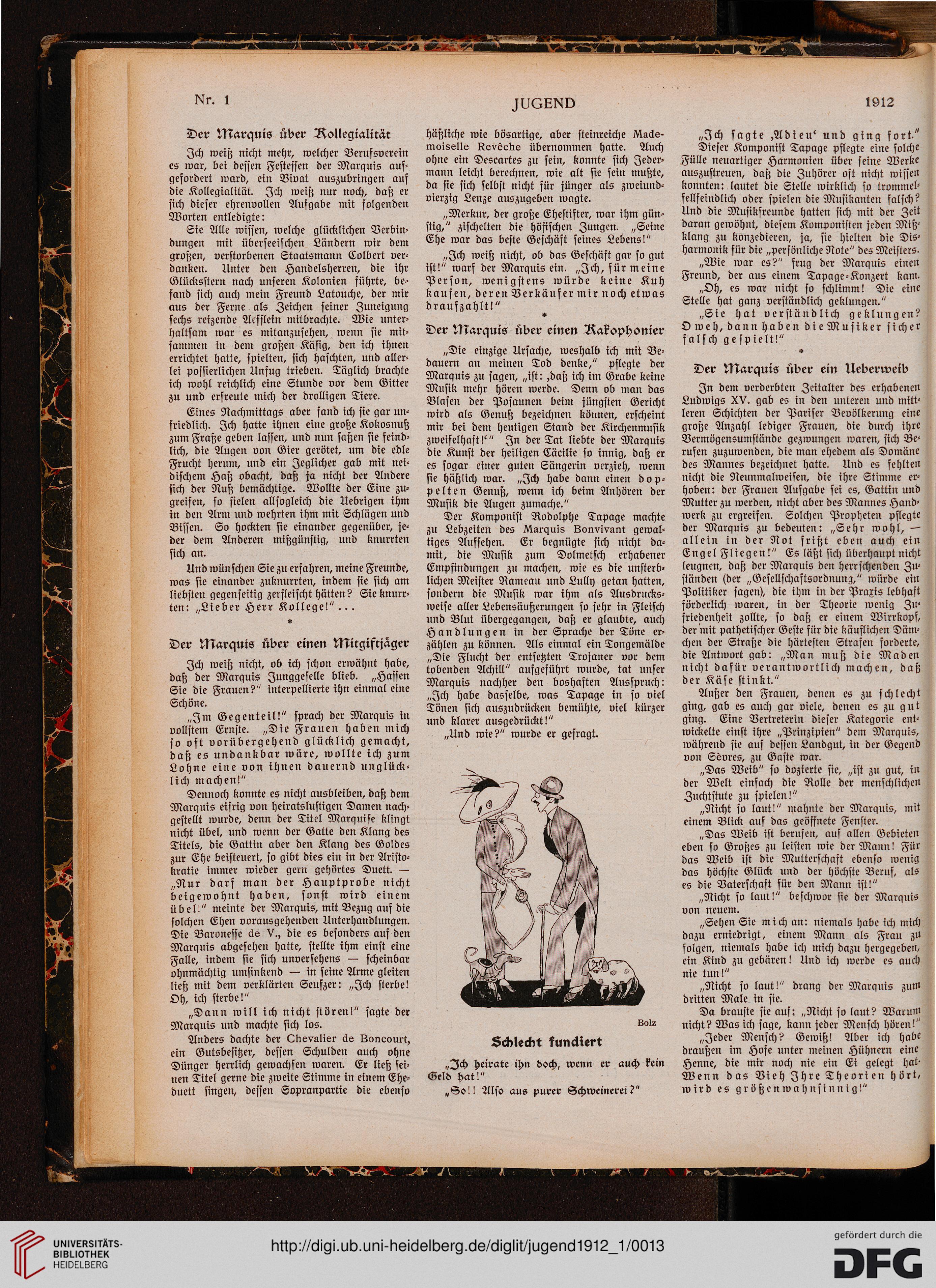Nr. 1
JUGEND
1912
Der Marquis über Rollegialirät
Ich weiß nicht mehr, welcher Berufsverein
es war, bei dessen Festessen der Marquis auf-
gefordert ward, ein Vivat auszubringen auf
die Kollegialität. Ich weiß nur noch, daß er
sich dieser ehrenvollen Aufgabe mit folgenden
Worten entledigte:
Sie Alle wissen, welche glücklichen Verbin-
dungen mit überseeischen Ländern wir dem
großen, verstorbenen Staatsmann Colbert ver-
danken. Unter den Handelsherren, die ihr
Glücksstern nach unseren Kolonien führte, be-
fand sich auch mein Freund Latouche, der mir
aus der Ferne als Zeichen seiner Zuneigung
sechs reizende Acfflein mitbrachte. Wie unter-
haltsam war es mitanzusehen, wenn sie mit-
sammen in dem großen Käfig, den ich ihnen
errichtet hatte, spielten, sich haschten, und aller-
lei possierlichen Unfug trieben. Täglich brachte
ich wohl reichlich eine Stunde vor dem Gitter
zu und erfreute mich der drolligen Tiere.
Eines Nachmittags aber fand ich sie gar un-
friedlich. Ich hatte ihnen eine große Kokosnuß
zum Fräße geben lassen, und nun saßen sie feind-
lich, die Augen von Gier gerötet, um die edle
Frucht herum, und ein Jeglicher gab mit nei-
dischem Haß obacht, daß ja nicht der Andere
sich der Nuß bemächtige. Wollte der Eine zu-
greifen, so fielen allsogleich die Uebrigen ihm
in den Arm und wehrten ihm mit Schlägen und
Bissen. So hockten sie einander gegenüber, je-
der dem Anderen mißgünstig, und knurrten
sich an.
Und wünschen Sie zu erfahren, meine Freunde,
was sie einander zuknurrten, indem sie sich am
liebsten gegenseitig zerfleischt hätten? Sie knurr-
ten: „Lieber Herr Kollege!" ...
Der Marquis über einen Mitgifrjager
Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe,
daß der Marquis Junggeselle blieb. „Hassen
Sie die Frauen?" interpellierte ihn einmal eine
Schöne.
„Im Gegenteill" sprach der Marquis in
vollstem Ernste. „Die Frauen haben mich
so oft vorübergehend glücklich gemacht,
daß es undankbar wäre, wollte ich zum
Lohne eine von ihnen dauernd unglück-
lich machen!"
Dennoch konnte es nicht ausbleiben, daß dem
Marquis eifrig von heiratslustigen Damen nach-
gestellt wurde, denn der Titel Marquise klingt
nicht übel, und wenn der Gatte den Klang des
Titels, die Gattin aber den Klang des Goldes
zur Ehe beisteuert, so gibt dies ein in der Aristo-
kratie immer wieder gern gehörtes Duett. —
„Nur darf man der Hauptprobe nicht
beigewohnt haben, sonst wird einem
übel!" meinte der Marquis, mit Bezug auf die
solchen Ehen vorausgehenden Unterhandlungen.
Die Baronesse äs V., die es besonders auf den
Marquis abgesehen hatte, stellte ihm einst eine
Falle, indem sie sich unversehens — scheinbar
ohnmächtig umsinkend — in seine Arme gleiten
ließ mit dem verklärten Seufzer: „Ich sterbe!
Oh, ich sterbe!"
„Dann will ich nicht stören!" sagte der
Marquis und machte sich los.
Anders dachte der Lksvalisr äs Bonoourt,
ein Gutsbesitzer, dessen Schulden auch ohne
Dünger herrlich gewachsen waren. Er ließ sei-
nen Titel gerne die zweite Stimme in einem Ehe-
duett singen, dessen Sopranpartie die ebenso
häßliche wie bösartige, aber steinreiche lVlaäs-
moisells Usvssks übernommen hatte. Auch
ohne ein Descartes zu sein, konnte sich Jeder-
mann leicht berechnen, wie alt sie sein mußte,
da sie sich selbst nicht für jünger als zweiund-
vierzig Lenze auszugeben wagte.
„Merkur, der große Ehestiftcr, war ihm gün-
stig," zischelten die höfischen Zungen. „Seine
Ehe war das beste Geschäft seines Lebens!"
„Ich weiß nicht, ob das Geschäft gar so gut
ist!" warf der Marquisein. „Ich, für meine
Person, wenigstens würde keine Kuh
kaufen, deren Verkäufer mir noch etwas
draufzahlt!"
Der Marquis über einen Rakophonier
„Die einzige Ursache, weshalb ich mit Be-
dauern an meinen Tod denke," pflegte der
Marquis zu sagen, „ist: ,daß ich im Grabe keine
Musik mehr hören werde. Denn ob man das
Blasen der Posaunen beim jüngsten Gericht
wird als Genuß bezeichnen können, erscheint
mir bei dem heutigen Stand der Kirchenmusik
zweifelhaft!" In der Tat liebte der Marquis
die Kunst der heiligen Cäcilie so innig, daß er
es sogar einer guten Sängerin verzieh, wenn
sie häßlich war. „Ich habe dann einen dop-
pelten Genuß, wenn ich beim Anhören der
Musik die Augen zumache."
Der Komponist Rodolphe Tapage machte
zu Lebzeiten des Marquis Bonvivant gewal-
tiges Aufsehen. Er begnügte sich nicht da-
mit, die Musik zum Dolmetsch erhabener
Empfindungen zu machen, wie es die unsterb-
lichen Meister Rameau und Lully getan hatten,
sondern die Musik war ihm als Ausdrucks-
weise aller Lebensäußerungen so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen, daß er glaubte, auch
Handlungen in der Sprache der Töne er-
zählen zu können. Als einmal ein Tongemälde
„Die Flucht der entsetzten Trojaner vor dem
tobenden Achill" aufgeführt wurde, tat unser
Marquis nachher den boshaften Ausspruch:
„Ich habe dasselbe, was Tapage in so viel
Tönen sich auszudrücken bemühte, viel kürzer
und klarer ausgedrllckt!"
„Und wie?" wurde er gefragt.
„Ick heirate ihn doch, wenn er auch kein
Geld hat!"
„Sol! Also aus purer Schweinerei?"
„Ich sagte ,Adieu° und ging fort."
Dieser Komponist Tapage pflegte eine solche
Fülle neuartiger Harmonien über seine Werke
auszustreuen, daß die Zuhörer oft nicht wissen
konnten: lautet die Stelle wirklich so trommel-
fellfeindlich oder spielen die Musikanten falsch?
Und die Musikfreunde hatten sich mit der Zeit
daran gewöhnt, diesem Komponisten jeden Miß-
klang zu konzedieren, ja, sie hielten die Dis-
harmonik für die „persönliche Note" des Meisters.
„Wie war es?" frug der Marquis einen
Freund, der aus einem Tapage-Konzert kam-
„Oh, es war nicht so schlimm! Die eine
Stelle hat ganz verständlich geklungen."
„Sie hat verständlich geklungen?
O weh, dann haben die Musiker sicher
falsch gespielt!"
Der Marquis über ein Ueberweib
In dem verderbten Zeitalter des erhabenen
Ludwigs XV. gab es in den unteren und mitt-
leren Schichten der Pariser Bevölkerung eine
große Anzahl lediger Frauen, die durch ihre
Vermögensumstände gezwungen waren, sich Be-
rufen zuzuwenden, die man ehedem als Domäne
des Mannes bezeichnet hatte. Und es fehlten
nicht die Neunmalweisen, die ihre Stimme er-
hoben: der Frauen Aufgabe sei es, Gattin und
Mutter zu werden, nicht aber des Mannes Hand-
werk zu ergreifen. Solchen Propheten pflegte
der Marquis zu bedeuten: „Sehr wohl, —
allein in der Not frißt eben auch ein
Engel Fliegen!" Es läßt sich überhaupt nicht
leugnen, daß der Marquis den herrschenden Zu-
ständen (der „Gesellschaftsordnung," würde ein
Politiker sagen), die ihm in der Praxis lebhaft
förderlich waren, in der Theorie wenig Zu-
friedenheit zollte, so daß er einem Wirrkops,
ber mit pathetischer Geste für die käuflichen Däm-
chen der Straße die härtesten Strafen forderte,
die Antwort gab: „Man mutz die Maden
nicht dafür verantwortlich machen, daß
der Käse stinkt."
Außer den Frauen, denen es zu schlecht
ging, gab es auch gar viele, denen es zu gut
ging. Eine Vertreterin dieser Kategorie ent-
wickelte einst ihre „Prinzipien" dem Marquis,
während sie auf dessen Landgut, in der Gegend
von Sevres, zu Gaste war.
„Das Weib" so dozierte sie, „ist zu gut, in
der Welt einfach die Rolle der menschlichen
Zuchtstute zu spielen!"
„Nicht so laut!" mahnte der Marquis, mit
einem Blick auf das geöffnete Fenster.
„Das Weib ist berufen, auf allen Gebieten
eben so Großes zu leisten wie der Mann! Für
das Weib ist die Mutterschaft ebenso wenig
das höchste Glück und der höchste Beruf, als
es die Vaterschaft für den Mann ist!"
„Nicht so laut!" beschwor sie der Marquis
von neuem.
„Sehen Sie mich an: niemals habe ich mich
dazu erniedrigt, einem Mann als Frau z»
folgen, niemals habe ich mich dazu hergegeben,
ein Kind zu gebären! Und ich werde es auch
nie tun!"
„Nicht so laut!" drang der Marquis zum
dritten Male in sie.
Da brauste sie auf: „Nicht so laut? Warum
nicht? Was ich sage, kann jeder Mensch hören!"
„Jeder Mensch? Gewiß! Aber ich habe
draußen im Hofe unter meinen Hühnern eine
Henne, die mir noch nie ein Et gelegt hat-
Wenn das Vieh Ihre Theorien hört,
wird es größenwahnsinnig!"
JUGEND
1912
Der Marquis über Rollegialirät
Ich weiß nicht mehr, welcher Berufsverein
es war, bei dessen Festessen der Marquis auf-
gefordert ward, ein Vivat auszubringen auf
die Kollegialität. Ich weiß nur noch, daß er
sich dieser ehrenvollen Aufgabe mit folgenden
Worten entledigte:
Sie Alle wissen, welche glücklichen Verbin-
dungen mit überseeischen Ländern wir dem
großen, verstorbenen Staatsmann Colbert ver-
danken. Unter den Handelsherren, die ihr
Glücksstern nach unseren Kolonien führte, be-
fand sich auch mein Freund Latouche, der mir
aus der Ferne als Zeichen seiner Zuneigung
sechs reizende Acfflein mitbrachte. Wie unter-
haltsam war es mitanzusehen, wenn sie mit-
sammen in dem großen Käfig, den ich ihnen
errichtet hatte, spielten, sich haschten, und aller-
lei possierlichen Unfug trieben. Täglich brachte
ich wohl reichlich eine Stunde vor dem Gitter
zu und erfreute mich der drolligen Tiere.
Eines Nachmittags aber fand ich sie gar un-
friedlich. Ich hatte ihnen eine große Kokosnuß
zum Fräße geben lassen, und nun saßen sie feind-
lich, die Augen von Gier gerötet, um die edle
Frucht herum, und ein Jeglicher gab mit nei-
dischem Haß obacht, daß ja nicht der Andere
sich der Nuß bemächtige. Wollte der Eine zu-
greifen, so fielen allsogleich die Uebrigen ihm
in den Arm und wehrten ihm mit Schlägen und
Bissen. So hockten sie einander gegenüber, je-
der dem Anderen mißgünstig, und knurrten
sich an.
Und wünschen Sie zu erfahren, meine Freunde,
was sie einander zuknurrten, indem sie sich am
liebsten gegenseitig zerfleischt hätten? Sie knurr-
ten: „Lieber Herr Kollege!" ...
Der Marquis über einen Mitgifrjager
Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe,
daß der Marquis Junggeselle blieb. „Hassen
Sie die Frauen?" interpellierte ihn einmal eine
Schöne.
„Im Gegenteill" sprach der Marquis in
vollstem Ernste. „Die Frauen haben mich
so oft vorübergehend glücklich gemacht,
daß es undankbar wäre, wollte ich zum
Lohne eine von ihnen dauernd unglück-
lich machen!"
Dennoch konnte es nicht ausbleiben, daß dem
Marquis eifrig von heiratslustigen Damen nach-
gestellt wurde, denn der Titel Marquise klingt
nicht übel, und wenn der Gatte den Klang des
Titels, die Gattin aber den Klang des Goldes
zur Ehe beisteuert, so gibt dies ein in der Aristo-
kratie immer wieder gern gehörtes Duett. —
„Nur darf man der Hauptprobe nicht
beigewohnt haben, sonst wird einem
übel!" meinte der Marquis, mit Bezug auf die
solchen Ehen vorausgehenden Unterhandlungen.
Die Baronesse äs V., die es besonders auf den
Marquis abgesehen hatte, stellte ihm einst eine
Falle, indem sie sich unversehens — scheinbar
ohnmächtig umsinkend — in seine Arme gleiten
ließ mit dem verklärten Seufzer: „Ich sterbe!
Oh, ich sterbe!"
„Dann will ich nicht stören!" sagte der
Marquis und machte sich los.
Anders dachte der Lksvalisr äs Bonoourt,
ein Gutsbesitzer, dessen Schulden auch ohne
Dünger herrlich gewachsen waren. Er ließ sei-
nen Titel gerne die zweite Stimme in einem Ehe-
duett singen, dessen Sopranpartie die ebenso
häßliche wie bösartige, aber steinreiche lVlaäs-
moisells Usvssks übernommen hatte. Auch
ohne ein Descartes zu sein, konnte sich Jeder-
mann leicht berechnen, wie alt sie sein mußte,
da sie sich selbst nicht für jünger als zweiund-
vierzig Lenze auszugeben wagte.
„Merkur, der große Ehestiftcr, war ihm gün-
stig," zischelten die höfischen Zungen. „Seine
Ehe war das beste Geschäft seines Lebens!"
„Ich weiß nicht, ob das Geschäft gar so gut
ist!" warf der Marquisein. „Ich, für meine
Person, wenigstens würde keine Kuh
kaufen, deren Verkäufer mir noch etwas
draufzahlt!"
Der Marquis über einen Rakophonier
„Die einzige Ursache, weshalb ich mit Be-
dauern an meinen Tod denke," pflegte der
Marquis zu sagen, „ist: ,daß ich im Grabe keine
Musik mehr hören werde. Denn ob man das
Blasen der Posaunen beim jüngsten Gericht
wird als Genuß bezeichnen können, erscheint
mir bei dem heutigen Stand der Kirchenmusik
zweifelhaft!" In der Tat liebte der Marquis
die Kunst der heiligen Cäcilie so innig, daß er
es sogar einer guten Sängerin verzieh, wenn
sie häßlich war. „Ich habe dann einen dop-
pelten Genuß, wenn ich beim Anhören der
Musik die Augen zumache."
Der Komponist Rodolphe Tapage machte
zu Lebzeiten des Marquis Bonvivant gewal-
tiges Aufsehen. Er begnügte sich nicht da-
mit, die Musik zum Dolmetsch erhabener
Empfindungen zu machen, wie es die unsterb-
lichen Meister Rameau und Lully getan hatten,
sondern die Musik war ihm als Ausdrucks-
weise aller Lebensäußerungen so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen, daß er glaubte, auch
Handlungen in der Sprache der Töne er-
zählen zu können. Als einmal ein Tongemälde
„Die Flucht der entsetzten Trojaner vor dem
tobenden Achill" aufgeführt wurde, tat unser
Marquis nachher den boshaften Ausspruch:
„Ich habe dasselbe, was Tapage in so viel
Tönen sich auszudrücken bemühte, viel kürzer
und klarer ausgedrllckt!"
„Und wie?" wurde er gefragt.
„Ick heirate ihn doch, wenn er auch kein
Geld hat!"
„Sol! Also aus purer Schweinerei?"
„Ich sagte ,Adieu° und ging fort."
Dieser Komponist Tapage pflegte eine solche
Fülle neuartiger Harmonien über seine Werke
auszustreuen, daß die Zuhörer oft nicht wissen
konnten: lautet die Stelle wirklich so trommel-
fellfeindlich oder spielen die Musikanten falsch?
Und die Musikfreunde hatten sich mit der Zeit
daran gewöhnt, diesem Komponisten jeden Miß-
klang zu konzedieren, ja, sie hielten die Dis-
harmonik für die „persönliche Note" des Meisters.
„Wie war es?" frug der Marquis einen
Freund, der aus einem Tapage-Konzert kam-
„Oh, es war nicht so schlimm! Die eine
Stelle hat ganz verständlich geklungen."
„Sie hat verständlich geklungen?
O weh, dann haben die Musiker sicher
falsch gespielt!"
Der Marquis über ein Ueberweib
In dem verderbten Zeitalter des erhabenen
Ludwigs XV. gab es in den unteren und mitt-
leren Schichten der Pariser Bevölkerung eine
große Anzahl lediger Frauen, die durch ihre
Vermögensumstände gezwungen waren, sich Be-
rufen zuzuwenden, die man ehedem als Domäne
des Mannes bezeichnet hatte. Und es fehlten
nicht die Neunmalweisen, die ihre Stimme er-
hoben: der Frauen Aufgabe sei es, Gattin und
Mutter zu werden, nicht aber des Mannes Hand-
werk zu ergreifen. Solchen Propheten pflegte
der Marquis zu bedeuten: „Sehr wohl, —
allein in der Not frißt eben auch ein
Engel Fliegen!" Es läßt sich überhaupt nicht
leugnen, daß der Marquis den herrschenden Zu-
ständen (der „Gesellschaftsordnung," würde ein
Politiker sagen), die ihm in der Praxis lebhaft
förderlich waren, in der Theorie wenig Zu-
friedenheit zollte, so daß er einem Wirrkops,
ber mit pathetischer Geste für die käuflichen Däm-
chen der Straße die härtesten Strafen forderte,
die Antwort gab: „Man mutz die Maden
nicht dafür verantwortlich machen, daß
der Käse stinkt."
Außer den Frauen, denen es zu schlecht
ging, gab es auch gar viele, denen es zu gut
ging. Eine Vertreterin dieser Kategorie ent-
wickelte einst ihre „Prinzipien" dem Marquis,
während sie auf dessen Landgut, in der Gegend
von Sevres, zu Gaste war.
„Das Weib" so dozierte sie, „ist zu gut, in
der Welt einfach die Rolle der menschlichen
Zuchtstute zu spielen!"
„Nicht so laut!" mahnte der Marquis, mit
einem Blick auf das geöffnete Fenster.
„Das Weib ist berufen, auf allen Gebieten
eben so Großes zu leisten wie der Mann! Für
das Weib ist die Mutterschaft ebenso wenig
das höchste Glück und der höchste Beruf, als
es die Vaterschaft für den Mann ist!"
„Nicht so laut!" beschwor sie der Marquis
von neuem.
„Sehen Sie mich an: niemals habe ich mich
dazu erniedrigt, einem Mann als Frau z»
folgen, niemals habe ich mich dazu hergegeben,
ein Kind zu gebären! Und ich werde es auch
nie tun!"
„Nicht so laut!" drang der Marquis zum
dritten Male in sie.
Da brauste sie auf: „Nicht so laut? Warum
nicht? Was ich sage, kann jeder Mensch hören!"
„Jeder Mensch? Gewiß! Aber ich habe
draußen im Hofe unter meinen Hühnern eine
Henne, die mir noch nie ein Et gelegt hat-
Wenn das Vieh Ihre Theorien hört,
wird es größenwahnsinnig!"