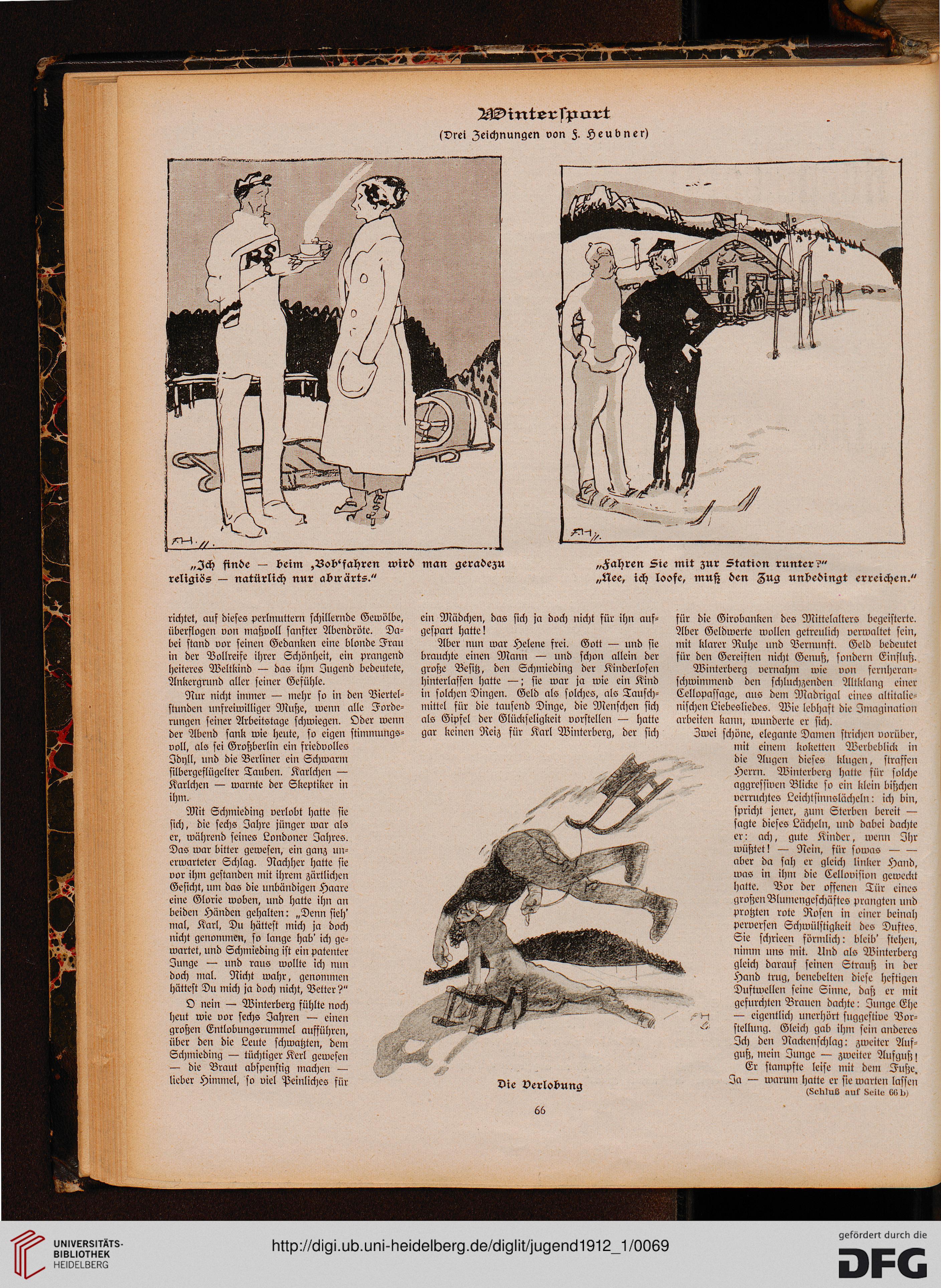ADinterrspsrrt
(Drei Zeichnungen von Z. Heubner)
^ //■
„Ich finde — beim ,Bobfahren wird man geradezu
religiös — natürlich nur abwärts."
„Fahren Sie mit zur Station runter?"
„Nee, ich loofe, muß den Zug unbedingt erreichen."
richtet, auf dieses perlmuttern schillernde Gewölbe,
überflogen von maßvoll sanfter Abendröte. Da-
bei stand vor seinen Gedanken eine blonde Frau
in der Vollreife ihrer Schönheit, ein prangend
heiteres Weltkind — das ihm Jugend bedeutete,
Ankergrund aller seiner Gefühle.
Nur nicht immer — mehr so in den Viertel-
stunden unfreiwilliger Muße, wenn alle Forde-
rungen seiner Arbeitstage schwiegen. Oder wenn
der Abend sank wie heute, so eigen stimmungs-
voll, als sei Großberlin ein friedvolles
Idyll, und die Berliner ein Schwarm
silbergeflügelter Tauben. Karlchen —
Karlchen — warnte der Skeptiker in
ihm.
Mit Schmieding verlobt hatte sie
sich, die sechs Jahre jünger war als
er, während seines Londoner Jahres.
Das war bitter gewesen, ein ganz un-
erwarteter Schlag. Nachher hatte sie
vor ihm gestanden mit ihrem zärtlichen
Gesicht, um das die unbändigen Haare
eine Glorie woben, und hatte ihn an
beiden Händen gehalten: „Denn sieh'
mal, Karl, Du hättest mich ja doch
nicht genommen, so lange Hab' ich ge-
wartet, und Schmieding ist ein patenter
Junge — und raus wollte ich nun
doch mal. Nicht wahr, genomnien
hättest Du mich ja doch nicht, Vetter?"
O nein — Winterberg fühlte noch
heut wie vor sechs Jahren — einen
großen Entlobungsrummel aufführen,
über den die Leute schwatzten, dem
Schmieding — tüchtiger Kerl gewesen
— die Braut abspenstig machen —
lieber Himmel, so viel Peinliches für
du Mädchen, das sich ja doch nicht für ihn auf-
gespart hatte!
Aber nun war Helene frei. Gott — und sie
brauchte einen Mann — und schon allein der
große Besitz, den Schmieding der Kinderlosen
hinterlassen hatte —; sie war ja wie ein Kind
in solchen Dingen. Geld als solches, als Tausch-
mittel für die tausend Dinge, die Menschen sich
als Gipfel der Glückseligkeit vorstellen — hatte
gar keinen Reiz für Karl Winterberg, der sich
Die Verlobung
für die Girobanken des Mittelalters begeisterte.
Aber Geldwerte wollen getreulich verwaltet sein,
mit klarer Ruhe und Vernunft. Geld bedeutet
für den Gereiften nicht Genuß, sondern Einfluß.
Winterberg vernahm wie von fernheran-
schwimmend den schluchzenden Altklang einer
Cellopassage, aus dem Madrigal eines altitalie-
nischen Liebesliedes. Wie lebhaft die Imagination
arbeiten kann, wunderte er sich.
Zwei schöne, elegante Damen strichen vorüber,
mit einem koketten Werbeblick in
die Augen dieses klugen, straffen
Herrn. Winterberg hatte für solche
aggressiven Blicke so ein klein bißchen
verruchtes Leichtsinnslächeln: ich bin,
spricht jener, zum Sterben bereit —
sagte dieses Lächeln, und dabei dachte
er: ach, gute Kinder, wenn Ihr
wüßtet! — Nein, für sowas — —
aber da sah er gleich linker Hand,
was in ihm die Cellovision geweckt
hatte. Bor der offenen Tür eines
großen Blumengeschäftes prangten und
protzten rote Rosen in einer beinah
perversen Schwülstigkeit des Duftes.
Sie schrieen förmlich: bleib' stehen,
nimm uns nnt. Und als Winterberg
gleich darauf seinen Strauß in der
Hand trug, benebelten diese heftigen
Duftwellen seine Sinne, daß er mit
gefurchten Brauen dachte: Junge Ehe
H — eigentlich unerhört suggestive Bor-
^ stellung. Gleich gab ihm sein anderes
Ich den Nackenschlag: zweiter Auf-
guß, mein Junge — zweiter Aufguß,
Er stampfte leise mit dem Fuße.
Ja — warum hatte er sie warten lasset,
(Schluß auf Seite GGb)
66
(Drei Zeichnungen von Z. Heubner)
^ //■
„Ich finde — beim ,Bobfahren wird man geradezu
religiös — natürlich nur abwärts."
„Fahren Sie mit zur Station runter?"
„Nee, ich loofe, muß den Zug unbedingt erreichen."
richtet, auf dieses perlmuttern schillernde Gewölbe,
überflogen von maßvoll sanfter Abendröte. Da-
bei stand vor seinen Gedanken eine blonde Frau
in der Vollreife ihrer Schönheit, ein prangend
heiteres Weltkind — das ihm Jugend bedeutete,
Ankergrund aller seiner Gefühle.
Nur nicht immer — mehr so in den Viertel-
stunden unfreiwilliger Muße, wenn alle Forde-
rungen seiner Arbeitstage schwiegen. Oder wenn
der Abend sank wie heute, so eigen stimmungs-
voll, als sei Großberlin ein friedvolles
Idyll, und die Berliner ein Schwarm
silbergeflügelter Tauben. Karlchen —
Karlchen — warnte der Skeptiker in
ihm.
Mit Schmieding verlobt hatte sie
sich, die sechs Jahre jünger war als
er, während seines Londoner Jahres.
Das war bitter gewesen, ein ganz un-
erwarteter Schlag. Nachher hatte sie
vor ihm gestanden mit ihrem zärtlichen
Gesicht, um das die unbändigen Haare
eine Glorie woben, und hatte ihn an
beiden Händen gehalten: „Denn sieh'
mal, Karl, Du hättest mich ja doch
nicht genommen, so lange Hab' ich ge-
wartet, und Schmieding ist ein patenter
Junge — und raus wollte ich nun
doch mal. Nicht wahr, genomnien
hättest Du mich ja doch nicht, Vetter?"
O nein — Winterberg fühlte noch
heut wie vor sechs Jahren — einen
großen Entlobungsrummel aufführen,
über den die Leute schwatzten, dem
Schmieding — tüchtiger Kerl gewesen
— die Braut abspenstig machen —
lieber Himmel, so viel Peinliches für
du Mädchen, das sich ja doch nicht für ihn auf-
gespart hatte!
Aber nun war Helene frei. Gott — und sie
brauchte einen Mann — und schon allein der
große Besitz, den Schmieding der Kinderlosen
hinterlassen hatte —; sie war ja wie ein Kind
in solchen Dingen. Geld als solches, als Tausch-
mittel für die tausend Dinge, die Menschen sich
als Gipfel der Glückseligkeit vorstellen — hatte
gar keinen Reiz für Karl Winterberg, der sich
Die Verlobung
für die Girobanken des Mittelalters begeisterte.
Aber Geldwerte wollen getreulich verwaltet sein,
mit klarer Ruhe und Vernunft. Geld bedeutet
für den Gereiften nicht Genuß, sondern Einfluß.
Winterberg vernahm wie von fernheran-
schwimmend den schluchzenden Altklang einer
Cellopassage, aus dem Madrigal eines altitalie-
nischen Liebesliedes. Wie lebhaft die Imagination
arbeiten kann, wunderte er sich.
Zwei schöne, elegante Damen strichen vorüber,
mit einem koketten Werbeblick in
die Augen dieses klugen, straffen
Herrn. Winterberg hatte für solche
aggressiven Blicke so ein klein bißchen
verruchtes Leichtsinnslächeln: ich bin,
spricht jener, zum Sterben bereit —
sagte dieses Lächeln, und dabei dachte
er: ach, gute Kinder, wenn Ihr
wüßtet! — Nein, für sowas — —
aber da sah er gleich linker Hand,
was in ihm die Cellovision geweckt
hatte. Bor der offenen Tür eines
großen Blumengeschäftes prangten und
protzten rote Rosen in einer beinah
perversen Schwülstigkeit des Duftes.
Sie schrieen förmlich: bleib' stehen,
nimm uns nnt. Und als Winterberg
gleich darauf seinen Strauß in der
Hand trug, benebelten diese heftigen
Duftwellen seine Sinne, daß er mit
gefurchten Brauen dachte: Junge Ehe
H — eigentlich unerhört suggestive Bor-
^ stellung. Gleich gab ihm sein anderes
Ich den Nackenschlag: zweiter Auf-
guß, mein Junge — zweiter Aufguß,
Er stampfte leise mit dem Fuße.
Ja — warum hatte er sie warten lasset,
(Schluß auf Seite GGb)
66