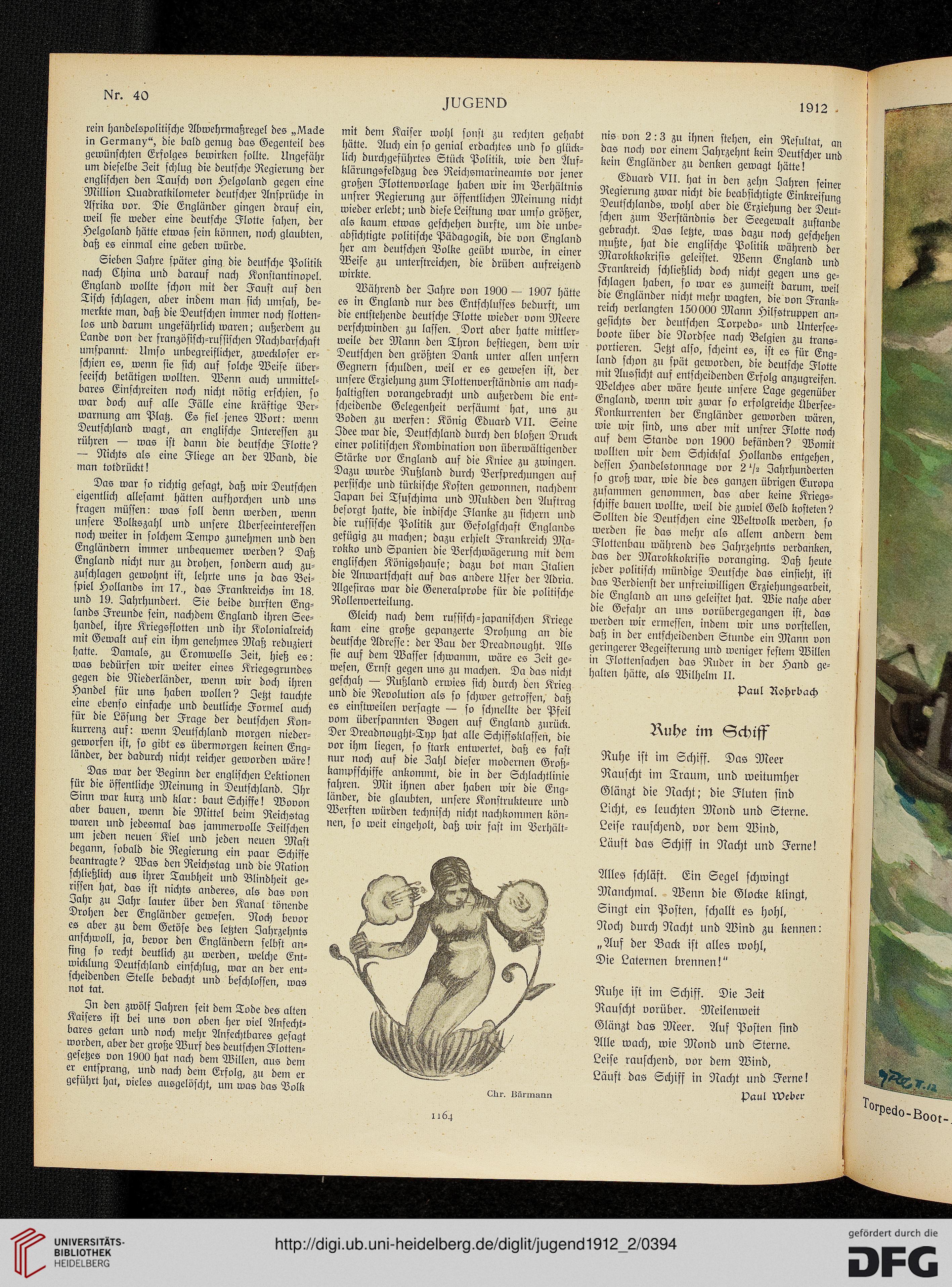Nr. 40
JUGEND
1912
rein handelspolitische Abwehrmaßregel des „Made
in Germany“, die bald genug das Gegenteil des
gewünschten Erfolges bewirken sollte. Ungefähr
um dieselbe Zeit schlug die deutsche Regierung der
englischen den Tausch von Helgoland gegen eine
Million Quadratkilometer deutscher Ansprüche in
Afrika vor. Die Engländer gingen drauf ein,
weil sie weder eine deutsche Flotte sahen, der
Helgoland hätte etwas sein können, noch glaubten,
daß es einmal eine geben würde.
Sieben Zahre später ging die deutsche Politik
nach China und darauf nach Konstantinopel.
England wollte schon mit der Faust auf den
Tisch schlagen, aber indem man sich umsah, be-
merkte man, daß die Deutschen immer noch flotten-
los und darum ungefährlich waren; außerdem zu
Lande von der französisch-russischen Nachbarschaft
umspannt. Umso unbegreiflicher, zweckloser er-
schien es, wenn sie sich auf solche Weise über-
seeisch betätigen wollten. Wenn auch unmittel-
bares Einschreiten noch nicht nötig erschien, so
war doch auf alle Fälle eine kräftige Ver-
warnung am Platz. Es siel jenes Wort: wenn
Deutschland wagt, an englische Interessen zu
rühren — was ist dann die deutsche Flotte?
— Nichts als eine Fliege an der Wand, die
man totbrückt!
Das war so richtig gesagt, daß wir Deutschen
eigentlich allesamt hätten aufhorchen und uns
fragen müssen: was soll denn werden, wenn
unsere Volkszahl und unsere Überseeinteressen
noch weiter in solchem Tempo zunehmen und den
Engländern immer unbequemer werden? Daß
England nicht nur zu drohen, sondern auch zu-
zuschlagen gewohnt ist, lehrte uns ja das Bei-
spiel Hollands im 17., das Frankreichs im 18.
und 19. Jahrhundert. Sie beide durften Eng-
lands Freunde sein, nachdem England ihren See-
handel, ihre Kriegsflotten und ihr Kolonialreich
mit Gewalt auf ein ihm genehmes Maß reduziert
hatte. Damals, zu Cromwells Zeit, hieß es:
was bedürfen wir weiter eines Kriegsgrundes
gegen die Niederländer, wenn wir doch ihren
Handel für uns haben wollen? Jetzt tauchte
eine ebenso einfache und deutliche Formel auch
für die Lösung der Frage der deutschen Kon-
kurrenz auf: wenn Deutschland morgen nieder-
geworfen ist, so gibt es übermorgen keinen Eng-
länder, der dadurch nicht reicher geworden wäre!
Das war der Beginn der englischen Lektionen
für die öffentliche Meinung in Deutschland. Ihr
Sinn war kurz und klar: baut Schiffe! Wovon
aber bauen, wenn die Mittel beim Reichstag
waren und jedesmal das jammervolle Feilschen
um jeden neuen Kiel und jeden neuen Mast
begann, sobald die Regierung ein paar Schiffe
beantragte? Was den Reichstag und die Nation
schließlich aus ihrer Taubheit und Blindheit ge-
rissen hat, das ist nichts anderes, als das von
Jahr zu Jahr lauter über den Kanal tönende
Drohen der Engländer gewesen. Noch bevor
es aber zu dem Getöse des letzten Jahrzehnts
anschwoll, ja, bevor den Engländern selbst an-
fing so recht deutlich zu werden, welche Ent-
wicklung Deutschland einschlug, war an der ent-
scheidenden Stelle bedacht und beschlossen, was
not tat.
In den zwölf Jahren seit dem Tode des alten
Kaisers ist bei uns von oben her viel Anfecht-
bares getan und noch mehr Anfechtbares gesagt
worden, aber der große Wurf des deutschen Flotten-
gesetzes von 1900 hat nach dem Willen, aus dem
er entsprang, und nach dem Erfolg, zu dem er
geführt hat, vieles ausgelöscht, um was das Volk
mit dem Kaiser wohl sonst zu rechten gehabt
hätte. Auch ein so genial erdachtes und so glück-
lich durchgeführtes Stück Politik, wie den Auf-
klärungsfeldzug des Reichsmarineamts vor jener
großeil Flottenvorlage haben wir im Verhältnis
unsrer Regierung zur öffentlichen Meinung nicht
wieder erlebt; und diese Leistung war umso größer,
als kaum etwas geschehen durfte, um die unbe-
absichtigte politische Pädagogik, die von England
her am deutschen Volke geübt wurde, in einer
Weise zu unterstreichen, die drüben aufreizend
wirkte.
Während der Jahre von 1900 — 1907 hätte
es in England nur des Entschlusses beburft, um
die entstehende deutsche Flotte wieder vom Meere
verschwinden zu lassen. Dort aber hatte mittler-
weile der Mann den Thron bestiegen, dem wir
Deutschen den größten Dank unter allen unfern
Gegnern schulden, weil er es gewesen ist, der
unsere Erziehung zum Flottenverständnis am nach-
haltigsten vorangebracht und außerdem die ent-
scheidende Gelegenheit versäumt hat, uns zu
Boden zu werfen: König Eduard VII. Seine
Idee war die, Deutschland durch den bloßen Druck
einer politischen Kombination von überwältigender
Stärke vor England auf die Kniee zu zwingen.
Dazu wurde Rußland durch Versprechungen auf
persische und türkische Kosten gewonnen, nachdem
Japan bei Tsuschima und Mukden den Auftrag
besorgt hatte, die indische Flanke zu sichern und
die russische Politik zur Gefolgschaft Englands
gefügig zu machen; dazu erhielt Frankreich Ma-
rokko und Spanien die Verschwägerung mit dem
englischen Königshause; dazu bot man Italien
die Anwartschaft auf das andere Ufer der Adria.
Algefiras war die Generalprobe für die politische
Rollenverteilung.
Gleich nach dem russisch-japanischen Kriege
kam eine große gepanzerte Drohung an die
deutsche Adresse: der Bau der Dreadnought. Als
sie auf dem Wasser schwamm, wäre es Zeit ge-
wesen, Ernst gegen uns zu machen. Da das nicht
geschah — Rußland erwies sich durch den Krieg
und die Revolution als so schwer getroffen, daß
es einstweilen versagte — so schnellte der Pfeil
vom überspannten Bogen auf England zurück.
Der Dreadnought-Typ hat alle Schifssklassen, die
vor ihm liegen, so stark entwertet, daß es fast
nur noch auf die Zahl dieser modernen Groß-
kampfschiffe ankommt, die in der Schlachtlinie
fahren. Mit ihnen aber Ijaben wir die Eng-
länder, die glaubten, unsere Konstrukteure und
Werften würden technisch nicht nachkommen kön-
nen, so weit eingeholt, daß wir fast im Verhält-
Clir. Bärmann
ms von 2:3 zu ihnen stehen, ein Resultat, an
das noch vor einem Jahrzehnt kein Deutscher und
kein Engländer zu denken gewagt hätte!
Eduard VII. hat in den zehn Jahren seiner
Regierung zwar nicht die beabsichtigte Einkreisung
Deutschlands, wohl aber die Erziehung der Deut-
schen zum Verständnis der Seegewalt zustande
gebracht. Das letzte, was dazu noch geschehen
mußte, hat die englische Politik während der
Marokkokrisis geleistet. Wenn England und
Frankreich schließlich doch nicht gegen uns ge-
schlagen haben, so war es zumeist darum, weil
die Engländer nicht mehr wagten, die von Frank-
reich verlangten 150000 Mann Hilfstruppen an-
gesichts der deutschen Torpedo- und Untersee-
boote über die Nordsee nach Belgien zu trans-
portieren. Jetzt also, scheint es, ist es für Eng-
land schon zu spät geworden, die deutsche Flotte
mit Aussicht auf entscheidenden Erfolg anzugreifen.
Welches aber wäre heute unsere Lage gegenüber
England, wenn wir zwar so erfolgreiche Übersee-
Konkurrenten der Engländer geworden wären,
wie wir sind, uns aber mit unsrer Flotte noch
auf dem Stande von 1900 befänden? Womit
wollten wir dem Schicksal Hollands entgehen,
beffen Handelstonnage vor 2 A/a Jahrhunderten
so groß mar, wie die des ganzen übrigen Europa
zusammen genommen, das aber keine Kriegs-
schiffe bauen wollte, weil die zuviel Geld kosteten?
Sollten die Deutschen eine Weltvolk werden, so
werden sie das mehr als allem andern dem
Flottenbau während des Jahrzehnts verdanken,
das der Marokkokrisis voranging. Daß heute
jeder politisch mündige Deutsche das einsieht, ist
das Verdienst der unfreiwilligen Erziehungsarbeit,
die England an uns geleistet hat. Wie nahe aber
die Gefahr an uns vorübergegangen ist, das
werden wir ermessen, indem wir uns vorstellen,
daß in der entscheidenden Stunde ein Mann von
geringerer Begeisterung und weniger festem Willen
in Flottensachen das Ruder in der Hand ge-
halten hätte, als Wilhelm II.
Paul Rohrdach
Ruhe im Schiff
Ruhe ist im Schiff. Das Meer
Rauscht im Traum, tmd weitumher
Glänzt die Nacht; die Fluten sind
Licht, es leuchten Mond und Sterne.
Leise rauschend, vor dem Wind,
Laust das Schiff in Nacht und Ferne!
Alles schläft. Ein Segel schwingt
Manchmal. Wenn die Glocke klingt,
Singt ein Posten, schallt es hohl,
Noch durch Nacht und Wind zu kennen:
„Auf der Back ist alles wohl,
Die Laternen brennen!"
Ruhe ist im Schiff. Die Zeit
Rauscht vorüber. Meilenweit
Glänzt das Meer. Auf Posten sind
Alle wach, wie Mond und Sterne.
Leise rauschend, vor dem Wind,
Läuft das Schiff in Nacht und Ferne!
Paul weder
1l6ä
JUGEND
1912
rein handelspolitische Abwehrmaßregel des „Made
in Germany“, die bald genug das Gegenteil des
gewünschten Erfolges bewirken sollte. Ungefähr
um dieselbe Zeit schlug die deutsche Regierung der
englischen den Tausch von Helgoland gegen eine
Million Quadratkilometer deutscher Ansprüche in
Afrika vor. Die Engländer gingen drauf ein,
weil sie weder eine deutsche Flotte sahen, der
Helgoland hätte etwas sein können, noch glaubten,
daß es einmal eine geben würde.
Sieben Zahre später ging die deutsche Politik
nach China und darauf nach Konstantinopel.
England wollte schon mit der Faust auf den
Tisch schlagen, aber indem man sich umsah, be-
merkte man, daß die Deutschen immer noch flotten-
los und darum ungefährlich waren; außerdem zu
Lande von der französisch-russischen Nachbarschaft
umspannt. Umso unbegreiflicher, zweckloser er-
schien es, wenn sie sich auf solche Weise über-
seeisch betätigen wollten. Wenn auch unmittel-
bares Einschreiten noch nicht nötig erschien, so
war doch auf alle Fälle eine kräftige Ver-
warnung am Platz. Es siel jenes Wort: wenn
Deutschland wagt, an englische Interessen zu
rühren — was ist dann die deutsche Flotte?
— Nichts als eine Fliege an der Wand, die
man totbrückt!
Das war so richtig gesagt, daß wir Deutschen
eigentlich allesamt hätten aufhorchen und uns
fragen müssen: was soll denn werden, wenn
unsere Volkszahl und unsere Überseeinteressen
noch weiter in solchem Tempo zunehmen und den
Engländern immer unbequemer werden? Daß
England nicht nur zu drohen, sondern auch zu-
zuschlagen gewohnt ist, lehrte uns ja das Bei-
spiel Hollands im 17., das Frankreichs im 18.
und 19. Jahrhundert. Sie beide durften Eng-
lands Freunde sein, nachdem England ihren See-
handel, ihre Kriegsflotten und ihr Kolonialreich
mit Gewalt auf ein ihm genehmes Maß reduziert
hatte. Damals, zu Cromwells Zeit, hieß es:
was bedürfen wir weiter eines Kriegsgrundes
gegen die Niederländer, wenn wir doch ihren
Handel für uns haben wollen? Jetzt tauchte
eine ebenso einfache und deutliche Formel auch
für die Lösung der Frage der deutschen Kon-
kurrenz auf: wenn Deutschland morgen nieder-
geworfen ist, so gibt es übermorgen keinen Eng-
länder, der dadurch nicht reicher geworden wäre!
Das war der Beginn der englischen Lektionen
für die öffentliche Meinung in Deutschland. Ihr
Sinn war kurz und klar: baut Schiffe! Wovon
aber bauen, wenn die Mittel beim Reichstag
waren und jedesmal das jammervolle Feilschen
um jeden neuen Kiel und jeden neuen Mast
begann, sobald die Regierung ein paar Schiffe
beantragte? Was den Reichstag und die Nation
schließlich aus ihrer Taubheit und Blindheit ge-
rissen hat, das ist nichts anderes, als das von
Jahr zu Jahr lauter über den Kanal tönende
Drohen der Engländer gewesen. Noch bevor
es aber zu dem Getöse des letzten Jahrzehnts
anschwoll, ja, bevor den Engländern selbst an-
fing so recht deutlich zu werden, welche Ent-
wicklung Deutschland einschlug, war an der ent-
scheidenden Stelle bedacht und beschlossen, was
not tat.
In den zwölf Jahren seit dem Tode des alten
Kaisers ist bei uns von oben her viel Anfecht-
bares getan und noch mehr Anfechtbares gesagt
worden, aber der große Wurf des deutschen Flotten-
gesetzes von 1900 hat nach dem Willen, aus dem
er entsprang, und nach dem Erfolg, zu dem er
geführt hat, vieles ausgelöscht, um was das Volk
mit dem Kaiser wohl sonst zu rechten gehabt
hätte. Auch ein so genial erdachtes und so glück-
lich durchgeführtes Stück Politik, wie den Auf-
klärungsfeldzug des Reichsmarineamts vor jener
großeil Flottenvorlage haben wir im Verhältnis
unsrer Regierung zur öffentlichen Meinung nicht
wieder erlebt; und diese Leistung war umso größer,
als kaum etwas geschehen durfte, um die unbe-
absichtigte politische Pädagogik, die von England
her am deutschen Volke geübt wurde, in einer
Weise zu unterstreichen, die drüben aufreizend
wirkte.
Während der Jahre von 1900 — 1907 hätte
es in England nur des Entschlusses beburft, um
die entstehende deutsche Flotte wieder vom Meere
verschwinden zu lassen. Dort aber hatte mittler-
weile der Mann den Thron bestiegen, dem wir
Deutschen den größten Dank unter allen unfern
Gegnern schulden, weil er es gewesen ist, der
unsere Erziehung zum Flottenverständnis am nach-
haltigsten vorangebracht und außerdem die ent-
scheidende Gelegenheit versäumt hat, uns zu
Boden zu werfen: König Eduard VII. Seine
Idee war die, Deutschland durch den bloßen Druck
einer politischen Kombination von überwältigender
Stärke vor England auf die Kniee zu zwingen.
Dazu wurde Rußland durch Versprechungen auf
persische und türkische Kosten gewonnen, nachdem
Japan bei Tsuschima und Mukden den Auftrag
besorgt hatte, die indische Flanke zu sichern und
die russische Politik zur Gefolgschaft Englands
gefügig zu machen; dazu erhielt Frankreich Ma-
rokko und Spanien die Verschwägerung mit dem
englischen Königshause; dazu bot man Italien
die Anwartschaft auf das andere Ufer der Adria.
Algefiras war die Generalprobe für die politische
Rollenverteilung.
Gleich nach dem russisch-japanischen Kriege
kam eine große gepanzerte Drohung an die
deutsche Adresse: der Bau der Dreadnought. Als
sie auf dem Wasser schwamm, wäre es Zeit ge-
wesen, Ernst gegen uns zu machen. Da das nicht
geschah — Rußland erwies sich durch den Krieg
und die Revolution als so schwer getroffen, daß
es einstweilen versagte — so schnellte der Pfeil
vom überspannten Bogen auf England zurück.
Der Dreadnought-Typ hat alle Schifssklassen, die
vor ihm liegen, so stark entwertet, daß es fast
nur noch auf die Zahl dieser modernen Groß-
kampfschiffe ankommt, die in der Schlachtlinie
fahren. Mit ihnen aber Ijaben wir die Eng-
länder, die glaubten, unsere Konstrukteure und
Werften würden technisch nicht nachkommen kön-
nen, so weit eingeholt, daß wir fast im Verhält-
Clir. Bärmann
ms von 2:3 zu ihnen stehen, ein Resultat, an
das noch vor einem Jahrzehnt kein Deutscher und
kein Engländer zu denken gewagt hätte!
Eduard VII. hat in den zehn Jahren seiner
Regierung zwar nicht die beabsichtigte Einkreisung
Deutschlands, wohl aber die Erziehung der Deut-
schen zum Verständnis der Seegewalt zustande
gebracht. Das letzte, was dazu noch geschehen
mußte, hat die englische Politik während der
Marokkokrisis geleistet. Wenn England und
Frankreich schließlich doch nicht gegen uns ge-
schlagen haben, so war es zumeist darum, weil
die Engländer nicht mehr wagten, die von Frank-
reich verlangten 150000 Mann Hilfstruppen an-
gesichts der deutschen Torpedo- und Untersee-
boote über die Nordsee nach Belgien zu trans-
portieren. Jetzt also, scheint es, ist es für Eng-
land schon zu spät geworden, die deutsche Flotte
mit Aussicht auf entscheidenden Erfolg anzugreifen.
Welches aber wäre heute unsere Lage gegenüber
England, wenn wir zwar so erfolgreiche Übersee-
Konkurrenten der Engländer geworden wären,
wie wir sind, uns aber mit unsrer Flotte noch
auf dem Stande von 1900 befänden? Womit
wollten wir dem Schicksal Hollands entgehen,
beffen Handelstonnage vor 2 A/a Jahrhunderten
so groß mar, wie die des ganzen übrigen Europa
zusammen genommen, das aber keine Kriegs-
schiffe bauen wollte, weil die zuviel Geld kosteten?
Sollten die Deutschen eine Weltvolk werden, so
werden sie das mehr als allem andern dem
Flottenbau während des Jahrzehnts verdanken,
das der Marokkokrisis voranging. Daß heute
jeder politisch mündige Deutsche das einsieht, ist
das Verdienst der unfreiwilligen Erziehungsarbeit,
die England an uns geleistet hat. Wie nahe aber
die Gefahr an uns vorübergegangen ist, das
werden wir ermessen, indem wir uns vorstellen,
daß in der entscheidenden Stunde ein Mann von
geringerer Begeisterung und weniger festem Willen
in Flottensachen das Ruder in der Hand ge-
halten hätte, als Wilhelm II.
Paul Rohrdach
Ruhe im Schiff
Ruhe ist im Schiff. Das Meer
Rauscht im Traum, tmd weitumher
Glänzt die Nacht; die Fluten sind
Licht, es leuchten Mond und Sterne.
Leise rauschend, vor dem Wind,
Laust das Schiff in Nacht und Ferne!
Alles schläft. Ein Segel schwingt
Manchmal. Wenn die Glocke klingt,
Singt ein Posten, schallt es hohl,
Noch durch Nacht und Wind zu kennen:
„Auf der Back ist alles wohl,
Die Laternen brennen!"
Ruhe ist im Schiff. Die Zeit
Rauscht vorüber. Meilenweit
Glänzt das Meer. Auf Posten sind
Alle wach, wie Mond und Sterne.
Leise rauschend, vor dem Wind,
Läuft das Schiff in Nacht und Ferne!
Paul weder
1l6ä