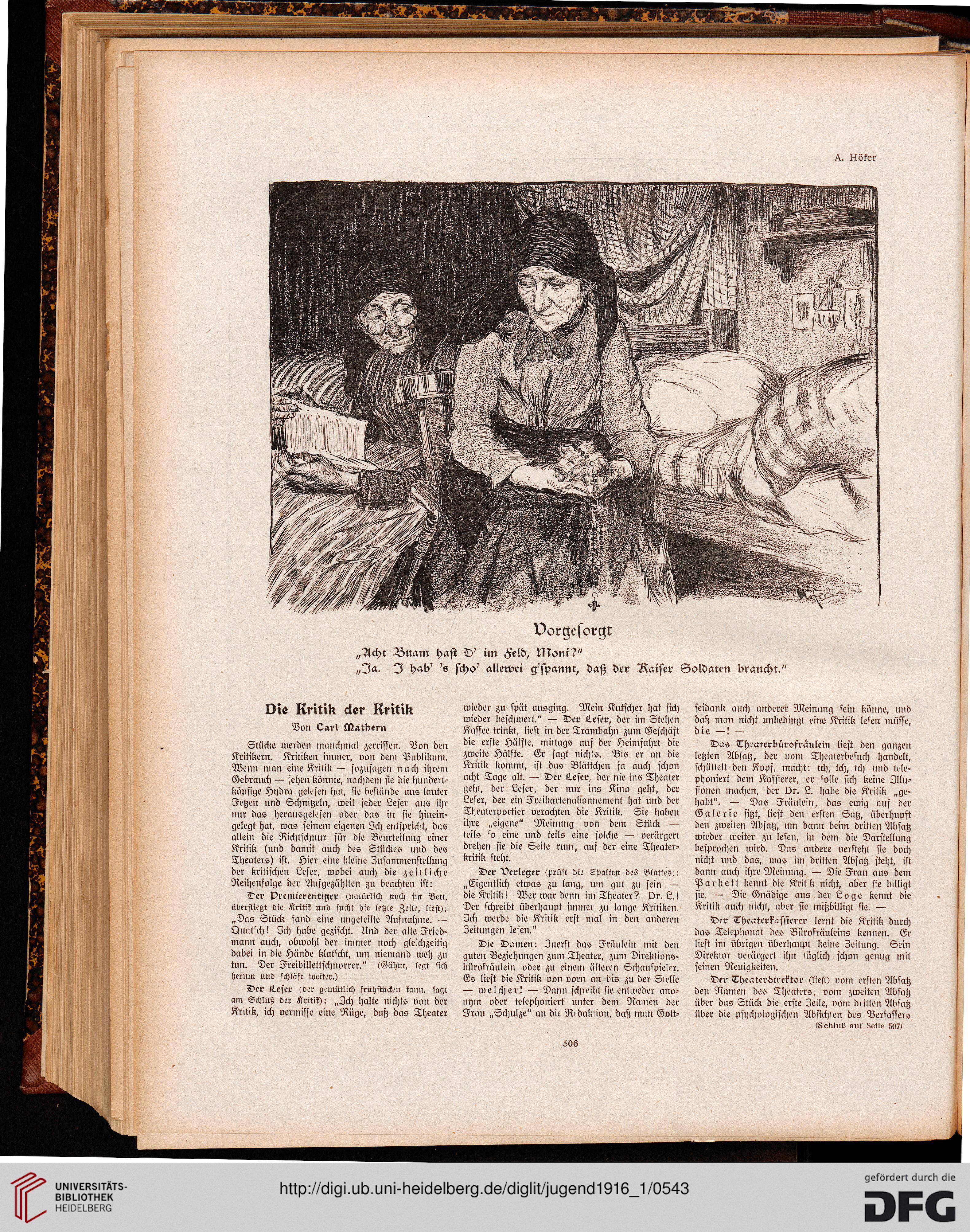A. Höfer
Vorgesorgt
„Acht A3uam hast D' tm Leid, Moni?"
„Ja. I Hab' 's scho' allewei g'spannr, daß der Raiser Soldaten braucht."
Die Kritik der Kritik
Bon Carl flßatbern
Stücke werden manchmal zerrissen. Bon den
Kritikern. Kritiken immer, von dem Publikum.
Wenn man eine Kritik — sozusagen nach ihrem
Gebrauch — sehen könnte, nachdem sie die hundert-
köpfige Hydra gelesen hat, sie bestünde aus lauter
Fetzen und Schnitzeln, weil jeder Leser aus ihr
nur das herausgelesen oder das in sie hineiu-
gelegt hat, was seinem eigenen Ich entspricht, das
allein die Richtschnur für die Beurteilung einer
Kritik (und damit auch des Stückes und des
Theaters) ist. Hier eine kleine Zusammenstellung
der kritischen Leser, wobei auch die zeitliche
Reihenfolge der Aufgezählten zu beachten ist:
Der Pieinicrentiger (natürlich noch im Bett,
überfliegt die Kritik und sucht die letzte Zeile, tieft) l
„Das Stück fand eine ungeteilte Aufnahme. —
Quatsch! Ich habe gezischt. Und der alte Fricd-
mann auch, obwohl der immer noch gleichzeitig
dabei in die Hände klatscht, um niemand weh zu
tun. Der Freibillettschnorrer." (Gähnt, legt sich
herum und schläft weiter.)
Der Leser (der gemütlich frühstücken kann, sagt
am Schluß der Kritik): „Ich halte nichts von der
Kritik, ich vermisse eine Rüge, daß das Theater
wieder zu spät ausging. Mein Kutscher hat sich
wieder beschwert." — Der Leser, der im Stehen
Kaffee trinkt, liest in der Trambahn zum Geschäft
die erste Hälfte, mittags auf der Heimfahrt die
zweite Hälfte. Er sagt nichts. Bio er an die
Kritik kommt, ist das Blättchen ja auch schon
acht Tage alt. — Der Leser, der nie ins Theater
geht, der Leser, der nur ins Kino geht, der
Leser, der ein Freikartenabonnement hat und der
Theaterportier verachten die Kritik. Sie haben
ihre „eigene" Meinung von dem Stück —
teils Fo eine und teils eine solche — verärgert
drehen sie die Seite rum, auf der eine Theater-
kritik steht.
Der Verleger (prüft die Spalten des Blattes):
„Eigentlich etwas zu lang, um gut zu sein —
die Kritik! Wer war denn im Theater? Or. L.!
Der schreibt überhaupt immer zu lange Kritiken.
Ich werde die Kritik erst nial in den anderen
Zeitungen lesen."
Die Damen: Zuerst das Fräulein mit den
guten Beziehungen zum Theater, zum Direktions-
bürofräulein oder zu einem älteren Schauspieler.
Es liest die Kritik von vorn an bis zu der Slelle
— welcher! — Dann schreibt sie entweder ano-
nym oder telephoniert unter dem Namen der
Frau „Schulze" an die Redaktion, daß man Gott-
seidank auch anderer Meinung sein könne, und
daß man nicht unbedingt eine Kritik lesen müsse,
die —! —
Das Dhcaterbürofräulcin liest den ganzen
letzten Absatz, der vom Theaterbesuch handelt,
schüttelt den Kopf, macht: Ich, ich, tch und tele-
phoniert dem Kassierer, er solle sich keine Illu-
sionen machen, der Dr. L. habe die Kritik „ge-
habt". — Das Fräulein, das ewig auf der
Galerie sitzt, liest den ersten Satz, überhupft
den zweiten Absatz, um daun beim dritten Absatz
wieder weiter zu lesen, in dem die Darstellung
besprochen wird. Das andere versteht sie doch
nicht und das, was im dritten Absatz steht, ist
dann auch ihre Meinung. — Die Frau aus dem
Parkett kennt die Krit k nicht, aber sie billigt
sie. — Die Gnädige aus der Loge kennt die
Kritik auch nicht, aber sie nrißbilligt sic. —
Der Dhcatcrkassierer lernt die Kritik durch
das Telephonat des Bürofräuleins kennen. Er
liest ini übrigen überhaupt keine Zeitung. Sein
Direktor verärgert ihn täglich schon genug mit
seinen Neuigkeiten.
Dcr Theatcrdirektor (liest) vom ersten Absatz
den Namen des Theaters, vom zweiten Absatz
über das Stück die erste Zeile, vom dritten Absatz
über die psychologischen Absichicn des Berfaffers
(Schluß auf Seite 507)
506
Vorgesorgt
„Acht A3uam hast D' tm Leid, Moni?"
„Ja. I Hab' 's scho' allewei g'spannr, daß der Raiser Soldaten braucht."
Die Kritik der Kritik
Bon Carl flßatbern
Stücke werden manchmal zerrissen. Bon den
Kritikern. Kritiken immer, von dem Publikum.
Wenn man eine Kritik — sozusagen nach ihrem
Gebrauch — sehen könnte, nachdem sie die hundert-
köpfige Hydra gelesen hat, sie bestünde aus lauter
Fetzen und Schnitzeln, weil jeder Leser aus ihr
nur das herausgelesen oder das in sie hineiu-
gelegt hat, was seinem eigenen Ich entspricht, das
allein die Richtschnur für die Beurteilung einer
Kritik (und damit auch des Stückes und des
Theaters) ist. Hier eine kleine Zusammenstellung
der kritischen Leser, wobei auch die zeitliche
Reihenfolge der Aufgezählten zu beachten ist:
Der Pieinicrentiger (natürlich noch im Bett,
überfliegt die Kritik und sucht die letzte Zeile, tieft) l
„Das Stück fand eine ungeteilte Aufnahme. —
Quatsch! Ich habe gezischt. Und der alte Fricd-
mann auch, obwohl der immer noch gleichzeitig
dabei in die Hände klatscht, um niemand weh zu
tun. Der Freibillettschnorrer." (Gähnt, legt sich
herum und schläft weiter.)
Der Leser (der gemütlich frühstücken kann, sagt
am Schluß der Kritik): „Ich halte nichts von der
Kritik, ich vermisse eine Rüge, daß das Theater
wieder zu spät ausging. Mein Kutscher hat sich
wieder beschwert." — Der Leser, der im Stehen
Kaffee trinkt, liest in der Trambahn zum Geschäft
die erste Hälfte, mittags auf der Heimfahrt die
zweite Hälfte. Er sagt nichts. Bio er an die
Kritik kommt, ist das Blättchen ja auch schon
acht Tage alt. — Der Leser, der nie ins Theater
geht, der Leser, der nur ins Kino geht, der
Leser, der ein Freikartenabonnement hat und der
Theaterportier verachten die Kritik. Sie haben
ihre „eigene" Meinung von dem Stück —
teils Fo eine und teils eine solche — verärgert
drehen sie die Seite rum, auf der eine Theater-
kritik steht.
Der Verleger (prüft die Spalten des Blattes):
„Eigentlich etwas zu lang, um gut zu sein —
die Kritik! Wer war denn im Theater? Or. L.!
Der schreibt überhaupt immer zu lange Kritiken.
Ich werde die Kritik erst nial in den anderen
Zeitungen lesen."
Die Damen: Zuerst das Fräulein mit den
guten Beziehungen zum Theater, zum Direktions-
bürofräulein oder zu einem älteren Schauspieler.
Es liest die Kritik von vorn an bis zu der Slelle
— welcher! — Dann schreibt sie entweder ano-
nym oder telephoniert unter dem Namen der
Frau „Schulze" an die Redaktion, daß man Gott-
seidank auch anderer Meinung sein könne, und
daß man nicht unbedingt eine Kritik lesen müsse,
die —! —
Das Dhcaterbürofräulcin liest den ganzen
letzten Absatz, der vom Theaterbesuch handelt,
schüttelt den Kopf, macht: Ich, ich, tch und tele-
phoniert dem Kassierer, er solle sich keine Illu-
sionen machen, der Dr. L. habe die Kritik „ge-
habt". — Das Fräulein, das ewig auf der
Galerie sitzt, liest den ersten Satz, überhupft
den zweiten Absatz, um daun beim dritten Absatz
wieder weiter zu lesen, in dem die Darstellung
besprochen wird. Das andere versteht sie doch
nicht und das, was im dritten Absatz steht, ist
dann auch ihre Meinung. — Die Frau aus dem
Parkett kennt die Krit k nicht, aber sie billigt
sie. — Die Gnädige aus der Loge kennt die
Kritik auch nicht, aber sie nrißbilligt sic. —
Der Dhcatcrkassierer lernt die Kritik durch
das Telephonat des Bürofräuleins kennen. Er
liest ini übrigen überhaupt keine Zeitung. Sein
Direktor verärgert ihn täglich schon genug mit
seinen Neuigkeiten.
Dcr Theatcrdirektor (liest) vom ersten Absatz
den Namen des Theaters, vom zweiten Absatz
über das Stück die erste Zeile, vom dritten Absatz
über die psychologischen Absichicn des Berfaffers
(Schluß auf Seite 507)
506