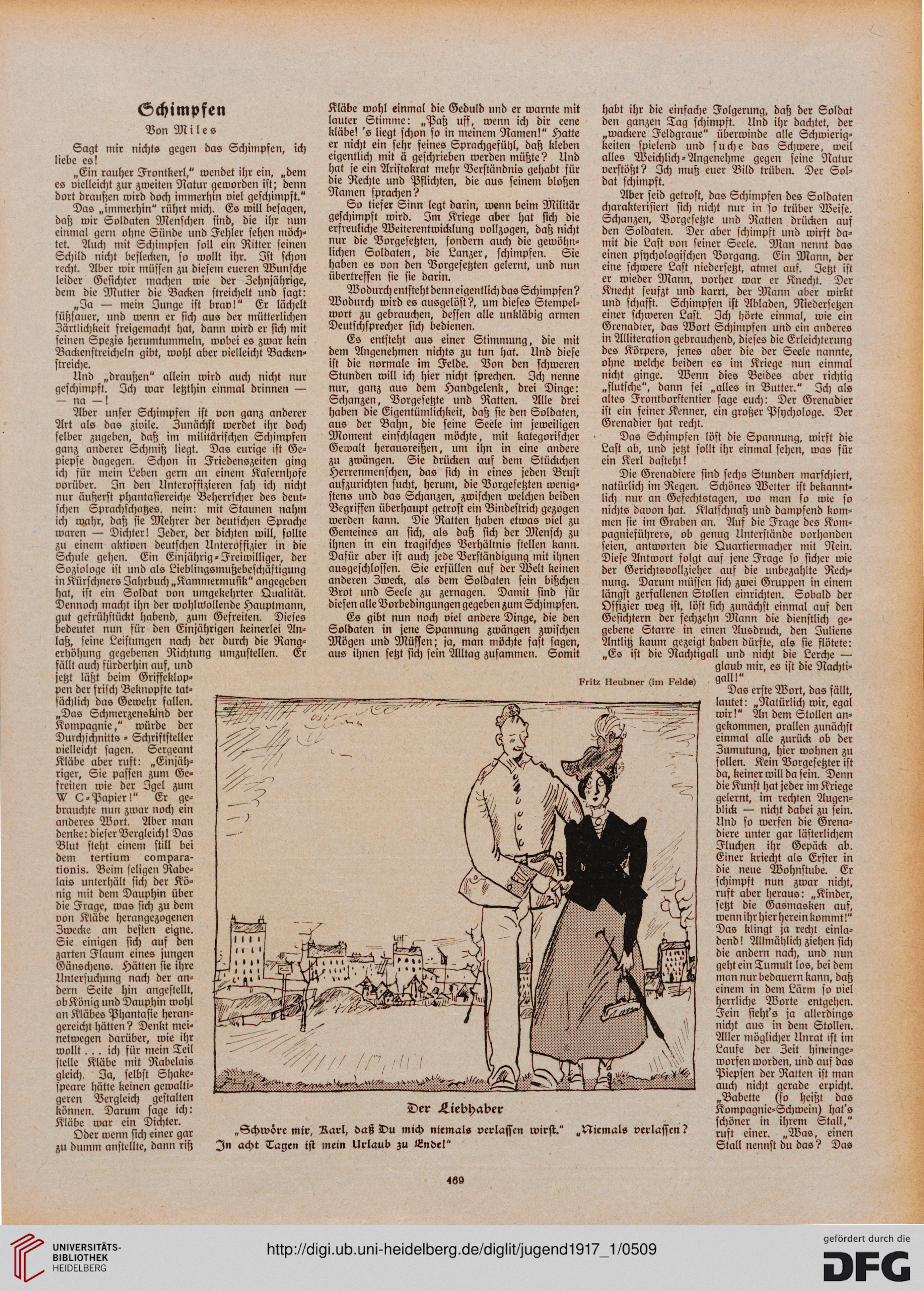Schimpfen
Von Miles
Sagt mir nichts gegen das Schimpfen, ich
liebe es!
„Ein rauher Frontkerl," wendet ihr ein, „deni
es vielleicht zur zweiten Natur geworden ist: denn
dort brausten wird doch immerhin viel gefchinipft."
Das „immerhin" rührt mich. Es will besagen,
dast wir Soldaten Menschen stnd, die ihr nun
einmal gern ohne Sünde und Fehler sehen möch-
tet. Auch mit Schimpfen soll ein Ritter seinen
Schild nicht beflecken, so wollt ihr. Ist schon
recht. Aber wir müssen zu diesem eueren Wunsche
leider Gesichter machen wie der Zehnjährige,
dem die Mutter die Backen streichelt und sagt:
„Ja — mein Junge ist brav!" Er lächelt
süßsauer, und wenn er sich aus der mütterlichen
Zärtlichkeit freigemacht hat, dann wird er sich mit
seinen Spezis herumtummeln, wobei es zwar kein
Backenstreicheln gibt, wohl aber vielleicht Backen-
streiche.
Und „draußen" allein wird auch nicht nur
geschimpft. Ich war letzthin einmal drinnen —
— na —!
Aber unser Schimpfen ist von ganz anderer
Art als das zivile. Zunächst werdet ihr doch
selber zugeben, daß im militärischen Schimpfen
ganz anderer Schmiß liegt. Das eurige ist Ge-
piepst dagegen. Schon in Friedenszeiten ging
ich für mein Leben gern an einem Kasernhofe
vorüber. In den Unterofflzieren sah ich nicht
nur äußerst phantasiereiche Beherrscher des deut-
schen Sprachschatzes, nein: mit Staunen nahm
ich wahr, daß sie Mehrer der deutschen Sprache
waren — Dichter! Jeder, der dichten will, sollte
zu einem aktiven deutschen Unteroffizier in die
Schule gehen. Ein Einjährig-Freiwilliger, der
Soziologe ist und als Lieblingsmußebeschäftigung
in Kürschners Jahrbuch „Kamniermusik" angegeben
hat, ist ein Soldat von umgekehrter Qualität.
Dennoch macht ihn der wohlatollcnde Hauptmann,
gut gesrühstückt habend, zum Gefreiten. Dieses
bedeutet nun für den Einjährigen keinerlei An-
laß, seine Leistungen nach der durch die Rang-
erhöhung gegebenen Richtung umzustellen. Er
fällt auch fürderhin auf, und
jetzt läßt beim Griffeklop-
pen der frisch Beknopste tat-
sächlich das Gewehr fallen.
„Das Schmerzenskind der
Kompagnie," würde der
Durchschnitts - Schriftsteller
vielleicht sagen. Sergeant
Kläbe aber ruft: „Einjäh-
riger, Sie passen zum Ge-
freiten wie der Igel zum
W L-Papier!" Er ge-
brauchte nun zwar noch ein
anderes Wort. Aber man
denke: dieser Vergleich! Das
Blut steht einem still bei
dem tertium compsra-
tionls. Beim seligen Rabe-
lais unterhält sich der Kö-
nig mit dem Dauphin über
die Frage, was sich zu dem
von Kläbe herangezogenen
Zwecke am besten eigne.
Sie einigen sich auf den
zarten Flaum eines jungen
Gänschens. Hätten sie ihre
Untersuchung nach der an-
dern Seite hin angestellt,
ob König und Dauphin wohl
an Kläbes Phantasie heran-
gereicht hätten? Denkt mei-
netwegen darüber, wie ihr
wollt... ich für mein Teil
stelle Kläbe mit Rabelais
gleich. Ja, selbst Shake-
speare hätte keinen gewalti-
geren Vergleich gestalten
können. Darum sage ich:
Kläbe war ein Dichter.
Oder wenn sich einer gar
zu dumm anstellte, dann riß
Kläbe wohl einmal die Geduld und er warnte mit
lauter Stimme: „Paß uff, wenn ich dir eene
kläbe! 's liegt schon so in meinem Namen!" Hatte
er nicht ein sehr feines Sprachgefühl, daß kleben
eigentlich mit ä geschrieben werden müßte? Und
hat je ein Aristokrat mehr Verständnis gehabt für
die Rechte und Pflichten, die aus seinem bloßen
Namen sprachen?
So tiefer Sinn legt darin, wenn beim Militär
geschimpft wird. Im Kriege aber hat sich die
erfreuliche Weiterentwicklung vollzogen, daß nicht
nur die Vorgesetzten, sondern auch die gewöhn-
lichen Soldaten, die Lanzer, schimpfen. Sie
haben es von den Vorgesetzten gelernt, und nun
übertreffen sie sie darin.
Wodurch entsteht denn eigentlich das Schimpfen?
Wodurch wird es ausgelöst?, um dieses Stempel-
wort zu gebrauchen, dessen alle unkläbig armen
Deutschsprecher sich bedienen.
Es entsteht aus einer Stimmung, die mit
dem Angenehmen nichts zu tun hat. Und diese
ist die normale im Felde. Von den schweren
Stunden will ich hier nicht sprechen. Ich nenne
nur, ganz aus dem Handgelenk, drei Dinge:
Schanzen, Vorgesetzte und Ratten. Alle drei
haben die Eigentümlichkeit, daß sie den Soldaten,
aus der Bahn, die seine Seele im jeweiligen
Moment einschlagen möchte, mit kategorischer
Gewalt herausreißen. um ihn in eine andere
zu zwängen. Sie drücken auf dem Stückchen
Herrenmenschen, das sich in eines jeden Brust
aufzurichten sucht, herum, die Vorgesetzten wenig-
stens und das Schanzen, zwischen welchen beiden
Begriffen überhaupt getrost ein Bindestrich gezogen
werden kann. Die Ratten haben etwas viel zu
Gemeines an sich, als daß sich der Mensch zu
ihnen in ein tragisches Verhältnis stellen kann.
Dafür aber ist auch jede Verständigung mit ihnen
ausgeschlossen. Sie erfüllen auf der Welt keinen
anderen Zweck, als dem Soldaten sein bißchen
Brot und Seele zu zernagen. Daniit sind für
diesen alle Vorbedingungen gegeben zum Schimpfen.
Es gibt nun noch viel andere Dinge, die den
Soldaten in jene Spannung zwängen zwischen
Mögen und Müssen; ja, man möchte fast sagen,
aus ihnen setzt sich sein Alltag zusammen. Somit
Der Liebhaber
„Schwöre mir, Dari, daß Du mich niemals verlassen wirst."
In acht Tagen ist mein Urlaub zu Endel"
habt ihr die einfache Folgerung, daß der Soldat
den ganzen Tag schimpft. Und ihr dachtet, der
„wachere Feldgraue" überwinde alle Schwierig-
keiten spielend und suche das Schwere, weil
alles Weichlich-Angenehme gegen seine Natur
verstößt? Ich muß euer Bild trüben. Der Sol-
dat schimpft.
Aber seid getrost, das Schimpfen des Soldaten
charakterisiert sich nicht nur in io trüber Weise.
Schanzen, Vorgesetzte und Ratten drücken auf
den Soldaten. Der aber schimpft und wirft da-
mit die Last von seiner Seele. Man nennt das
einen psychologischen Vorgang. Ein Mann, der
eine schwere Last niedersetzt, atmet auf. Jetzt ist
er wieder Mann, vorher war er Knecht. Der
Knecht seufzt und karrt, der Mann aber wirkt
und schafft. Schimpfen ist Abladen, Niedersetzen
einer schweren Last. Ich hörte einmal, wie ein
Grenadier, das Wort Schimpfen und ein anderes
in Alliteration gebrauchend, dieses die Erleichterung
des Körpers, jenes aber die der Seele nannte,
ohne welche beiden es im Kriege nun einmal
nicht ginge. Wenn dies Beides aber richtig
„flutsche", dann sei „alles in Butter." Ich als
altes Frontborstentier sage euch: Der Grenadier
ist ein feiner Kenner, ein großer Psychologe. Der
Grenadier hat recht.
Das Schimpfen löst die Spannung, wirft die
Last ab, und jetzt sollt ihr einmal sehen, was für
ein Kerl dastehl I
Die Grenadiere sind sechs Stunden marschiert,
natürlich im Regen. Schönes Wetter ist bekannt-
lich nur an Gefechtstagen, wo man so wie so
nichts davon hat. Klatschnaß und dampfend kom-
men sie im Graben an. Auf die Frage des Kom-
pagnieführers, ob genug Unterstände vorhanden
seien, antworten die Quartiermacher mit Nein.
Diese Antwort folgt auf jene Frage so sicher wie
der Gerichtsvollzieher auf die unbezahlte Rech-
nung. Darum müssen sich zwei Gruppen in einem
längst zerfallenen Stollen einrichten. Sobald der
Offizier weg ist, löst sich zunächst einmal auf den
Gesichtern der sechzehn Mann die dienstlich ge-
gebene Starre in einen Ausdruck, den Juliens
Antlitz kaum gezeigt haben dürfte, als sie flötete:
„Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche —
glaub mir, es ist die Nachti-
gall!"
Das erste Wort, das fällt,
lautet: „Natürlich wir, egal
wir!" An dem Stollen an-
gekommen, prallen zunächst
einmal alle zurück ob der
Zumutung, hier wohnen zu
sollen. Kein Vorgesetzter ist
da, keiner will da sein. Denn
die Kunst hat jeder im Kriege
gelernt, im rechten Augen-
blick — nicht dabei zu sein.
Und so werfen die Grena-
diere unter gar lästerlichem
Fluchen ihr Gepäck ab.
Einer kriecht als Erster in
die neue Wohnstube. Er
schimpft nun zwar nicht,
ruft aber heraus: „Kinder,
setzt die Gasmasken auf,
wenn ihr hier herein kommt!"
Das klingt ja recht einla-
dend! Allmählich ziehen sich
die andern nach, und nun
geht ein Tumult los, bei dem
man nur bedauern kann, daß
einem in dem Lärm so viel
herrliche Worte entgehen.
Fein sieht's ja allerdings
nicht aus in dem Stollen.
Aller möglicher Unrat ist im
Laufe der Zeit hineinge-
worfen worden, und auf das
Piepsen der Raiten ist man
auch nicht gerade erpicht.
„Babette (so heißt das
Kompagnie-Schwein) hat's
schöner in ihrem Stall,"
ruft einer. „Was, einen
Stall nennst du das? Das
Fritz Heubner (im Felde)
„Niemals verlassen 7
«69
Von Miles
Sagt mir nichts gegen das Schimpfen, ich
liebe es!
„Ein rauher Frontkerl," wendet ihr ein, „deni
es vielleicht zur zweiten Natur geworden ist: denn
dort brausten wird doch immerhin viel gefchinipft."
Das „immerhin" rührt mich. Es will besagen,
dast wir Soldaten Menschen stnd, die ihr nun
einmal gern ohne Sünde und Fehler sehen möch-
tet. Auch mit Schimpfen soll ein Ritter seinen
Schild nicht beflecken, so wollt ihr. Ist schon
recht. Aber wir müssen zu diesem eueren Wunsche
leider Gesichter machen wie der Zehnjährige,
dem die Mutter die Backen streichelt und sagt:
„Ja — mein Junge ist brav!" Er lächelt
süßsauer, und wenn er sich aus der mütterlichen
Zärtlichkeit freigemacht hat, dann wird er sich mit
seinen Spezis herumtummeln, wobei es zwar kein
Backenstreicheln gibt, wohl aber vielleicht Backen-
streiche.
Und „draußen" allein wird auch nicht nur
geschimpft. Ich war letzthin einmal drinnen —
— na —!
Aber unser Schimpfen ist von ganz anderer
Art als das zivile. Zunächst werdet ihr doch
selber zugeben, daß im militärischen Schimpfen
ganz anderer Schmiß liegt. Das eurige ist Ge-
piepst dagegen. Schon in Friedenszeiten ging
ich für mein Leben gern an einem Kasernhofe
vorüber. In den Unterofflzieren sah ich nicht
nur äußerst phantasiereiche Beherrscher des deut-
schen Sprachschatzes, nein: mit Staunen nahm
ich wahr, daß sie Mehrer der deutschen Sprache
waren — Dichter! Jeder, der dichten will, sollte
zu einem aktiven deutschen Unteroffizier in die
Schule gehen. Ein Einjährig-Freiwilliger, der
Soziologe ist und als Lieblingsmußebeschäftigung
in Kürschners Jahrbuch „Kamniermusik" angegeben
hat, ist ein Soldat von umgekehrter Qualität.
Dennoch macht ihn der wohlatollcnde Hauptmann,
gut gesrühstückt habend, zum Gefreiten. Dieses
bedeutet nun für den Einjährigen keinerlei An-
laß, seine Leistungen nach der durch die Rang-
erhöhung gegebenen Richtung umzustellen. Er
fällt auch fürderhin auf, und
jetzt läßt beim Griffeklop-
pen der frisch Beknopste tat-
sächlich das Gewehr fallen.
„Das Schmerzenskind der
Kompagnie," würde der
Durchschnitts - Schriftsteller
vielleicht sagen. Sergeant
Kläbe aber ruft: „Einjäh-
riger, Sie passen zum Ge-
freiten wie der Igel zum
W L-Papier!" Er ge-
brauchte nun zwar noch ein
anderes Wort. Aber man
denke: dieser Vergleich! Das
Blut steht einem still bei
dem tertium compsra-
tionls. Beim seligen Rabe-
lais unterhält sich der Kö-
nig mit dem Dauphin über
die Frage, was sich zu dem
von Kläbe herangezogenen
Zwecke am besten eigne.
Sie einigen sich auf den
zarten Flaum eines jungen
Gänschens. Hätten sie ihre
Untersuchung nach der an-
dern Seite hin angestellt,
ob König und Dauphin wohl
an Kläbes Phantasie heran-
gereicht hätten? Denkt mei-
netwegen darüber, wie ihr
wollt... ich für mein Teil
stelle Kläbe mit Rabelais
gleich. Ja, selbst Shake-
speare hätte keinen gewalti-
geren Vergleich gestalten
können. Darum sage ich:
Kläbe war ein Dichter.
Oder wenn sich einer gar
zu dumm anstellte, dann riß
Kläbe wohl einmal die Geduld und er warnte mit
lauter Stimme: „Paß uff, wenn ich dir eene
kläbe! 's liegt schon so in meinem Namen!" Hatte
er nicht ein sehr feines Sprachgefühl, daß kleben
eigentlich mit ä geschrieben werden müßte? Und
hat je ein Aristokrat mehr Verständnis gehabt für
die Rechte und Pflichten, die aus seinem bloßen
Namen sprachen?
So tiefer Sinn legt darin, wenn beim Militär
geschimpft wird. Im Kriege aber hat sich die
erfreuliche Weiterentwicklung vollzogen, daß nicht
nur die Vorgesetzten, sondern auch die gewöhn-
lichen Soldaten, die Lanzer, schimpfen. Sie
haben es von den Vorgesetzten gelernt, und nun
übertreffen sie sie darin.
Wodurch entsteht denn eigentlich das Schimpfen?
Wodurch wird es ausgelöst?, um dieses Stempel-
wort zu gebrauchen, dessen alle unkläbig armen
Deutschsprecher sich bedienen.
Es entsteht aus einer Stimmung, die mit
dem Angenehmen nichts zu tun hat. Und diese
ist die normale im Felde. Von den schweren
Stunden will ich hier nicht sprechen. Ich nenne
nur, ganz aus dem Handgelenk, drei Dinge:
Schanzen, Vorgesetzte und Ratten. Alle drei
haben die Eigentümlichkeit, daß sie den Soldaten,
aus der Bahn, die seine Seele im jeweiligen
Moment einschlagen möchte, mit kategorischer
Gewalt herausreißen. um ihn in eine andere
zu zwängen. Sie drücken auf dem Stückchen
Herrenmenschen, das sich in eines jeden Brust
aufzurichten sucht, herum, die Vorgesetzten wenig-
stens und das Schanzen, zwischen welchen beiden
Begriffen überhaupt getrost ein Bindestrich gezogen
werden kann. Die Ratten haben etwas viel zu
Gemeines an sich, als daß sich der Mensch zu
ihnen in ein tragisches Verhältnis stellen kann.
Dafür aber ist auch jede Verständigung mit ihnen
ausgeschlossen. Sie erfüllen auf der Welt keinen
anderen Zweck, als dem Soldaten sein bißchen
Brot und Seele zu zernagen. Daniit sind für
diesen alle Vorbedingungen gegeben zum Schimpfen.
Es gibt nun noch viel andere Dinge, die den
Soldaten in jene Spannung zwängen zwischen
Mögen und Müssen; ja, man möchte fast sagen,
aus ihnen setzt sich sein Alltag zusammen. Somit
Der Liebhaber
„Schwöre mir, Dari, daß Du mich niemals verlassen wirst."
In acht Tagen ist mein Urlaub zu Endel"
habt ihr die einfache Folgerung, daß der Soldat
den ganzen Tag schimpft. Und ihr dachtet, der
„wachere Feldgraue" überwinde alle Schwierig-
keiten spielend und suche das Schwere, weil
alles Weichlich-Angenehme gegen seine Natur
verstößt? Ich muß euer Bild trüben. Der Sol-
dat schimpft.
Aber seid getrost, das Schimpfen des Soldaten
charakterisiert sich nicht nur in io trüber Weise.
Schanzen, Vorgesetzte und Ratten drücken auf
den Soldaten. Der aber schimpft und wirft da-
mit die Last von seiner Seele. Man nennt das
einen psychologischen Vorgang. Ein Mann, der
eine schwere Last niedersetzt, atmet auf. Jetzt ist
er wieder Mann, vorher war er Knecht. Der
Knecht seufzt und karrt, der Mann aber wirkt
und schafft. Schimpfen ist Abladen, Niedersetzen
einer schweren Last. Ich hörte einmal, wie ein
Grenadier, das Wort Schimpfen und ein anderes
in Alliteration gebrauchend, dieses die Erleichterung
des Körpers, jenes aber die der Seele nannte,
ohne welche beiden es im Kriege nun einmal
nicht ginge. Wenn dies Beides aber richtig
„flutsche", dann sei „alles in Butter." Ich als
altes Frontborstentier sage euch: Der Grenadier
ist ein feiner Kenner, ein großer Psychologe. Der
Grenadier hat recht.
Das Schimpfen löst die Spannung, wirft die
Last ab, und jetzt sollt ihr einmal sehen, was für
ein Kerl dastehl I
Die Grenadiere sind sechs Stunden marschiert,
natürlich im Regen. Schönes Wetter ist bekannt-
lich nur an Gefechtstagen, wo man so wie so
nichts davon hat. Klatschnaß und dampfend kom-
men sie im Graben an. Auf die Frage des Kom-
pagnieführers, ob genug Unterstände vorhanden
seien, antworten die Quartiermacher mit Nein.
Diese Antwort folgt auf jene Frage so sicher wie
der Gerichtsvollzieher auf die unbezahlte Rech-
nung. Darum müssen sich zwei Gruppen in einem
längst zerfallenen Stollen einrichten. Sobald der
Offizier weg ist, löst sich zunächst einmal auf den
Gesichtern der sechzehn Mann die dienstlich ge-
gebene Starre in einen Ausdruck, den Juliens
Antlitz kaum gezeigt haben dürfte, als sie flötete:
„Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche —
glaub mir, es ist die Nachti-
gall!"
Das erste Wort, das fällt,
lautet: „Natürlich wir, egal
wir!" An dem Stollen an-
gekommen, prallen zunächst
einmal alle zurück ob der
Zumutung, hier wohnen zu
sollen. Kein Vorgesetzter ist
da, keiner will da sein. Denn
die Kunst hat jeder im Kriege
gelernt, im rechten Augen-
blick — nicht dabei zu sein.
Und so werfen die Grena-
diere unter gar lästerlichem
Fluchen ihr Gepäck ab.
Einer kriecht als Erster in
die neue Wohnstube. Er
schimpft nun zwar nicht,
ruft aber heraus: „Kinder,
setzt die Gasmasken auf,
wenn ihr hier herein kommt!"
Das klingt ja recht einla-
dend! Allmählich ziehen sich
die andern nach, und nun
geht ein Tumult los, bei dem
man nur bedauern kann, daß
einem in dem Lärm so viel
herrliche Worte entgehen.
Fein sieht's ja allerdings
nicht aus in dem Stollen.
Aller möglicher Unrat ist im
Laufe der Zeit hineinge-
worfen worden, und auf das
Piepsen der Raiten ist man
auch nicht gerade erpicht.
„Babette (so heißt das
Kompagnie-Schwein) hat's
schöner in ihrem Stall,"
ruft einer. „Was, einen
Stall nennst du das? Das
Fritz Heubner (im Felde)
„Niemals verlassen 7
«69