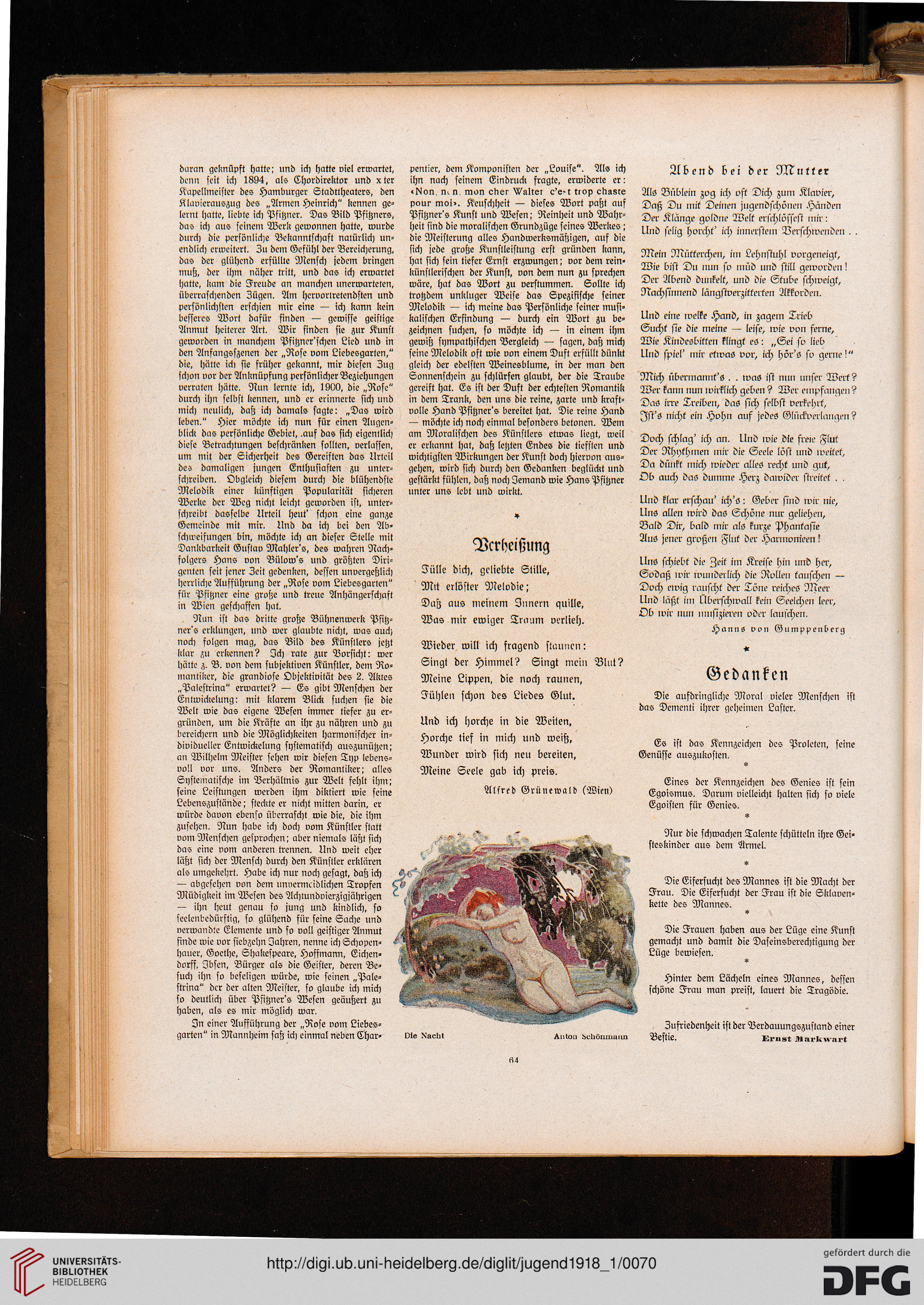tmrnn geknüpft hatte; und ich hatte viel erwartet,
denn seit ich 1894, als Chordirektor und xter
Kapellmeister des Hamburger Stadtlhcaters, den
Klavierauszug des „Armen Heinrich" kennen ge-
lernt hatte, liebte ich Pfitzner. Das Bild Pfitzncrs,
das ich aus seinen: Werk gewonnen hatte, wurde
durch die persönliche Bekanntschaft naiürlich un-
endlich erweitert. Zu dem Gefühl der Bereicherung,
das der glühend erfüllte Mensch jedem bringen
muh, der ihm näher tritt, und das ich erwartet
hatte, kam die Freude an manchen unerwarteten,
überraschenden Zügen. Am hcrvorlrctendsten und
persönlichsten erschien mir eine — ich kann kein
besseres Wort dafür finden — gewisse geistige
Anmut heiterer Art. Wir finden sie zur Kunst
geworden in manchem Pfitzner'schen Lied und in
den Anfangsszcncn der „Rose vom Licbesgarten,"
die, hätte ich sie früher gekannt, mir diesen Zug
schon vor der Anknüpfung persönlicher Beziehungen
verraten hätte. Nun lernte ich, 1900, die „Rose"
durch ihn selbst kennen, und er erinnerte sich und
mich neulich, daß ich damals sagte: „Das wird
leben." Hier möchte ich nun für einen Augen-
blick das persönliche Gebiet, .auf das sich eigentlich
diese Betrachtungen beschränken sollten, verlassen,
um mit der Sicherheit des Gereiften das Urteil
des damaligen jungen Enthusiasten zu unter-
schreiben. Obgleich diesem durch die blühendste
Melodik einer künftigen Popularität sicheren
Werke der Weg nicht leicht geworden ist, unter-
sä>rcibt dasselbe Urteil heut' schon eine ganze
Gemeinde mit mir. Und da ich bei den Ab-
schweifungen bin, möchte ich an dieser Stelle mit
Dankbarkeit Gustav Mahler's, des wahren Nach-
folgers Hans von Bülow's und größten Diri-
genten seit jener Zeit gedenken, dessen unvergeßlich
herrliche Aufführung der „Rose vom Liebesgarten"
für Pfitzner eine große lind treue Anhängerschaft
in Wien gescliaffcn hat.
Nun ist das dritte große Bühnenwerk Pfitz-
ner's erklungen, und wer glaubte nicht, was auch
noch folgen mag, das Bild des Künstlers jetzt
klar zu erkennen? Fch rate zur Vorsicht: wer
hätte z. B. von dem subjektiven Künstler, dem Ro-
mantiker, die grandiose Objektivität des 2. Aktes
„Palestrina" erwartet? — Es gibt Menschen der
Entwickelung: mit klarem Blick suchen sie die
Welt wie das eigene Wesen immer tiefer zu er-
gründen, um die Kräfte an ihr zr> nähren und zu
bereichern und die Möglichkeiten harmonischer in-
dividueller Entwickelung systematisch auszunützen;
an Wilhelm Meister sehen wir diesen Typ lebens-
voll vor uns. Anders der Romantiker: alles
Systematische im Verhältnis zur Welt fehlt ihm;
seine Leistungen werden ihm diktiert wie seine
Lebenszustände: steckteer nicht mitten darin, er
würde davon ebenso überrascht wie die, die ihm
zusehen. Nun habe ich doch vom Künstler statt
vom Menschen gesprochen: aber niemals läßt sich
das eine vom anderen trennen. Und weit eher
läßt sich der Mensch durch den Künstler erklären
als umgekehrt. Habe ich nur noch gesagt, daß ich
— abgesehen von dem unvermeidlichen Tropfen
Müdigkeit im Wesen des Aäyundvierzigjährigcn
— ihn heut genau so jung und kindlich, so
seelenbedürftig, so glühend für seine Sache und
verwandte Elemente und so voll geistiger Anmut
finde wie vor siebzehn Zähren, nenne irl) Schopen-
hauer, Goethe, Shakespeare, Hosfmann, Eichen-
dorff. Ibsen, Bürger als die Geister, deren Be-
such ihn so beseligen würde, wie seinen „Pale-
strina" der der alten Meister, so glaube ich mich
so deutlich über Psitzner's Wesen geäußert zu
haben, als es mir möglich war.
Zn einer Aufführung der „Rose vom Liebes-
garten" in Mannheim saß icl> einmal Neben Char-
pentier, dem Komponisten der „Louise". Als ich
ihn nach seinem Eindruck fragte, erwiderte er:
«bion. ni n mon eher Walter c’e-t tiop chaste
pour moi>. Keuschheit — dieses Wort paßt auf
Psitzner's Kunst und Wesen: Reinheit und Wahr-
heit sind die moralischen Grundzllge seines Werkes ;
die Meisterung alles Handwerksmäßigen, auf die
sich jede große Kunslleistung erst gründen kann,
hat sich seit: tiefer Ernst erzwungen; vor dem rein-
künstlerischen der Kunst, von dem nun zu sprechen
wäre, hat das Wort zu verstummen. Sollte ich
trotzdem unkluger Weise das Spezifische seiner
Melodik — ich meine das Persönliche seiner musi-
kalischen Erfindung — durch ein Wort zu be-
zeichnen suchen, so möchte ich — in einem ihm
gewiß sympathischen Vergleich — sagen, daß mich
seine Melodik oft wie von einem Duft erfüllt dünkt
gleich der edelsten Weinesblume, in der man den
Sonnenschein zu schlürfen glaubt, der die Traube
gereift hat. Es ist der Duft der cchlcsten Romantik
in dem Trank, den uns die reine, zarte und kraft-
volle Hand Psitzner's bereitet hat. Die reine Hand
— möclite ich noch einmal besonders betonen. Wem
am Moralischen des Künstlers etwas liegt, weil
er erkannt hat, daß letzten Endes die tiefsten und
wichtigsten Wirkungen der Kunst doch hiervon aus-
gehen, wird sich durch den Gedanken beglückt und
gestärkt fühlen, daß noch Jemand wie Hans Pfitzner
unter uns lebt und wirkt.
*
Verheißung
Fülle dich, geliebte Stille,
Mit erlöster Melodie;
Daß aus meinem Innern quille,
Was mir ewiger Traum verlieh.
Wieder will ich fragend staunen:
Singt der Himmel? Singt mein Blut?
Meine Lippen, die noch raunen,
Fühlen schon des Liedes Glut.
Und ich horche in die Weiten,
Horche lief in mich und weiß,
Wunder wird sich neu bereiten,
Meine Seele gab ich preis.
Alfred Grünewald (Wien)
vis Nacht Anton Schönmarui
2lbend bei d er Zltnlter
Als Bnblein zog ich oft Dich zum Klavier,
Daß Du mit Deinen jugendschönen Händen
Der Klänge goldne Welt erschlössest mir:
Und selig horcht' ich innerstem Verschwenden . .
Mein Mütterchen, im Lehnstuhl vorgeneigt.
Wie bist Du nun so müd und still geworden!
Der Abend dunkelt, und die Stube schweigt.
Nachsinnend längstverzitterten Akkorden.
Und eine welke Hand, in zagem Trieb
Sucht sie die meine — leise, wie von ferne.
Wie Kindesbitten klingt es: „Sei so lieb
Und spiel' mir etivag vor, ich hör's so gerne!"
Mich ttbermannt's . . >vas ist nun unser Wert?
Wer kann nun ivirklich geben? Wer empfangen?
Dag irre Treiben, das sich selbst verkehrt,
Jst's nicht ein Hohn auf jedes Glnckverlaugen?
Doch schlag' ich an. Und wie die freie Flut
Der Rhythmen mir die Seele löst und iveitet,
Da dünkt mich wieder alles recht imö gut,
Ob auch das dumme Herz dawider streitet . .
Und klar erschau' ich'ö: Geber sind wir nie,
Uns allen ivird das Schöne nur geliehen,
Bald Dir, bald mir als kurze Phantasie
2lus jener großen Flnt der Harmomeen!
Uns schiebt die Zeit im Kreise hin und her,
Sodaß ivir wuuderlich die Rollen tauschen —
Doch ewig rauscht der Töne reiches Meer
Und läßt im (lberfchwall kein Seelchen leer,
Ob ivir nun musizieren oder lauschen.
Haiiiis von Gumppenbcrg
*
Gedanken
Die aufdringliche Moral vieler Menschen ist
das Dementi ihrer geheimen Laster.
Es ist das Kennzeichen des Proleten, seine
Genüsse auszukosten.
*
Eines der Kennzeichen des Genies ist sein
Egoismus. Darum vielleicht halten sich so viele
Egoisten für Genies.
*
Nur die schwachen Talente schütteln ihre Gei-
steskinder aus dem Ärmel.
*
Die Eifersucht des Mannes ist die Macht der
Frau. Die Eifersucht der Frau ist die Sklaven-
kette des Mannes.
-i-
Die Frauen haben aus der Lüge eine Kunst
gemacht und damit die Daseinsberechtigung der
Lüge bewiesen.
Hinter dem Lächeln eines Mannes, dessen
schöne Frau man preist, lauert die Tragödie.
Zufriedenheit ist der Berdauungszustand einer
Bestie. Ernst JMavkwnrt
64
denn seit ich 1894, als Chordirektor und xter
Kapellmeister des Hamburger Stadtlhcaters, den
Klavierauszug des „Armen Heinrich" kennen ge-
lernt hatte, liebte ich Pfitzner. Das Bild Pfitzncrs,
das ich aus seinen: Werk gewonnen hatte, wurde
durch die persönliche Bekanntschaft naiürlich un-
endlich erweitert. Zu dem Gefühl der Bereicherung,
das der glühend erfüllte Mensch jedem bringen
muh, der ihm näher tritt, und das ich erwartet
hatte, kam die Freude an manchen unerwarteten,
überraschenden Zügen. Am hcrvorlrctendsten und
persönlichsten erschien mir eine — ich kann kein
besseres Wort dafür finden — gewisse geistige
Anmut heiterer Art. Wir finden sie zur Kunst
geworden in manchem Pfitzner'schen Lied und in
den Anfangsszcncn der „Rose vom Licbesgarten,"
die, hätte ich sie früher gekannt, mir diesen Zug
schon vor der Anknüpfung persönlicher Beziehungen
verraten hätte. Nun lernte ich, 1900, die „Rose"
durch ihn selbst kennen, und er erinnerte sich und
mich neulich, daß ich damals sagte: „Das wird
leben." Hier möchte ich nun für einen Augen-
blick das persönliche Gebiet, .auf das sich eigentlich
diese Betrachtungen beschränken sollten, verlassen,
um mit der Sicherheit des Gereiften das Urteil
des damaligen jungen Enthusiasten zu unter-
schreiben. Obgleich diesem durch die blühendste
Melodik einer künftigen Popularität sicheren
Werke der Weg nicht leicht geworden ist, unter-
sä>rcibt dasselbe Urteil heut' schon eine ganze
Gemeinde mit mir. Und da ich bei den Ab-
schweifungen bin, möchte ich an dieser Stelle mit
Dankbarkeit Gustav Mahler's, des wahren Nach-
folgers Hans von Bülow's und größten Diri-
genten seit jener Zeit gedenken, dessen unvergeßlich
herrliche Aufführung der „Rose vom Liebesgarten"
für Pfitzner eine große lind treue Anhängerschaft
in Wien gescliaffcn hat.
Nun ist das dritte große Bühnenwerk Pfitz-
ner's erklungen, und wer glaubte nicht, was auch
noch folgen mag, das Bild des Künstlers jetzt
klar zu erkennen? Fch rate zur Vorsicht: wer
hätte z. B. von dem subjektiven Künstler, dem Ro-
mantiker, die grandiose Objektivität des 2. Aktes
„Palestrina" erwartet? — Es gibt Menschen der
Entwickelung: mit klarem Blick suchen sie die
Welt wie das eigene Wesen immer tiefer zu er-
gründen, um die Kräfte an ihr zr> nähren und zu
bereichern und die Möglichkeiten harmonischer in-
dividueller Entwickelung systematisch auszunützen;
an Wilhelm Meister sehen wir diesen Typ lebens-
voll vor uns. Anders der Romantiker: alles
Systematische im Verhältnis zur Welt fehlt ihm;
seine Leistungen werden ihm diktiert wie seine
Lebenszustände: steckteer nicht mitten darin, er
würde davon ebenso überrascht wie die, die ihm
zusehen. Nun habe ich doch vom Künstler statt
vom Menschen gesprochen: aber niemals läßt sich
das eine vom anderen trennen. Und weit eher
läßt sich der Mensch durch den Künstler erklären
als umgekehrt. Habe ich nur noch gesagt, daß ich
— abgesehen von dem unvermeidlichen Tropfen
Müdigkeit im Wesen des Aäyundvierzigjährigcn
— ihn heut genau so jung und kindlich, so
seelenbedürftig, so glühend für seine Sache und
verwandte Elemente und so voll geistiger Anmut
finde wie vor siebzehn Zähren, nenne irl) Schopen-
hauer, Goethe, Shakespeare, Hosfmann, Eichen-
dorff. Ibsen, Bürger als die Geister, deren Be-
such ihn so beseligen würde, wie seinen „Pale-
strina" der der alten Meister, so glaube ich mich
so deutlich über Psitzner's Wesen geäußert zu
haben, als es mir möglich war.
Zn einer Aufführung der „Rose vom Liebes-
garten" in Mannheim saß icl> einmal Neben Char-
pentier, dem Komponisten der „Louise". Als ich
ihn nach seinem Eindruck fragte, erwiderte er:
«bion. ni n mon eher Walter c’e-t tiop chaste
pour moi>. Keuschheit — dieses Wort paßt auf
Psitzner's Kunst und Wesen: Reinheit und Wahr-
heit sind die moralischen Grundzllge seines Werkes ;
die Meisterung alles Handwerksmäßigen, auf die
sich jede große Kunslleistung erst gründen kann,
hat sich seit: tiefer Ernst erzwungen; vor dem rein-
künstlerischen der Kunst, von dem nun zu sprechen
wäre, hat das Wort zu verstummen. Sollte ich
trotzdem unkluger Weise das Spezifische seiner
Melodik — ich meine das Persönliche seiner musi-
kalischen Erfindung — durch ein Wort zu be-
zeichnen suchen, so möchte ich — in einem ihm
gewiß sympathischen Vergleich — sagen, daß mich
seine Melodik oft wie von einem Duft erfüllt dünkt
gleich der edelsten Weinesblume, in der man den
Sonnenschein zu schlürfen glaubt, der die Traube
gereift hat. Es ist der Duft der cchlcsten Romantik
in dem Trank, den uns die reine, zarte und kraft-
volle Hand Psitzner's bereitet hat. Die reine Hand
— möclite ich noch einmal besonders betonen. Wem
am Moralischen des Künstlers etwas liegt, weil
er erkannt hat, daß letzten Endes die tiefsten und
wichtigsten Wirkungen der Kunst doch hiervon aus-
gehen, wird sich durch den Gedanken beglückt und
gestärkt fühlen, daß noch Jemand wie Hans Pfitzner
unter uns lebt und wirkt.
*
Verheißung
Fülle dich, geliebte Stille,
Mit erlöster Melodie;
Daß aus meinem Innern quille,
Was mir ewiger Traum verlieh.
Wieder will ich fragend staunen:
Singt der Himmel? Singt mein Blut?
Meine Lippen, die noch raunen,
Fühlen schon des Liedes Glut.
Und ich horche in die Weiten,
Horche lief in mich und weiß,
Wunder wird sich neu bereiten,
Meine Seele gab ich preis.
Alfred Grünewald (Wien)
vis Nacht Anton Schönmarui
2lbend bei d er Zltnlter
Als Bnblein zog ich oft Dich zum Klavier,
Daß Du mit Deinen jugendschönen Händen
Der Klänge goldne Welt erschlössest mir:
Und selig horcht' ich innerstem Verschwenden . .
Mein Mütterchen, im Lehnstuhl vorgeneigt.
Wie bist Du nun so müd und still geworden!
Der Abend dunkelt, und die Stube schweigt.
Nachsinnend längstverzitterten Akkorden.
Und eine welke Hand, in zagem Trieb
Sucht sie die meine — leise, wie von ferne.
Wie Kindesbitten klingt es: „Sei so lieb
Und spiel' mir etivag vor, ich hör's so gerne!"
Mich ttbermannt's . . >vas ist nun unser Wert?
Wer kann nun ivirklich geben? Wer empfangen?
Dag irre Treiben, das sich selbst verkehrt,
Jst's nicht ein Hohn auf jedes Glnckverlaugen?
Doch schlag' ich an. Und wie die freie Flut
Der Rhythmen mir die Seele löst und iveitet,
Da dünkt mich wieder alles recht imö gut,
Ob auch das dumme Herz dawider streitet . .
Und klar erschau' ich'ö: Geber sind wir nie,
Uns allen ivird das Schöne nur geliehen,
Bald Dir, bald mir als kurze Phantasie
2lus jener großen Flnt der Harmomeen!
Uns schiebt die Zeit im Kreise hin und her,
Sodaß ivir wuuderlich die Rollen tauschen —
Doch ewig rauscht der Töne reiches Meer
Und läßt im (lberfchwall kein Seelchen leer,
Ob ivir nun musizieren oder lauschen.
Haiiiis von Gumppenbcrg
*
Gedanken
Die aufdringliche Moral vieler Menschen ist
das Dementi ihrer geheimen Laster.
Es ist das Kennzeichen des Proleten, seine
Genüsse auszukosten.
*
Eines der Kennzeichen des Genies ist sein
Egoismus. Darum vielleicht halten sich so viele
Egoisten für Genies.
*
Nur die schwachen Talente schütteln ihre Gei-
steskinder aus dem Ärmel.
*
Die Eifersucht des Mannes ist die Macht der
Frau. Die Eifersucht der Frau ist die Sklaven-
kette des Mannes.
-i-
Die Frauen haben aus der Lüge eine Kunst
gemacht und damit die Daseinsberechtigung der
Lüge bewiesen.
Hinter dem Lächeln eines Mannes, dessen
schöne Frau man preist, lauert die Tragödie.
Zufriedenheit ist der Berdauungszustand einer
Bestie. Ernst JMavkwnrt
64