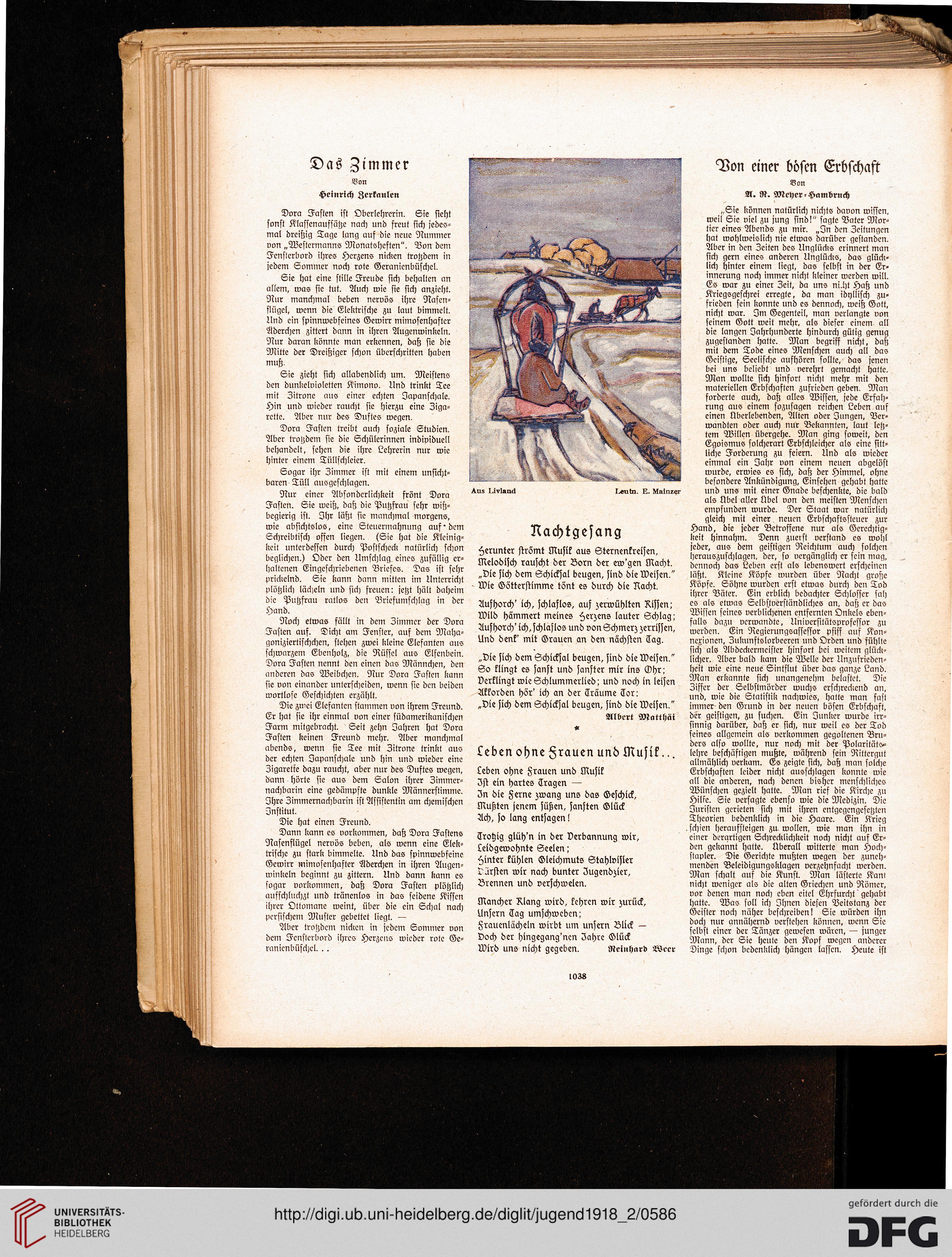Das Zimmer
Bon
Heinrich Zerkaulen
Dora Fasten ist Oberlehrerin. Sie sieht
sonst Klassenaufsätze nach und freut sich jedes-
mal dreißig Tage lang auf die neue Nummer
von „Westermanns Monatsheften". Bon dem
Fensterbord ihres Herzens nicken trotzdem in
jedem Sommer noch rote Geranienbüschel.
Sie hat eine stille Freude sich behalten an
allem, was sie tut. Auch wie sie sich anzicht.
Nur manchmal beben nervös ihre Nasen-
flügel, wenn die Elektrische zu laut bimmelt,
lind ein spinnwebfeines Gewirr mimosenhafter
Äderchen zittert dann in ihren Augenwinkeln.
Nur daran könnte man erkennen, daß sie die
Mitte der Dreißiger schon überschritten haben
muß.
Sie zieht sich allabendlich um. Meistens
den dunkelvioletten Kimono. Und trinkt Tee
mit Zitrone aus einer echten Japanschale.
Hin und wieder raucht sie hierzu eine Ziga-
rette. Aber nur des Duftes wegen.
Dora Fasten treibt auch soziale Studien.
Aber trotzdem sie die Schülerinnen individuell
behandelt, sehen die ihre Lehrerin nur wie
hinter einem Tüllschleier.
Sogar ihr Zimmer ist mit einem unsicht-
baren Tüll ausgeschlagen.
Nur einer Absonderlichkeit frönt Dora
Fasten. Sie weiß, daß die Putzfrau sehr wiß-
begierig ist. Ihr läßt sie manchmal morgens,
wie absichtslos, eine Stcuermahnung auf'dem
Schreibtisch offen liegen. (Sie hat die Kleinig-
keit unterdessen durch Postscheck natürlich schon
beglichen.) Oder den Umschlag eines zufällig er-
haltenen Eingeschriebenen Briefes. Das ist sehr
prickelnd. Sie kann dann mitten im Unterricht
plötzlich lächeln und sich freuen: jetzt hält daheim
die Putzfrau ratlos den Briefumschlag in der
Hand.
Noch etwas fällt in dem Zimmer der Dora
Fasten auf. Dicht am Fenster, auf dem Maha-
goniziertischchen, stehen zwei kleine Elefanten aus
schwarzem Ebenholz, die Rüssel aus Elfenbein.
Dora Fasten nennt den einen das Männchen, den
anderen das Weibchen. Nur Dora Fasten kann
sie von einander unterscheiden, wenn sie den beiden
wortlose Geschichten erzählt.
Die zwei Elefanten stammen von ihrem Freund.
Er hat sie ihr einmal von einer südamerikanischen
Farm mitgebracht. Seit zehn Jahren hat Dorn
Fasten keinen Freund mehr. Aber manchmal
abends, wenn sie Tee mit Zitrone trinkt aus
der echten Iapanschale und hin und wieder eine
Zigaretie dazu raucht, aber nur des Duftes wegen,
dann hörte sie aus dem Salon ihrer Zimmer-
nachbarin eine gedämpfte dunkle Männerstimme.
Ihre Zimmernachbarin ist Assistentin am chemischen
Institut.
Die hat einen Freund.
Dann kann es Vorkommen, daß Dora Fastens
Nasenflügel nervös beben, als wenn eine Elek-
trische zu stark bimmelte. Und das spinnwebfeine
Gewirr mimosenhafter Äderchen in ihren Augen-
winkeln beginnt zu zittern. Und dann kann es
sogar Vorkommen, daß Dora Fasten plötzlich
aufschluchzt und tränenlos in das seidene Kissen
ihrer Ottomane weint, über die ein Schal nach
persischem Muster gebettet liegt. —
Aber trotzdem nicken in jedem Sommer von
dem Fensterbord ihres Herzens wieder rote Gc-
ranicnbüschel. ..
Rachtgesang
Herunter strömt Musik aus Sternenkreisen,
Melodisch rauscht der Born der ew'gen Macht.
„Die sich dem Schicksal beugen, sind die Weisen."
Wie Götterstimme tönt es durch die Rächt.
Aufhorch' ich, schlaflos, auf zerwühlten Rissen;
Wild hämmert meines Herzens lauter Schlag;
Aufhorch' ich, schlaflos und von Schmer; zerrissen,
Und denk' mit Grauen an den nächsten Tag.
„Oie sich dem Schicksal beugen, sind die Weisen."
So klingt es sanft und sanfter mir ins Dhr;
verklingt wie Schlummerlied: und noch in leisen
Akkorden hör' ich an der Träume Tor;
„Die sich dem Schicksal beugen, sind die weisen."
Albert Matthäi
*
Leben ohne Zrauen und Nusik...
Leben ohne grauen und Musik
Ist ein hartes Tragen —
In die gerne zwang uns das Geschick,
Muhten jenem sühen, sanften Glück
Ach, so lang entsagen!
Trotzig glüh'n in der Verbannung wir,
Leidgewohnte Seelen;
Hinter kühlen Gleichmuts Stahlvisler
Dürsten wir nach bunter Iugendzler,
Brennen und verschwelen.
Mancher Rlang wird, kehren wir zurück.
Unfern Tag umschweben;
grauenlächeln wirbt um unfern Blick —
Doch der hingegang'nen Jahre Glück
Wird uns nicht gegeben. Reinhard Wecr
Von einer bösen Erbschaft
Von
A. R. Meyer -Hambrnch
„Sie können natürlich nichts davon wisien,
weil Sie viel zu jung sind!" sagte Vater Mor-
tier eines Abends zu mir. „In den Zeitungen
hat wohlweislich nie etwas darüber gestanden.
Aber in den Zeiten des Unglücks erinnert man
sich gern eines anderen Unglücks, das glück-
lich hinter einem liegt, das selbst in der Er-
innerung noch immer nicht kleiner werden will.
Es war zu einer Zeit, da uns nicht Haß und
Kriegsgeschrei erregte, da man idyllisch zu-
frieden sein konnte und es dennoch, weiß Gott,
nicht war. Im Gegenteil, man verlangte von
seinem Gott weit mehr, als dieser einem all
die langen Jahrhunderte hindurch gütig genug
zugestanden hatte. Man begriff nicht, daß
mit dem Tode eines Menschen auch all das
Geistige, Seelische aufhören sollte, das jenen
bei uns beliebt und verehrt gemacht hatte.
Man wollte sich hinfort nicht mehr mit den
materiellen Erbschaften zufrieden geben. Man
forderte auch, daß alles Wissen, jede Erfah-
rung aus einem sozusagen reichen Leben auf
einen Überlebenden, Alten oder Jungen, Ver-
wandten oder auch nur Bekannten, laut letz-
tem Willen übergehe. Man ging soweit, den
Egoismus solcherart Erbschleicher als eine sitt-
liche Forderung zu feiern. Und als wieder
einmal ein Jahr von einem neuen abgelöst
wurde, erwies es sich, daß der Himmel, ohne
besondere Ankündigung, Einsehen gehabt hatte
und uns mit einer Gnade beschenkte, die bald
als Übel aller Übel von den meisten Menschen
empfunden wurde. Der Staat war natürlich
gleich mit einer neuen Erbschaftssteuer zur
Hand, die jeder Betroffene nur ais Gerechtig-
keit hinnahm. Denn zuerst verstand es wohl
jeder, aus dem geistigen Reichtum auch solchen
herauszuschlagen, der, so vergänglich er sein mag,
dennoch das Leben erst als lebenswert erscheinen
läßt. Kleine Köpfe wurden über Nacht große
Köpfe. Söhne wurden erst etwas durch den Tod
ihrer Väter. Ein erblich bedachter Schlosser sah
es als etwas Selbstverständliches an, daß er das
Wissen seines verblichenen entfernten Onkels eben-
falls dazu verwandte, Universitätsprofeffor zu
werden. Ein Regierungsaffeffor pfiff auf Kon-
nexionen, Zukunftslorbeeren und Orden und fühlte
sich als Abdeckermeister hinfort bei weitem glück-
licher. Aber bald kam die Welle der Unzufrieden-
heit wie eine neue Sintflut über das ganze Land.
Man erkannte sich unangenehm belastet. Die
Ziffer der Selbstmörder wuchs erschreckend an,
und, wie die Statistik nachwies, hatte man fast
immer den Grund in der neuen bösen Erbschaft,
der geistigen, zu suchen. Ein Junker wurde irr-
sinnig darüber, daß er sich, nur weil es der Tod
seines allgemein als verkommen gegoltenen Bru-
ders also wollte, nur noch mit der Polaritäte--
lehre beschäftigen mußte, während sein Rittergut
allmählich verkam. Es zeigte sich, daß man solche
Erbschaften leider nicht ausschlagen konnte wie
all die anderen, nach denen bisher menschliches
Wünschen gezielt hatte. Man rief die Kirche zu
Hille. Eie versagte ebenso wie die Medizin. Die
Juristen gerieten sich mit ihren entgegengesetzten
Theorien bedenklich in die Haare. Ein Krieg
. schien heraufsteigen zu. wollen, wie man ihn in
einer derartigen Schrecklichkeit noch nicht auf Er-
den gekannt hatte. Überall witterte man Hoch-
stapler. Die Gerichte mußten wegen der zuneh-
menden Beleidigungsklagen verzehnfacht werden.
Man schalt auf die Kunst. Man lästerte Kant
nicht weniger ais die alten Griechen und Römer,
vor denen man noch eben eitel Ehrfurcht gehabt
hatte. Was soll ich Ihnen diesen Veitstanz der
Geister noch näher beschreiben! Eie würden ihn
doch nur annähernd verstehen können, wenn Sie
selbst einer der Tänzer gewesen wären, — junger
Mann, der Sie heute den Kopf wegen anderer
Dinge schon bedenklich hängen lassen. Heute ist
1038
Bon
Heinrich Zerkaulen
Dora Fasten ist Oberlehrerin. Sie sieht
sonst Klassenaufsätze nach und freut sich jedes-
mal dreißig Tage lang auf die neue Nummer
von „Westermanns Monatsheften". Bon dem
Fensterbord ihres Herzens nicken trotzdem in
jedem Sommer noch rote Geranienbüschel.
Sie hat eine stille Freude sich behalten an
allem, was sie tut. Auch wie sie sich anzicht.
Nur manchmal beben nervös ihre Nasen-
flügel, wenn die Elektrische zu laut bimmelt,
lind ein spinnwebfeines Gewirr mimosenhafter
Äderchen zittert dann in ihren Augenwinkeln.
Nur daran könnte man erkennen, daß sie die
Mitte der Dreißiger schon überschritten haben
muß.
Sie zieht sich allabendlich um. Meistens
den dunkelvioletten Kimono. Und trinkt Tee
mit Zitrone aus einer echten Japanschale.
Hin und wieder raucht sie hierzu eine Ziga-
rette. Aber nur des Duftes wegen.
Dora Fasten treibt auch soziale Studien.
Aber trotzdem sie die Schülerinnen individuell
behandelt, sehen die ihre Lehrerin nur wie
hinter einem Tüllschleier.
Sogar ihr Zimmer ist mit einem unsicht-
baren Tüll ausgeschlagen.
Nur einer Absonderlichkeit frönt Dora
Fasten. Sie weiß, daß die Putzfrau sehr wiß-
begierig ist. Ihr läßt sie manchmal morgens,
wie absichtslos, eine Stcuermahnung auf'dem
Schreibtisch offen liegen. (Sie hat die Kleinig-
keit unterdessen durch Postscheck natürlich schon
beglichen.) Oder den Umschlag eines zufällig er-
haltenen Eingeschriebenen Briefes. Das ist sehr
prickelnd. Sie kann dann mitten im Unterricht
plötzlich lächeln und sich freuen: jetzt hält daheim
die Putzfrau ratlos den Briefumschlag in der
Hand.
Noch etwas fällt in dem Zimmer der Dora
Fasten auf. Dicht am Fenster, auf dem Maha-
goniziertischchen, stehen zwei kleine Elefanten aus
schwarzem Ebenholz, die Rüssel aus Elfenbein.
Dora Fasten nennt den einen das Männchen, den
anderen das Weibchen. Nur Dora Fasten kann
sie von einander unterscheiden, wenn sie den beiden
wortlose Geschichten erzählt.
Die zwei Elefanten stammen von ihrem Freund.
Er hat sie ihr einmal von einer südamerikanischen
Farm mitgebracht. Seit zehn Jahren hat Dorn
Fasten keinen Freund mehr. Aber manchmal
abends, wenn sie Tee mit Zitrone trinkt aus
der echten Iapanschale und hin und wieder eine
Zigaretie dazu raucht, aber nur des Duftes wegen,
dann hörte sie aus dem Salon ihrer Zimmer-
nachbarin eine gedämpfte dunkle Männerstimme.
Ihre Zimmernachbarin ist Assistentin am chemischen
Institut.
Die hat einen Freund.
Dann kann es Vorkommen, daß Dora Fastens
Nasenflügel nervös beben, als wenn eine Elek-
trische zu stark bimmelte. Und das spinnwebfeine
Gewirr mimosenhafter Äderchen in ihren Augen-
winkeln beginnt zu zittern. Und dann kann es
sogar Vorkommen, daß Dora Fasten plötzlich
aufschluchzt und tränenlos in das seidene Kissen
ihrer Ottomane weint, über die ein Schal nach
persischem Muster gebettet liegt. —
Aber trotzdem nicken in jedem Sommer von
dem Fensterbord ihres Herzens wieder rote Gc-
ranicnbüschel. ..
Rachtgesang
Herunter strömt Musik aus Sternenkreisen,
Melodisch rauscht der Born der ew'gen Macht.
„Die sich dem Schicksal beugen, sind die Weisen."
Wie Götterstimme tönt es durch die Rächt.
Aufhorch' ich, schlaflos, auf zerwühlten Rissen;
Wild hämmert meines Herzens lauter Schlag;
Aufhorch' ich, schlaflos und von Schmer; zerrissen,
Und denk' mit Grauen an den nächsten Tag.
„Oie sich dem Schicksal beugen, sind die Weisen."
So klingt es sanft und sanfter mir ins Dhr;
verklingt wie Schlummerlied: und noch in leisen
Akkorden hör' ich an der Träume Tor;
„Die sich dem Schicksal beugen, sind die weisen."
Albert Matthäi
*
Leben ohne Zrauen und Nusik...
Leben ohne grauen und Musik
Ist ein hartes Tragen —
In die gerne zwang uns das Geschick,
Muhten jenem sühen, sanften Glück
Ach, so lang entsagen!
Trotzig glüh'n in der Verbannung wir,
Leidgewohnte Seelen;
Hinter kühlen Gleichmuts Stahlvisler
Dürsten wir nach bunter Iugendzler,
Brennen und verschwelen.
Mancher Rlang wird, kehren wir zurück.
Unfern Tag umschweben;
grauenlächeln wirbt um unfern Blick —
Doch der hingegang'nen Jahre Glück
Wird uns nicht gegeben. Reinhard Wecr
Von einer bösen Erbschaft
Von
A. R. Meyer -Hambrnch
„Sie können natürlich nichts davon wisien,
weil Sie viel zu jung sind!" sagte Vater Mor-
tier eines Abends zu mir. „In den Zeitungen
hat wohlweislich nie etwas darüber gestanden.
Aber in den Zeiten des Unglücks erinnert man
sich gern eines anderen Unglücks, das glück-
lich hinter einem liegt, das selbst in der Er-
innerung noch immer nicht kleiner werden will.
Es war zu einer Zeit, da uns nicht Haß und
Kriegsgeschrei erregte, da man idyllisch zu-
frieden sein konnte und es dennoch, weiß Gott,
nicht war. Im Gegenteil, man verlangte von
seinem Gott weit mehr, als dieser einem all
die langen Jahrhunderte hindurch gütig genug
zugestanden hatte. Man begriff nicht, daß
mit dem Tode eines Menschen auch all das
Geistige, Seelische aufhören sollte, das jenen
bei uns beliebt und verehrt gemacht hatte.
Man wollte sich hinfort nicht mehr mit den
materiellen Erbschaften zufrieden geben. Man
forderte auch, daß alles Wissen, jede Erfah-
rung aus einem sozusagen reichen Leben auf
einen Überlebenden, Alten oder Jungen, Ver-
wandten oder auch nur Bekannten, laut letz-
tem Willen übergehe. Man ging soweit, den
Egoismus solcherart Erbschleicher als eine sitt-
liche Forderung zu feiern. Und als wieder
einmal ein Jahr von einem neuen abgelöst
wurde, erwies es sich, daß der Himmel, ohne
besondere Ankündigung, Einsehen gehabt hatte
und uns mit einer Gnade beschenkte, die bald
als Übel aller Übel von den meisten Menschen
empfunden wurde. Der Staat war natürlich
gleich mit einer neuen Erbschaftssteuer zur
Hand, die jeder Betroffene nur ais Gerechtig-
keit hinnahm. Denn zuerst verstand es wohl
jeder, aus dem geistigen Reichtum auch solchen
herauszuschlagen, der, so vergänglich er sein mag,
dennoch das Leben erst als lebenswert erscheinen
läßt. Kleine Köpfe wurden über Nacht große
Köpfe. Söhne wurden erst etwas durch den Tod
ihrer Väter. Ein erblich bedachter Schlosser sah
es als etwas Selbstverständliches an, daß er das
Wissen seines verblichenen entfernten Onkels eben-
falls dazu verwandte, Universitätsprofeffor zu
werden. Ein Regierungsaffeffor pfiff auf Kon-
nexionen, Zukunftslorbeeren und Orden und fühlte
sich als Abdeckermeister hinfort bei weitem glück-
licher. Aber bald kam die Welle der Unzufrieden-
heit wie eine neue Sintflut über das ganze Land.
Man erkannte sich unangenehm belastet. Die
Ziffer der Selbstmörder wuchs erschreckend an,
und, wie die Statistik nachwies, hatte man fast
immer den Grund in der neuen bösen Erbschaft,
der geistigen, zu suchen. Ein Junker wurde irr-
sinnig darüber, daß er sich, nur weil es der Tod
seines allgemein als verkommen gegoltenen Bru-
ders also wollte, nur noch mit der Polaritäte--
lehre beschäftigen mußte, während sein Rittergut
allmählich verkam. Es zeigte sich, daß man solche
Erbschaften leider nicht ausschlagen konnte wie
all die anderen, nach denen bisher menschliches
Wünschen gezielt hatte. Man rief die Kirche zu
Hille. Eie versagte ebenso wie die Medizin. Die
Juristen gerieten sich mit ihren entgegengesetzten
Theorien bedenklich in die Haare. Ein Krieg
. schien heraufsteigen zu. wollen, wie man ihn in
einer derartigen Schrecklichkeit noch nicht auf Er-
den gekannt hatte. Überall witterte man Hoch-
stapler. Die Gerichte mußten wegen der zuneh-
menden Beleidigungsklagen verzehnfacht werden.
Man schalt auf die Kunst. Man lästerte Kant
nicht weniger ais die alten Griechen und Römer,
vor denen man noch eben eitel Ehrfurcht gehabt
hatte. Was soll ich Ihnen diesen Veitstanz der
Geister noch näher beschreiben! Eie würden ihn
doch nur annähernd verstehen können, wenn Sie
selbst einer der Tänzer gewesen wären, — junger
Mann, der Sie heute den Kopf wegen anderer
Dinge schon bedenklich hängen lassen. Heute ist
1038