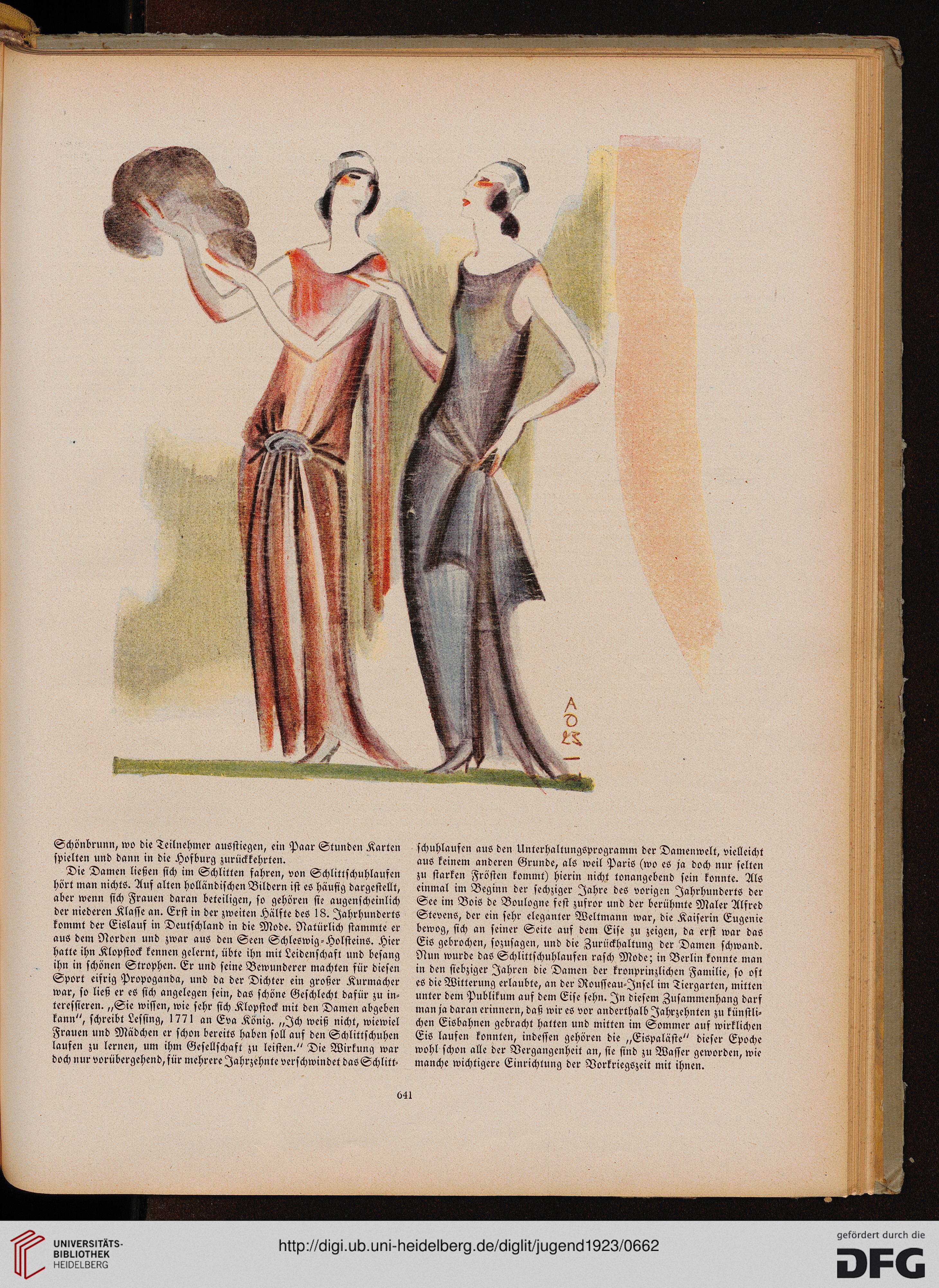Schönbrunn, wo die Teilnehmer aussticgen, ei» Paar Stunden Karten
spielten und dann in die Hofburg zurückkehrten.
Die Damen ließen sich im Schlitten fahren, von Schlittschuhlaufen
hört man nichts. Auf alten holländischen Bildern ist es häufig dargeftellt,
aber wenn sich Frauen daran beteiligen, so gehören sie augenscheinlich
der niederen Klaffe an. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
kommt der Eislauf in Deutschland in die Mode. Natürlich stammte er
aus dem Norden und zwar aus den Seen Schleswig-Holsteins. Hier
hatte ihn Klopstock kennen gelernt, übte ihn mit Leidenschaft und besang
ihn in schönen Strophen. Er und seine Bewunderer machten für diesen
Sport eifrig Propoganda, und da der Dichter ein großer Kurmacher
war, so ließ er eö sich angelegen sein, das schöne Geschlecht dafür zu in-
teressieren. „Sie wiffen, wie sehr sich Klopstock mit den Damen abgeben
kann", schreibt Lessing, 1771 an Eva König. „Ich weiß nicht, wicwiel
Frauen und Mädchen er schon bereits haben soll auf den Schlittschuhen
laufen zu lernen, um ihm Gesellschaft zu leisten." Die Wirkung war
doch nur vorübergehend, für mehrere Jahrzehnte verschwindet das Schlitt-
schuhlaufen aus den Unterhaltungsprogramm der Damenwelt, vielleicht
aus keinem anderen Grunde, als weil Paris (wo es ja doch nur selten
zu starken Frösten kommt) hierin nicht tonangebend sein konnte. Als
einmal im Beginn der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts der
See im Bois de Boulogne fest zufror und der berühmte Maler Alfred
Stevens, der ein sehr eleganter Weltmann war, die Kaiserin Eugenie
bewog, sich an seiner Seite auf dem Eise zu zeigen, da erst war das
Eis gebrochen, sozusagen, und die Zurückhaltung der Damen schwand.
Nun wurde das Schlittschuhlaufen rasch Mode; in Berlin konnte man
in den siebziger Jahren die Damen der kronprinzlichen Familie, so oft
eS die Witterung erlaubte, an der Rouffeau-Insel im Tiergarten, mitten
unter dem Publikum auf dem Eise sehn. In diesem Zusammenhang darf
man ja daran erinnern, daß wir eS vor anderthalb Jahrzehnten zu künstli-
chen Eisbahnen gebracht hatten und mitten im Sommer auf wirklichen
Eiö laufen konnten, indessen gehören die „Eispaläste" dieser Epoche
wohl schon alle der Vergangenheit an, sie sind zu Waffer geworden, wie
manche wichtigere Einrichtung der Vorkriegszeit mit ihnen.
641
spielten und dann in die Hofburg zurückkehrten.
Die Damen ließen sich im Schlitten fahren, von Schlittschuhlaufen
hört man nichts. Auf alten holländischen Bildern ist es häufig dargeftellt,
aber wenn sich Frauen daran beteiligen, so gehören sie augenscheinlich
der niederen Klaffe an. Erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
kommt der Eislauf in Deutschland in die Mode. Natürlich stammte er
aus dem Norden und zwar aus den Seen Schleswig-Holsteins. Hier
hatte ihn Klopstock kennen gelernt, übte ihn mit Leidenschaft und besang
ihn in schönen Strophen. Er und seine Bewunderer machten für diesen
Sport eifrig Propoganda, und da der Dichter ein großer Kurmacher
war, so ließ er eö sich angelegen sein, das schöne Geschlecht dafür zu in-
teressieren. „Sie wiffen, wie sehr sich Klopstock mit den Damen abgeben
kann", schreibt Lessing, 1771 an Eva König. „Ich weiß nicht, wicwiel
Frauen und Mädchen er schon bereits haben soll auf den Schlittschuhen
laufen zu lernen, um ihm Gesellschaft zu leisten." Die Wirkung war
doch nur vorübergehend, für mehrere Jahrzehnte verschwindet das Schlitt-
schuhlaufen aus den Unterhaltungsprogramm der Damenwelt, vielleicht
aus keinem anderen Grunde, als weil Paris (wo es ja doch nur selten
zu starken Frösten kommt) hierin nicht tonangebend sein konnte. Als
einmal im Beginn der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts der
See im Bois de Boulogne fest zufror und der berühmte Maler Alfred
Stevens, der ein sehr eleganter Weltmann war, die Kaiserin Eugenie
bewog, sich an seiner Seite auf dem Eise zu zeigen, da erst war das
Eis gebrochen, sozusagen, und die Zurückhaltung der Damen schwand.
Nun wurde das Schlittschuhlaufen rasch Mode; in Berlin konnte man
in den siebziger Jahren die Damen der kronprinzlichen Familie, so oft
eS die Witterung erlaubte, an der Rouffeau-Insel im Tiergarten, mitten
unter dem Publikum auf dem Eise sehn. In diesem Zusammenhang darf
man ja daran erinnern, daß wir eS vor anderthalb Jahrzehnten zu künstli-
chen Eisbahnen gebracht hatten und mitten im Sommer auf wirklichen
Eiö laufen konnten, indessen gehören die „Eispaläste" dieser Epoche
wohl schon alle der Vergangenheit an, sie sind zu Waffer geworden, wie
manche wichtigere Einrichtung der Vorkriegszeit mit ihnen.
641