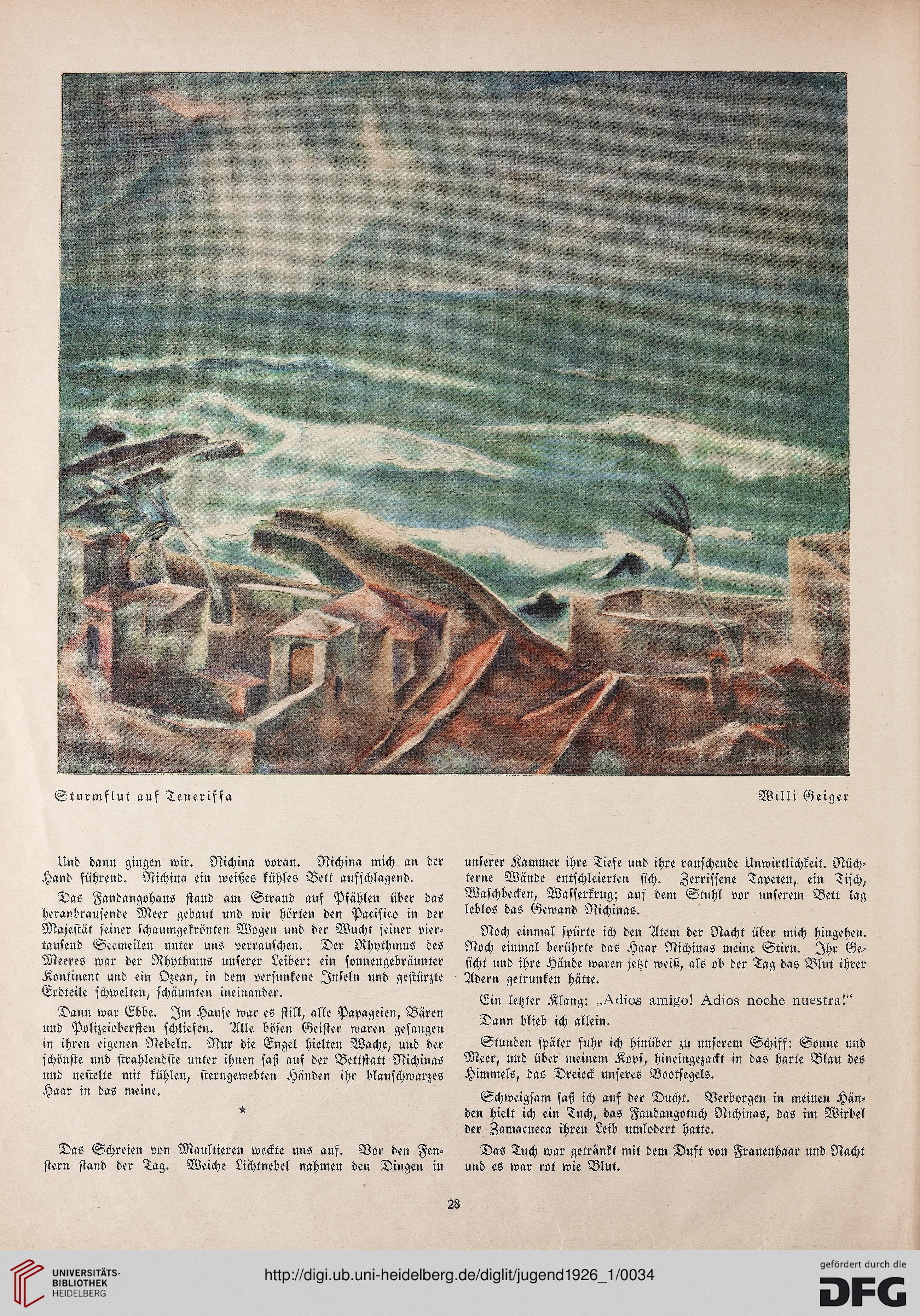Sturmflut auf Teneriffa
Willi Geiger
Und dann gingen wir. Nichina voran. Nichina mich an der
Hand führend. Nichina ein weißes kühles Bett aufschlagend.
Das Fandangohaus ftand am Strand auf Pfählen über das
heranbrausende Meer gebaut und wir hörten den Pacifico in der
Majestät feiner schaumgekrönten Wogen und der Wucht seiner vier-
tausend Seemeilen unter uns verrauschen. Der Rhythmus des
Meeres war der Rhythmus unserer Leiber: ein sonnengebräunter
Kontinent und ein Ozean, in dem versunkene Inseln und gestürzte
Erdteile schwelten, schäumten ineinander.
Dann war Ebbe. Im Hause war es still, alle Papageien, Bären
und Polizeiobersten schliefen. Alle bösen Geister waren gefangen
in ihren eigenen Nebeln. Nur die Engel hielten Wache, und der
schönste und strahlendste unter ihnen saß auf der Bettstatt Nichinas
und nestelte mit kühlen, sterngewebten Händen ihr blauschwarzes
Haar in das meine.
Das Schreien von Maultieren weckte uns auf. Vor den Fen-
stern ftand der Tag. Weiche Lichtnebel nahmen den Dingen in
unserer Kammer ihre Tiefe und ihre rauschende Unwirtlichkeit. Nüch-
terne Wände entschleierten sich. Zerrissene Tapeten, ein Tisch,
Waschbecken, Wasserkrug; auf dem Stuhl vor unserem Bett lag
leblos das Gewand Nichinas.
Noch einmal spürte ich den Atem der Nacht über mich hingehen.
Noch einmal berührte das Haar Nichinas meine Stirn. Ihr Ge-
sicht und ihre Hände waren jetzt weiß, als ob der Tag das Blut ihrer
Adern getrunken hätte.
Ein letzter Klang: „Adios amigo! Adios noche nuestra!“
Dann blieb ich allein.
Stunden später fuhr ich hinüber zu unserem Schiff: Sonne und
Meer, und über meinem Kopf, hineingezackt in das harte Blau des
Himmels, das Dreieck unseres Bootsegels.
Schweigsam saß ich auf der Ducht. Verborgen in meinen Hän-
den hielt ich ein Tuch, das Fandangotuch Nichinas, das im Wirbel
der Zamacueca ihren Leib umlodert hatte.
Das Tuch war getränkt mit dem Duft von Frauenhaar und Nacht
und es war rot wie Blut.
28
Willi Geiger
Und dann gingen wir. Nichina voran. Nichina mich an der
Hand führend. Nichina ein weißes kühles Bett aufschlagend.
Das Fandangohaus ftand am Strand auf Pfählen über das
heranbrausende Meer gebaut und wir hörten den Pacifico in der
Majestät feiner schaumgekrönten Wogen und der Wucht seiner vier-
tausend Seemeilen unter uns verrauschen. Der Rhythmus des
Meeres war der Rhythmus unserer Leiber: ein sonnengebräunter
Kontinent und ein Ozean, in dem versunkene Inseln und gestürzte
Erdteile schwelten, schäumten ineinander.
Dann war Ebbe. Im Hause war es still, alle Papageien, Bären
und Polizeiobersten schliefen. Alle bösen Geister waren gefangen
in ihren eigenen Nebeln. Nur die Engel hielten Wache, und der
schönste und strahlendste unter ihnen saß auf der Bettstatt Nichinas
und nestelte mit kühlen, sterngewebten Händen ihr blauschwarzes
Haar in das meine.
Das Schreien von Maultieren weckte uns auf. Vor den Fen-
stern ftand der Tag. Weiche Lichtnebel nahmen den Dingen in
unserer Kammer ihre Tiefe und ihre rauschende Unwirtlichkeit. Nüch-
terne Wände entschleierten sich. Zerrissene Tapeten, ein Tisch,
Waschbecken, Wasserkrug; auf dem Stuhl vor unserem Bett lag
leblos das Gewand Nichinas.
Noch einmal spürte ich den Atem der Nacht über mich hingehen.
Noch einmal berührte das Haar Nichinas meine Stirn. Ihr Ge-
sicht und ihre Hände waren jetzt weiß, als ob der Tag das Blut ihrer
Adern getrunken hätte.
Ein letzter Klang: „Adios amigo! Adios noche nuestra!“
Dann blieb ich allein.
Stunden später fuhr ich hinüber zu unserem Schiff: Sonne und
Meer, und über meinem Kopf, hineingezackt in das harte Blau des
Himmels, das Dreieck unseres Bootsegels.
Schweigsam saß ich auf der Ducht. Verborgen in meinen Hän-
den hielt ich ein Tuch, das Fandangotuch Nichinas, das im Wirbel
der Zamacueca ihren Leib umlodert hatte.
Das Tuch war getränkt mit dem Duft von Frauenhaar und Nacht
und es war rot wie Blut.
28