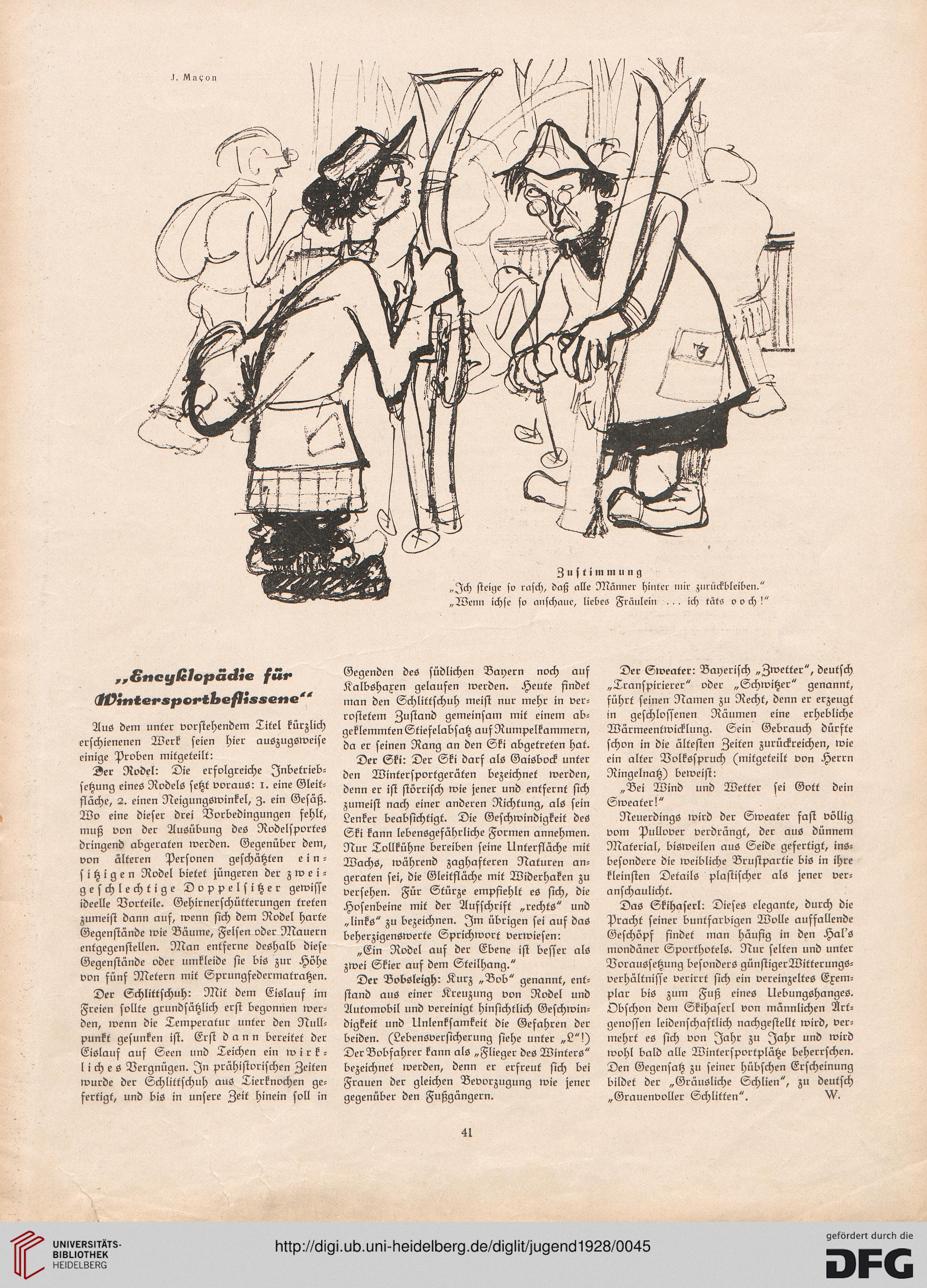J. Magon
„ßncyßlepadie für
(Winter sportbeflissene **
Aus dem unter vorstehendem Titel kürzlich
erschienenen Werk seien hier auszugsweise
einige Proben mitgeteilt:
Aer Rodel: Die ersolgreiche Inbetrieb-
setzung eines Rodels setzt voraus: l. eine Gleit-
fläche, 2. einen Neigungswinkel, Z. ein Gesäß.
Wo eine dieser drei Vorbedingungen fehlt,
muß von der Ausübung des Rodelsportes
dringend abgeraten werden. Gegenüber dem,
von älteren Personen geschätzten ein-
sitzigen Rodel bietet jüngeren der z w e i -
geschlechtige Doppelsitzer gewisse
ideelle Vorteile. Gehirnerschütterungen treten
zumeist dann auf, wenn sich dem Rodel harte
Gegenstände wie Bäume, Felsen oder Mauern
entgegenstellen. Man entferne deshalb diese
Gegenstände oder umkleide sie bis zur Höhe
von fünf Metern mit Sprungfedermatratzen.
Der Schlittschuh: Mit dem Eislauf im
Freien sollte grundsätzlich erst begonnen wer-
den, wenn die Temperatur unter den Null-
punkt gesunken ist. Erst dann bereitet der
Eislauf auf Seen und Teichen ein wirk-
liches Vergnügen. In prähistorischen Zeiten
wurde der Schlittschuh aus Tierknochen ge-
fertigt, und bis in unsere Zeit hinein soll in
Gegenden des südlichen Bayern noch auf
Kalbshaxen gelaufen werden. Heute stndet
man den Schlittschuh meist nur mehr in ver-
rostetem Zustand gemeinsam mit einem ab-
geklemmten Stiefelabsatz auf Rumpelkammern,
da er seinen Rang an den Ski abgetreten hat.
Der Ski: Der Ski darf als Gaisbock unter
den Wintersportgeräten bezeichnet werden,
denn er ist störrisch wie jener und entfernt sich
zumeist nach einer anderen Richtung, als fein
Lenker beabsichtigt. Die Geschwindigkeit des
Ski kann lebensgefährliche Formen annehmen.
Nur Tollkühne bereiben feine blnterstäche mit
Wachs, während zaghafteren Naturen an-
geraten fei, die Gleitstäche mit Widerhaken zu
versehen. Für Stürze empfiehlt cö sich, die
Hosenbeine mit der Aufschrift „rechts" und
„links" zu bezeichnen. Im übrigen fei auf dag
beherzigenswerte Sprichwort verwiesen:
„Ein Rodel auf der Ebene ist besser als
zwei Skier auf dem Steilhang."
Der Bobsleigh: Kurz „Bob" genannt, ent-
stand aus einer Kreuzung von Rodel und
Automobil und vereinigt hinsichtlich Geschwin-
digkeit und Unlenksamkeit die Gefahren der
beiden. (Lebensversicherung siehe unter „L"!)
Der Bobfahrer kann als „Flieger des Winters"
bezeichnet werden, denn er erfreut sich bei
Frauen der gleichen Bevorzugung wie jener
gegenüber den Fußgängern.
Der Sweater: Bayerisch „Zweiter", deutsch
„Transpiriercr" oder „Schwitzer" genannt,
führt seinen Namen zu Recht, denn er erzeugt
in geschlossenen Räumen eine erhebliche
Wärmeentwicklung. Sein Gebrauch dürfte
schon in die ältesten Zeiten zurückreichen, wie
ein alter Volksspruch (mitgeteilt von Herrn
Ringelnatz) beweist:
„Bei Wind und Wetter sei Gott dein
Sweater!"
Neuerdings wird der Sweater fast völlig
vom Pullover verdrängt, der aus dünnem
Material, bisweilen aus Seide gefertigt, ins-
besondere die weibliche Brustpartie bis in ihre
kleinsten Details plastischer als jener ver-
anschaulicht.
Das Skihaserl: Dieses elegante, durch die
Pracht seiner buntfarbigen Wolle auffallende
Geschöpf findet man häufig in den Hal'ö
mondäner Sporthotels. Nur selten und unter
Voraussetzung besonders günstigerWitterungS-
verhältnisse verirrt sich ein vereinzeltes Exem-
plar bis zum Fuß eines Uebungshanges.
Obschon dem Skihaserl von männlichen Art-
genossen leidenschaftlich nachgestellt wird, ver-
mehrt es sich von Jahr zu Jahr und wird
wohl bald alle Wintersportplätze beherrschen.
Den Gegensatz zu seiner hübschen Erscheinung
bildet der „Gräuöliche Schlien", zu deutsch
„Grauenvoller Schlitten". W.
41
„ßncyßlepadie für
(Winter sportbeflissene **
Aus dem unter vorstehendem Titel kürzlich
erschienenen Werk seien hier auszugsweise
einige Proben mitgeteilt:
Aer Rodel: Die ersolgreiche Inbetrieb-
setzung eines Rodels setzt voraus: l. eine Gleit-
fläche, 2. einen Neigungswinkel, Z. ein Gesäß.
Wo eine dieser drei Vorbedingungen fehlt,
muß von der Ausübung des Rodelsportes
dringend abgeraten werden. Gegenüber dem,
von älteren Personen geschätzten ein-
sitzigen Rodel bietet jüngeren der z w e i -
geschlechtige Doppelsitzer gewisse
ideelle Vorteile. Gehirnerschütterungen treten
zumeist dann auf, wenn sich dem Rodel harte
Gegenstände wie Bäume, Felsen oder Mauern
entgegenstellen. Man entferne deshalb diese
Gegenstände oder umkleide sie bis zur Höhe
von fünf Metern mit Sprungfedermatratzen.
Der Schlittschuh: Mit dem Eislauf im
Freien sollte grundsätzlich erst begonnen wer-
den, wenn die Temperatur unter den Null-
punkt gesunken ist. Erst dann bereitet der
Eislauf auf Seen und Teichen ein wirk-
liches Vergnügen. In prähistorischen Zeiten
wurde der Schlittschuh aus Tierknochen ge-
fertigt, und bis in unsere Zeit hinein soll in
Gegenden des südlichen Bayern noch auf
Kalbshaxen gelaufen werden. Heute stndet
man den Schlittschuh meist nur mehr in ver-
rostetem Zustand gemeinsam mit einem ab-
geklemmten Stiefelabsatz auf Rumpelkammern,
da er seinen Rang an den Ski abgetreten hat.
Der Ski: Der Ski darf als Gaisbock unter
den Wintersportgeräten bezeichnet werden,
denn er ist störrisch wie jener und entfernt sich
zumeist nach einer anderen Richtung, als fein
Lenker beabsichtigt. Die Geschwindigkeit des
Ski kann lebensgefährliche Formen annehmen.
Nur Tollkühne bereiben feine blnterstäche mit
Wachs, während zaghafteren Naturen an-
geraten fei, die Gleitstäche mit Widerhaken zu
versehen. Für Stürze empfiehlt cö sich, die
Hosenbeine mit der Aufschrift „rechts" und
„links" zu bezeichnen. Im übrigen fei auf dag
beherzigenswerte Sprichwort verwiesen:
„Ein Rodel auf der Ebene ist besser als
zwei Skier auf dem Steilhang."
Der Bobsleigh: Kurz „Bob" genannt, ent-
stand aus einer Kreuzung von Rodel und
Automobil und vereinigt hinsichtlich Geschwin-
digkeit und Unlenksamkeit die Gefahren der
beiden. (Lebensversicherung siehe unter „L"!)
Der Bobfahrer kann als „Flieger des Winters"
bezeichnet werden, denn er erfreut sich bei
Frauen der gleichen Bevorzugung wie jener
gegenüber den Fußgängern.
Der Sweater: Bayerisch „Zweiter", deutsch
„Transpiriercr" oder „Schwitzer" genannt,
führt seinen Namen zu Recht, denn er erzeugt
in geschlossenen Räumen eine erhebliche
Wärmeentwicklung. Sein Gebrauch dürfte
schon in die ältesten Zeiten zurückreichen, wie
ein alter Volksspruch (mitgeteilt von Herrn
Ringelnatz) beweist:
„Bei Wind und Wetter sei Gott dein
Sweater!"
Neuerdings wird der Sweater fast völlig
vom Pullover verdrängt, der aus dünnem
Material, bisweilen aus Seide gefertigt, ins-
besondere die weibliche Brustpartie bis in ihre
kleinsten Details plastischer als jener ver-
anschaulicht.
Das Skihaserl: Dieses elegante, durch die
Pracht seiner buntfarbigen Wolle auffallende
Geschöpf findet man häufig in den Hal'ö
mondäner Sporthotels. Nur selten und unter
Voraussetzung besonders günstigerWitterungS-
verhältnisse verirrt sich ein vereinzeltes Exem-
plar bis zum Fuß eines Uebungshanges.
Obschon dem Skihaserl von männlichen Art-
genossen leidenschaftlich nachgestellt wird, ver-
mehrt es sich von Jahr zu Jahr und wird
wohl bald alle Wintersportplätze beherrschen.
Den Gegensatz zu seiner hübschen Erscheinung
bildet der „Gräuöliche Schlien", zu deutsch
„Grauenvoller Schlitten". W.
41