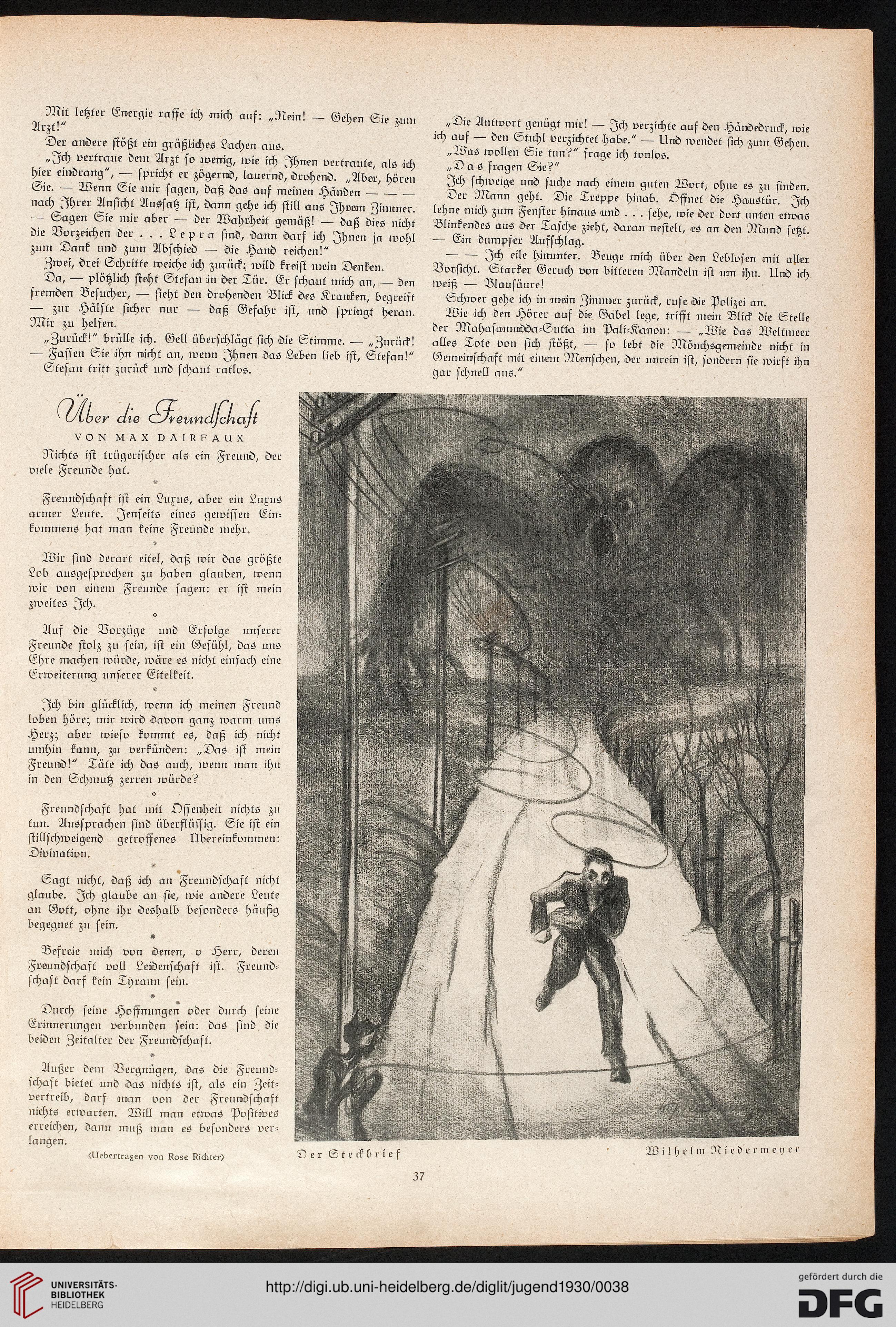Mit letzter Energie raffe ich rradf) auf: „Nein! — Gehen Sie rum
Arzt!" *
Der andere stößt ein gräßliches Lachen aus.
„Ich vertraue Hem Arzt so wenig, wie ich Ihnen vertraute, als ich
kffer eindrang", — spricht er zögernd, lauernd, drohend. „Aber, hören
Sie. — Wenn Sie mir sagen, daß das auf meinen Händen-
nach Ihrer Ansicht Aussatz ist, dann gehe ich still aus Ihrem Zimmer.
— Sagen Sie mir aber — der Wahrheit gemäß! — daß dies nicht
die Vorzeichen der . . . Lepra sind, dann darf ich Ihnen ja wohl
zum Dank und zum Abschied — die Hand reichen!"
Zwei, drei Schritte weiche ich zurück; wild kreist mein Denken.
Da, — plötzlich steht Stefan in der Tür. Er schaut mich an, — den
fremden Besucher, — sieht den drohenden Blick des Kranken, begreift
— zur Hälfte sicher nur — daß Gefahr ist, und springt heran.
Mir zu helfen.
„Zurück!" brülle ich. Gell überschlägt sich die Stimme. — „Zurück!
— Fassen Sie ihn nicht an, wenn Ihnen das Leben lieb ist, Stefan!"
Stefan tritt zurück und schaut ratlos.
„Die Antwort genügt mir! — Ich verzichte auf den Händedruck, wie
ich auf — den Stuhl verzichtet habe." — Und wendet sich zum Gehen.
„Was wollen Sie tun?" frage ich tonlos.
„Das fragen Sie?"
Ich schweige und suche nach einem guten Wort, ohne es zu finden.
Der Mann geht. Die Treppe hinab. Öffnet die Haustür. Ich
lehne mich zum Fenster hinaus und . . . sehe, wie der dort unten etwas
Blinkendes aus der Tasche zieht, daran nestelt, es an den Mund fetzt.
— Ein dumpfer Aufschlag.
-Ich eile hinunter. Beuge mich über den Leblosen mit aller
Vorsicht. Starker Geruch von bitteren Mandeln ist um ihn. Und ich
weiß ^— Blausäure!
Schwer gehe ich in mein Zimmer zurück, rufe die Polizei an.
Wie ich den Hörer auf die Gabel lege, trifft luei'n Blick die Stelle
der Mahasamudda-Sutta im Pali-Kanon: — „Wie das Weltmeer
alles Tote von sich stößt, — so lebt die Mönchsgemeinde nicht in
Gemeinfckast mit einem Menschen, der unrein ist, sondern sie wirst ihn
gar schnell auS."
VON MAX DAIRFAUX
Nichts ist trügerischer als ein Freund, der
viele Freunde hat.
Ä-
Freundschaft ist ein LuruS, aber ein LuruS
armer Leute. Jenseits eines gewissen Ein-
kommens hat man keine Freunde mehr.
-s
Wir sind derart eitel, daß wir das größte
Lob ausgesprochen zu haben glauben, wenn
wir von einem Freunde sagen: er ist mein
zweites Ich.
s
Auf die Vorzüge und Erfolge unserer
Freunde stolz zu sein, ist ein Gefühl, daS uns
Ehre machen würde, wäre es nicht einfach eine
Erweiterung unserer Eitelkeit.
Ich bin glücklich, wenn ich meinen Freund
loben höre; inir wird davon ganz warm umS
Herz; aber wieso kommt es, daß ich nicht
umhin kann, zu verkünden: „Das ist mein
Freund!" Täte ich daS auch, wenn man ihn
in den Schmutz zerren würde?
Freundschaft hat mit Offenheit nichts zu
tun. Aussprachen sind überflüssig. Sie ijt ein
stillschweigend getroffenes Übereinkommen:
Divination.
Sagt nicht, daß ich an Freundschaft nicht
glaube. Ich glaube an sie, wie andere Leute
an Gott, ohne ihr deshalb besonders häufig
begegnet zu sein.
*
Befreie mich von denen, o Herr, deren
Freundschaft voll Leidenschaft ijt. Freund-
schaft darf kein Tyrann sein.
*
Durch seine Hoffnungen oder durch seine
Erinnerungen verbunden sein: daS jind die
beiden Zeitalter der Freundschaft.
S
Außer dem Vergnügen, daS die Freund-
schaft bietet und das nichts ist, als ein Zeit-
vertreib, darf man von der Freundschaft
nichts erwarten. Will man etwas Positives
erreichen, dann imiß man eS besonders ver-
langen.
<Uebertragen von Rose Richter)
MM«
Sv A '
1 M!LW
37
Arzt!" *
Der andere stößt ein gräßliches Lachen aus.
„Ich vertraue Hem Arzt so wenig, wie ich Ihnen vertraute, als ich
kffer eindrang", — spricht er zögernd, lauernd, drohend. „Aber, hören
Sie. — Wenn Sie mir sagen, daß das auf meinen Händen-
nach Ihrer Ansicht Aussatz ist, dann gehe ich still aus Ihrem Zimmer.
— Sagen Sie mir aber — der Wahrheit gemäß! — daß dies nicht
die Vorzeichen der . . . Lepra sind, dann darf ich Ihnen ja wohl
zum Dank und zum Abschied — die Hand reichen!"
Zwei, drei Schritte weiche ich zurück; wild kreist mein Denken.
Da, — plötzlich steht Stefan in der Tür. Er schaut mich an, — den
fremden Besucher, — sieht den drohenden Blick des Kranken, begreift
— zur Hälfte sicher nur — daß Gefahr ist, und springt heran.
Mir zu helfen.
„Zurück!" brülle ich. Gell überschlägt sich die Stimme. — „Zurück!
— Fassen Sie ihn nicht an, wenn Ihnen das Leben lieb ist, Stefan!"
Stefan tritt zurück und schaut ratlos.
„Die Antwort genügt mir! — Ich verzichte auf den Händedruck, wie
ich auf — den Stuhl verzichtet habe." — Und wendet sich zum Gehen.
„Was wollen Sie tun?" frage ich tonlos.
„Das fragen Sie?"
Ich schweige und suche nach einem guten Wort, ohne es zu finden.
Der Mann geht. Die Treppe hinab. Öffnet die Haustür. Ich
lehne mich zum Fenster hinaus und . . . sehe, wie der dort unten etwas
Blinkendes aus der Tasche zieht, daran nestelt, es an den Mund fetzt.
— Ein dumpfer Aufschlag.
-Ich eile hinunter. Beuge mich über den Leblosen mit aller
Vorsicht. Starker Geruch von bitteren Mandeln ist um ihn. Und ich
weiß ^— Blausäure!
Schwer gehe ich in mein Zimmer zurück, rufe die Polizei an.
Wie ich den Hörer auf die Gabel lege, trifft luei'n Blick die Stelle
der Mahasamudda-Sutta im Pali-Kanon: — „Wie das Weltmeer
alles Tote von sich stößt, — so lebt die Mönchsgemeinde nicht in
Gemeinfckast mit einem Menschen, der unrein ist, sondern sie wirst ihn
gar schnell auS."
VON MAX DAIRFAUX
Nichts ist trügerischer als ein Freund, der
viele Freunde hat.
Ä-
Freundschaft ist ein LuruS, aber ein LuruS
armer Leute. Jenseits eines gewissen Ein-
kommens hat man keine Freunde mehr.
-s
Wir sind derart eitel, daß wir das größte
Lob ausgesprochen zu haben glauben, wenn
wir von einem Freunde sagen: er ist mein
zweites Ich.
s
Auf die Vorzüge und Erfolge unserer
Freunde stolz zu sein, ist ein Gefühl, daS uns
Ehre machen würde, wäre es nicht einfach eine
Erweiterung unserer Eitelkeit.
Ich bin glücklich, wenn ich meinen Freund
loben höre; inir wird davon ganz warm umS
Herz; aber wieso kommt es, daß ich nicht
umhin kann, zu verkünden: „Das ist mein
Freund!" Täte ich daS auch, wenn man ihn
in den Schmutz zerren würde?
Freundschaft hat mit Offenheit nichts zu
tun. Aussprachen sind überflüssig. Sie ijt ein
stillschweigend getroffenes Übereinkommen:
Divination.
Sagt nicht, daß ich an Freundschaft nicht
glaube. Ich glaube an sie, wie andere Leute
an Gott, ohne ihr deshalb besonders häufig
begegnet zu sein.
*
Befreie mich von denen, o Herr, deren
Freundschaft voll Leidenschaft ijt. Freund-
schaft darf kein Tyrann sein.
*
Durch seine Hoffnungen oder durch seine
Erinnerungen verbunden sein: daS jind die
beiden Zeitalter der Freundschaft.
S
Außer dem Vergnügen, daS die Freund-
schaft bietet und das nichts ist, als ein Zeit-
vertreib, darf man von der Freundschaft
nichts erwarten. Will man etwas Positives
erreichen, dann imiß man eS besonders ver-
langen.
<Uebertragen von Rose Richter)
MM«
Sv A '
1 M!LW
37