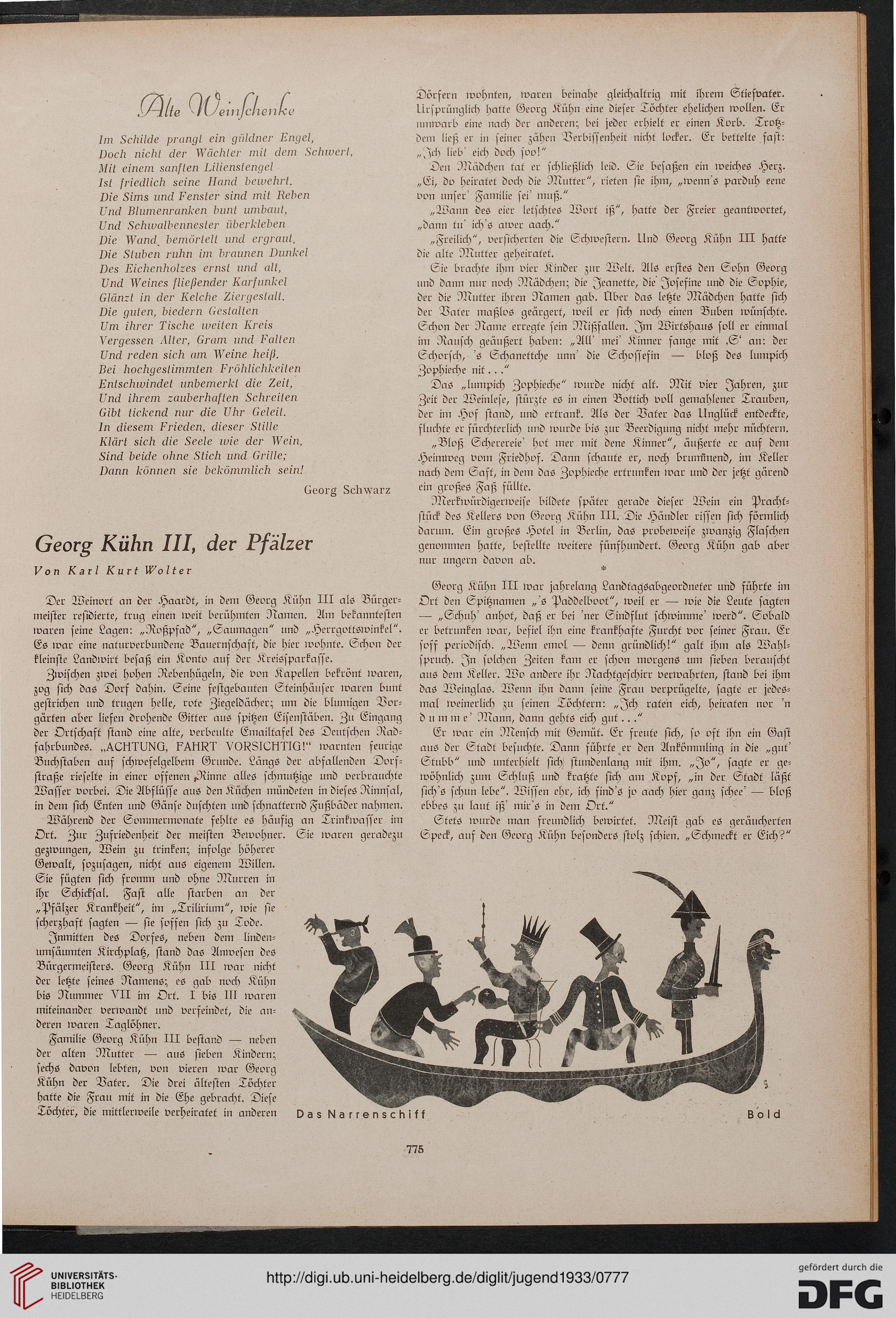Im Schilde prangt ein güldner Engel,
Doch nicht der Wächter mit dem Schwert,
Mit einem sanften Lilienstengel
Ist friedlich seine Hand bewehrt.
Die Sims und Fenster sind mit Reben
Und Blumenranken bunt umbaut,
Und Schwalbennester überkleben
Die Wand. bemörtelt und ergraut.
Die Stuben ruhn im braunen Dunkel
Des Eichenholzes ernst und alt,
Und Weines fließender Karfunkel
Glänzt in der Kelche Ziergestalt.
Die guten, biedern Gestalten
Um ihrer Tische weiten Kreis
Vergessen Alter, Gram und Falten
Und reden sich am Weine heiß.
Bei hochgestimmten Fröhlichkeiten
Entschwindet unbemerkt die Zeit,
Und ihrem zauberhaften Schreiten
Gibt tickend nur die Uhr Geleit.
In diesem Frieden, dieser Stille
Klärt sich die Seele wie der Wein,
Sind beide ohne Stich und Grille;
Dann können sie bekömmlich sein!
Georg Schwarz
Georg Kühn III, der Pfälzer
Von Karl Kurt Wolter
Der Weinort an bet Haardt, in dem Georg Kühn III als Bürger-
meister residierte, trug einen weit berühmten Namen. Am bekanntesten
waren seine Lagen: „Roßpfad", „Saumagen" und „Herrgottswinkel".
Es war eine naturverbundene Bauernschaft, die hier wohnte. Schon der
kleinste Landwirt besaß ein Konto aus der Kreissparkasse.
Zwischen zwei hohen Rebenhügeln, die von Kapellen bekrönt waren,
zog sich daö Dorf dahin. Seine festgebauten Steinhäuser waren bunt
gestrichen und trugen helle, rote Ziegeldächer; um die blumigen Vor-
gärten aber liefen drohende Gitter aus spitzen Eisenstäben. Zu Eingang
der Ortschaft stand eine alte, verbeulte Emailtafel des Deutschen Rad-
fahrbundes. „ACHTUNG, FAHRT VORSICHTIG!“ warnten feurige
Buchstaben auf schwefelgelbem Grunde. Längs der abfallenden Dorf-
straße rieselte in einer offenen ^Irinne alles schmutzige und verbrauchte
Wasser vorbei. Die Abflüsse auS den Küchen mündeten in dieses Rinnsal,
in dem sich Enten und Gänse duschten und schnatternd Fußbäder nahmen.
Während der Sommermonate fehlte es häufig an Trinkwasser im
Ort. Zur Zufriedenheit der meisten Bewohner. Sie waren geradezu
gezwungen, Wein zu trinken; infolge höherer
Gewalt, sozusagen, nicht aus eigenem Willen.
Sie fügten sich fromm und ohne Murren in
ihr Schicksal. Fast alle starben an der
„Pfälzer Krankheit", im „Trilirium", wie sie
scherzhaft sagten — sie soffen sich zu Tode.
Inmitten des Dorfes, neben dem linden-
umfäumten Kirchplatz, stand das Anwesen des
Bürgermeisters. Georg Kühn III war nicht
der letzte seines Namens; es gab noch Kühn
bis Nummer VII jm Ort. I bis III waren
miteinander verwandt und verfeindet, die an-
deren waren Taglöhner.
Familie Georg Kühn III bestand — neben
der alten Mutter — auS sieben
sechs davon lebten, von vieren war Georg
Kühn der Vater. Die drei ältesten Töchter
hatte die Frau mit in die Ehe gebracht. Diese
Töchter, die mittlerweile verheiratet in anderen
Dörfern wohnten, waren beinahe gleichaltrig mit ihrem Stiefvater.
Ursprünglich hatte Georg Kühn eine dieser Töchter ehelichen wollen. Er
umwarb eine nach der anderen; bei jeder erhielt er einen Korb. Trotz-
dem ließ er in seiner zähen Verbissenheit nicht locker. Er bettelte fast:
„Ich lieb' eich doch soo!"
Den Mädchen tat er schließlich leid. Sie besaßen ein weiches Herz.
„Ei, do heiratet doch die Mutter", rieten sie ihm, „wenn S parduh eene
von unser' Familie sei' muß."
„Wann des eier letschteS Wort iß", hatte der Freier geantwortet,
„dann tu' ich's awer aach."
„Freilich", versicherten die Schwestern. lind Georg Kühn III hatte
die alte Mutter geheiratet.
Sie brachte ihm vier Kinder zur Welt. Als erstes den Sohn Georg
und dann nur noch Mädchen; die Jeanette, die Josefine und die Sophie,
der die Mutter ihren Namen gab. Über das letzte Mädchen hatte sich
der Vater maßlos geärgert, weil er sich noch einen Buben wünschte.
Schon der Name erregte sein Mißfallen. Jm Wirtshaus soll er einmal
im Rausch geäußert haben: „All' mei Kinner fange mit ,(5‘ an: der
Schorsch, 's Schanettche unn' die Schossefin — bloß des lumpich
Zophieche nit.. ."
Daö „lumpich Zophieche" wurde nicht alt. Mit vier Jahren, zur
Zeit der Weinlese, stürzte es in einen Bottich voll gemahlener Trauben,
der im Hof stand, und ertrank. Als der Vater das Unglück entdeckte,
fluchte er fürchterlich und wurde bis zur Beerdigung nicht mehr nüchtern.
„Bloß Scherereie' hot mer mit dene Kinner", äußerte er auf dem
Heimweg vom Friedhof. Dann schaute er, noch brummend, im Keller
nach dem Saft, in dem das Zophieche ertrunken war und der jetzt gärend
ein großes Faß füllte.
Merkwürdigerweise bildete später gerade dieser Wein ein Pracht-
stück deS Kellers von Georg Kühn III. Die Händler rissen sich förmlich
darum. Ein großes Hotel in Berlin, das probeweise zwanzig Flaschen
genommen hatte, bestellte weitere fünfhundert. Georg Kühn gab aber
nur ungern davon ab.
Georg Kühn III war jahrelang Landtagsabgeordneter und führte im
Ort den Spitznamen „'s Paddelboot", weil er — wie die Leute sagten
— „Schuh anhot, daß er bei ner Sindflut schwimme' werd". Sobald
er betrunken war, befiel ihn eine krankhafte Furcht vor seiner Frau. Er
soff periodisch. „Wenn emol. — denn gründlich!" galt ihm als Wahl-
spruch. In solchen Zeiten kam er schon morgens um sieben berauscht
aus dem Keller. Wo andere ihr Nachtgeschirr verwahrten, stand bei ihm
daö Weinglas. Wenn ihn dann seine Frau verprügelte, sagte er jedes-
mal weinerlich zu seinen Töchtern: „Ich raten eich, heiraten nor 'n
d u m m e' Mann, dann gehtö eich gut..."
Er war ein Mensch mit Gemüt. Er freute sich, so oft ihn ein Gast
auS der Stadt besuchte. Dann führte er den Ankömmling in die „gut'
Stubb" und unterhielt sich stundenlang mit ihm. „Jo", sagte er ge-
wöhnlich zum Schluß und kratzte sich am Kopf, „in der Stadt läßt
sich S schun lebe". Wissen ehr, ich find's jo aach hier ganz schee' — bloß
ebbeS zu laut iß' mir's in dem Ort."
Stets wurde man freundlich bewirtet. Meist gab eö geräucherten
775
Doch nicht der Wächter mit dem Schwert,
Mit einem sanften Lilienstengel
Ist friedlich seine Hand bewehrt.
Die Sims und Fenster sind mit Reben
Und Blumenranken bunt umbaut,
Und Schwalbennester überkleben
Die Wand. bemörtelt und ergraut.
Die Stuben ruhn im braunen Dunkel
Des Eichenholzes ernst und alt,
Und Weines fließender Karfunkel
Glänzt in der Kelche Ziergestalt.
Die guten, biedern Gestalten
Um ihrer Tische weiten Kreis
Vergessen Alter, Gram und Falten
Und reden sich am Weine heiß.
Bei hochgestimmten Fröhlichkeiten
Entschwindet unbemerkt die Zeit,
Und ihrem zauberhaften Schreiten
Gibt tickend nur die Uhr Geleit.
In diesem Frieden, dieser Stille
Klärt sich die Seele wie der Wein,
Sind beide ohne Stich und Grille;
Dann können sie bekömmlich sein!
Georg Schwarz
Georg Kühn III, der Pfälzer
Von Karl Kurt Wolter
Der Weinort an bet Haardt, in dem Georg Kühn III als Bürger-
meister residierte, trug einen weit berühmten Namen. Am bekanntesten
waren seine Lagen: „Roßpfad", „Saumagen" und „Herrgottswinkel".
Es war eine naturverbundene Bauernschaft, die hier wohnte. Schon der
kleinste Landwirt besaß ein Konto aus der Kreissparkasse.
Zwischen zwei hohen Rebenhügeln, die von Kapellen bekrönt waren,
zog sich daö Dorf dahin. Seine festgebauten Steinhäuser waren bunt
gestrichen und trugen helle, rote Ziegeldächer; um die blumigen Vor-
gärten aber liefen drohende Gitter aus spitzen Eisenstäben. Zu Eingang
der Ortschaft stand eine alte, verbeulte Emailtafel des Deutschen Rad-
fahrbundes. „ACHTUNG, FAHRT VORSICHTIG!“ warnten feurige
Buchstaben auf schwefelgelbem Grunde. Längs der abfallenden Dorf-
straße rieselte in einer offenen ^Irinne alles schmutzige und verbrauchte
Wasser vorbei. Die Abflüsse auS den Küchen mündeten in dieses Rinnsal,
in dem sich Enten und Gänse duschten und schnatternd Fußbäder nahmen.
Während der Sommermonate fehlte es häufig an Trinkwasser im
Ort. Zur Zufriedenheit der meisten Bewohner. Sie waren geradezu
gezwungen, Wein zu trinken; infolge höherer
Gewalt, sozusagen, nicht aus eigenem Willen.
Sie fügten sich fromm und ohne Murren in
ihr Schicksal. Fast alle starben an der
„Pfälzer Krankheit", im „Trilirium", wie sie
scherzhaft sagten — sie soffen sich zu Tode.
Inmitten des Dorfes, neben dem linden-
umfäumten Kirchplatz, stand das Anwesen des
Bürgermeisters. Georg Kühn III war nicht
der letzte seines Namens; es gab noch Kühn
bis Nummer VII jm Ort. I bis III waren
miteinander verwandt und verfeindet, die an-
deren waren Taglöhner.
Familie Georg Kühn III bestand — neben
der alten Mutter — auS sieben
sechs davon lebten, von vieren war Georg
Kühn der Vater. Die drei ältesten Töchter
hatte die Frau mit in die Ehe gebracht. Diese
Töchter, die mittlerweile verheiratet in anderen
Dörfern wohnten, waren beinahe gleichaltrig mit ihrem Stiefvater.
Ursprünglich hatte Georg Kühn eine dieser Töchter ehelichen wollen. Er
umwarb eine nach der anderen; bei jeder erhielt er einen Korb. Trotz-
dem ließ er in seiner zähen Verbissenheit nicht locker. Er bettelte fast:
„Ich lieb' eich doch soo!"
Den Mädchen tat er schließlich leid. Sie besaßen ein weiches Herz.
„Ei, do heiratet doch die Mutter", rieten sie ihm, „wenn S parduh eene
von unser' Familie sei' muß."
„Wann des eier letschteS Wort iß", hatte der Freier geantwortet,
„dann tu' ich's awer aach."
„Freilich", versicherten die Schwestern. lind Georg Kühn III hatte
die alte Mutter geheiratet.
Sie brachte ihm vier Kinder zur Welt. Als erstes den Sohn Georg
und dann nur noch Mädchen; die Jeanette, die Josefine und die Sophie,
der die Mutter ihren Namen gab. Über das letzte Mädchen hatte sich
der Vater maßlos geärgert, weil er sich noch einen Buben wünschte.
Schon der Name erregte sein Mißfallen. Jm Wirtshaus soll er einmal
im Rausch geäußert haben: „All' mei Kinner fange mit ,(5‘ an: der
Schorsch, 's Schanettche unn' die Schossefin — bloß des lumpich
Zophieche nit.. ."
Daö „lumpich Zophieche" wurde nicht alt. Mit vier Jahren, zur
Zeit der Weinlese, stürzte es in einen Bottich voll gemahlener Trauben,
der im Hof stand, und ertrank. Als der Vater das Unglück entdeckte,
fluchte er fürchterlich und wurde bis zur Beerdigung nicht mehr nüchtern.
„Bloß Scherereie' hot mer mit dene Kinner", äußerte er auf dem
Heimweg vom Friedhof. Dann schaute er, noch brummend, im Keller
nach dem Saft, in dem das Zophieche ertrunken war und der jetzt gärend
ein großes Faß füllte.
Merkwürdigerweise bildete später gerade dieser Wein ein Pracht-
stück deS Kellers von Georg Kühn III. Die Händler rissen sich förmlich
darum. Ein großes Hotel in Berlin, das probeweise zwanzig Flaschen
genommen hatte, bestellte weitere fünfhundert. Georg Kühn gab aber
nur ungern davon ab.
Georg Kühn III war jahrelang Landtagsabgeordneter und führte im
Ort den Spitznamen „'s Paddelboot", weil er — wie die Leute sagten
— „Schuh anhot, daß er bei ner Sindflut schwimme' werd". Sobald
er betrunken war, befiel ihn eine krankhafte Furcht vor seiner Frau. Er
soff periodisch. „Wenn emol. — denn gründlich!" galt ihm als Wahl-
spruch. In solchen Zeiten kam er schon morgens um sieben berauscht
aus dem Keller. Wo andere ihr Nachtgeschirr verwahrten, stand bei ihm
daö Weinglas. Wenn ihn dann seine Frau verprügelte, sagte er jedes-
mal weinerlich zu seinen Töchtern: „Ich raten eich, heiraten nor 'n
d u m m e' Mann, dann gehtö eich gut..."
Er war ein Mensch mit Gemüt. Er freute sich, so oft ihn ein Gast
auS der Stadt besuchte. Dann führte er den Ankömmling in die „gut'
Stubb" und unterhielt sich stundenlang mit ihm. „Jo", sagte er ge-
wöhnlich zum Schluß und kratzte sich am Kopf, „in der Stadt läßt
sich S schun lebe". Wissen ehr, ich find's jo aach hier ganz schee' — bloß
ebbeS zu laut iß' mir's in dem Ort."
Stets wurde man freundlich bewirtet. Meist gab eö geräucherten
775