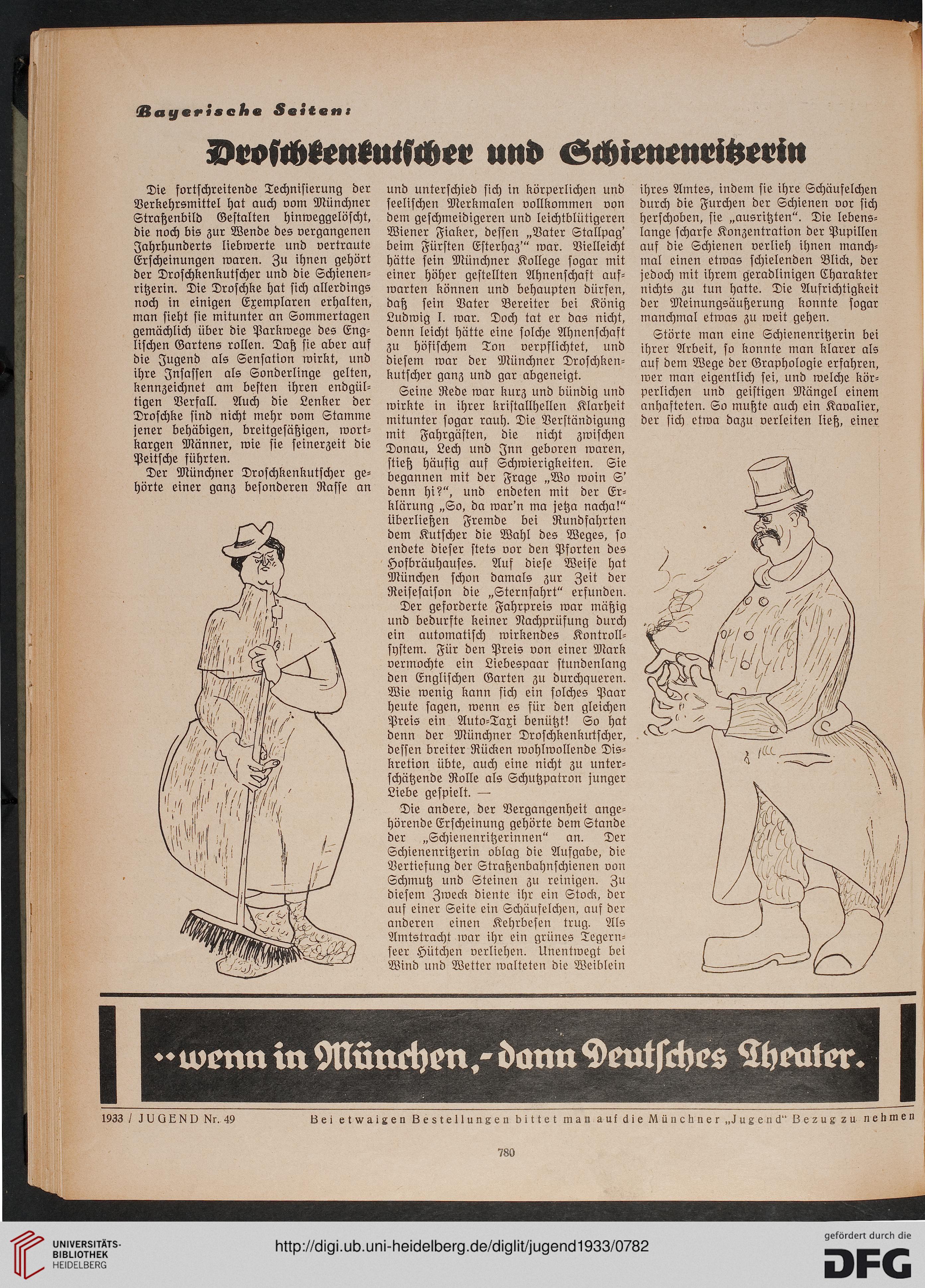{Bayerisch« Seiten*
Droschtenkuischev und Gchjenenritzerin
Die fortschreitende Technisierung der
Verkehrsmittel hat auch vom Münchner
Straßenbild Gestalten hinweggelöscht,
die noch bis zur Wende des vergangenen
Jahrhunderts liebwerte und vertraute
Erscheinungen waren. Zu ihnen gehört
der Droschkenkutscher und die Schienen-
ritzerin. Die Droschke hat sich allerdings
noch in einigen Exemplaren erhalten,
man sieht sie mitunter an Sommertagen
gemächlich über die Parkwege des Eng-
lischen Gartens rollen. Daß sie aber auf
die Jugend als Sensation wirkt, und
ihre Insassen als Sonderlinge gelten,
kennzeichnet am besten ihren endgül-
tigen Verfall. Auch die Lenker der
Droschke sind nicht mehr vom Stamme
jener behäbigen, breitgesäßigen, wort-
kargen Männer, wie sie seinerzeit die
Peitsche führten.
Der Münchner Droschkenkutscher ge-
hörte einer ganz besonderen Rasse an
und unterschied sich in körperlichen und
seelischen Merkmalen vollkommen von
dem geschmeidigeren und leichtblütigeren
Wiener Fiaker, dessen „Vater Stallpag'
beim Fürsten Esterhaz'" war. Vielleicht
hätte sein Münchner Kollege sogar mit
einer höher gestellten Ahnenschaft auf-
warten können und behaupten dürfen,
daß sein Vater Bereiter bei König
Ludwig I. war. Doch tat er das nicht,
denn leicht hätte eine solche Ahnenschaft
zu höfischem Ton verpflichtet, und
diesem war der Münchner Droschken-
kutscher ganz und gar abgeneigt.
Seine Rede war kurz und bündig und
wirkte in ihrer kristallhellen Klarheit
mitunter sogar rauh. Die Verständigung
mit Fahrgästen, die nicht zwischen
Donau, Lech und Inn geboren waren,
stieß häufig auf Schwierigkeiten. Sie
begannen mit der Frage „Wo woin S'
denn hi?", und endeten mit der Er-
klärung „So, da war'n ma jetza nacha!"
überließen Fremde bei Rundfahrten
dem Kutscher die Wahl des Weges, so
endete dieser stets vor den Pforten des
Hofbräuhauses. Auf diese Weise hat
München schon damals zur Zeit der
Reisesaison die „Sternfahrt" erfunden.
Der geforderte Fahrpreis war mäßig
und bedurfte keiner Nachprüfung durch
ein automatisch wirkendes Kontroll-
system. Für den Preis von einer Mark
vermochte ein Liebespaar stundenlang
den Englischen Garten zu durchqueren.
Wie wenig kann sich ein solches Paar
heute sagen, wenn es für den gleichen
Preis ein Auto-Taxi benützt! So hat
denn der Münchner Droschkenkutscher,
dessen breiter Rücken wohlwollende Dis-
kretion übte, auch eine nicht zu unter-
schätzende Rolle als Schutzpatron junger
Liebe gespielt. —
Die andere, der Vergangenheit ange-
hörende Erscheinung gehörte dem Stande
der „Schienenritzerinnen" an. Der
Schienenritzerin oblag die Aufgabe, die
Vertiefung der Straßenbahnschienen von
Schmutz und Steinen zu reinigen. Zu
diesem Zweck diente ihr ein Stock, der
auf einer Seite ein Schäufelchen, auf der
anderen einen Kehrbesen trug. Als
Amtstracht war ihr ein grünes Tegern-
seer Hütchen verliehen. Unentwegt bei
Wind und Wetter walteten die Weiblein
ihres Amtes, indem sie ihre Schäufelchen
durch die Furchen der Schienen vor sich
herschoben, sie „ausritzten". Die lebens-
lange scharfe Konzentration der Pupillen
auf die Schienen verlieh ihnen manch-
mal einen etwas schielenden Blick, der
jedoch mit ihrem geradlinigen Charakter
nichts zu tun hatte. Die Aufrichtigkeit
der Meinungsäußerung konnte sogar
manchmal etwas zu weit gehen.
Störte man eine Schienenritzerin bei
ihrer Arbeit, so konnte man klarer als
auf dem Wege der Graphologie erfahren,
wer man eigentlich sei, und welche kör-
perlichen und geistigen Mängel einem
anhafteten. So mußte auch ein Kavalier,
der sich etwa dazu verleiten ließ, einer
»«wenn in München.-dann Deutsches Theater
1933 / J U G E N D Nr. 49 Bei etwaigen Bestellungen bittet man auf die Münchner „Jugend“ Bezug zu nehmen
780
Droschtenkuischev und Gchjenenritzerin
Die fortschreitende Technisierung der
Verkehrsmittel hat auch vom Münchner
Straßenbild Gestalten hinweggelöscht,
die noch bis zur Wende des vergangenen
Jahrhunderts liebwerte und vertraute
Erscheinungen waren. Zu ihnen gehört
der Droschkenkutscher und die Schienen-
ritzerin. Die Droschke hat sich allerdings
noch in einigen Exemplaren erhalten,
man sieht sie mitunter an Sommertagen
gemächlich über die Parkwege des Eng-
lischen Gartens rollen. Daß sie aber auf
die Jugend als Sensation wirkt, und
ihre Insassen als Sonderlinge gelten,
kennzeichnet am besten ihren endgül-
tigen Verfall. Auch die Lenker der
Droschke sind nicht mehr vom Stamme
jener behäbigen, breitgesäßigen, wort-
kargen Männer, wie sie seinerzeit die
Peitsche führten.
Der Münchner Droschkenkutscher ge-
hörte einer ganz besonderen Rasse an
und unterschied sich in körperlichen und
seelischen Merkmalen vollkommen von
dem geschmeidigeren und leichtblütigeren
Wiener Fiaker, dessen „Vater Stallpag'
beim Fürsten Esterhaz'" war. Vielleicht
hätte sein Münchner Kollege sogar mit
einer höher gestellten Ahnenschaft auf-
warten können und behaupten dürfen,
daß sein Vater Bereiter bei König
Ludwig I. war. Doch tat er das nicht,
denn leicht hätte eine solche Ahnenschaft
zu höfischem Ton verpflichtet, und
diesem war der Münchner Droschken-
kutscher ganz und gar abgeneigt.
Seine Rede war kurz und bündig und
wirkte in ihrer kristallhellen Klarheit
mitunter sogar rauh. Die Verständigung
mit Fahrgästen, die nicht zwischen
Donau, Lech und Inn geboren waren,
stieß häufig auf Schwierigkeiten. Sie
begannen mit der Frage „Wo woin S'
denn hi?", und endeten mit der Er-
klärung „So, da war'n ma jetza nacha!"
überließen Fremde bei Rundfahrten
dem Kutscher die Wahl des Weges, so
endete dieser stets vor den Pforten des
Hofbräuhauses. Auf diese Weise hat
München schon damals zur Zeit der
Reisesaison die „Sternfahrt" erfunden.
Der geforderte Fahrpreis war mäßig
und bedurfte keiner Nachprüfung durch
ein automatisch wirkendes Kontroll-
system. Für den Preis von einer Mark
vermochte ein Liebespaar stundenlang
den Englischen Garten zu durchqueren.
Wie wenig kann sich ein solches Paar
heute sagen, wenn es für den gleichen
Preis ein Auto-Taxi benützt! So hat
denn der Münchner Droschkenkutscher,
dessen breiter Rücken wohlwollende Dis-
kretion übte, auch eine nicht zu unter-
schätzende Rolle als Schutzpatron junger
Liebe gespielt. —
Die andere, der Vergangenheit ange-
hörende Erscheinung gehörte dem Stande
der „Schienenritzerinnen" an. Der
Schienenritzerin oblag die Aufgabe, die
Vertiefung der Straßenbahnschienen von
Schmutz und Steinen zu reinigen. Zu
diesem Zweck diente ihr ein Stock, der
auf einer Seite ein Schäufelchen, auf der
anderen einen Kehrbesen trug. Als
Amtstracht war ihr ein grünes Tegern-
seer Hütchen verliehen. Unentwegt bei
Wind und Wetter walteten die Weiblein
ihres Amtes, indem sie ihre Schäufelchen
durch die Furchen der Schienen vor sich
herschoben, sie „ausritzten". Die lebens-
lange scharfe Konzentration der Pupillen
auf die Schienen verlieh ihnen manch-
mal einen etwas schielenden Blick, der
jedoch mit ihrem geradlinigen Charakter
nichts zu tun hatte. Die Aufrichtigkeit
der Meinungsäußerung konnte sogar
manchmal etwas zu weit gehen.
Störte man eine Schienenritzerin bei
ihrer Arbeit, so konnte man klarer als
auf dem Wege der Graphologie erfahren,
wer man eigentlich sei, und welche kör-
perlichen und geistigen Mängel einem
anhafteten. So mußte auch ein Kavalier,
der sich etwa dazu verleiten ließ, einer
»«wenn in München.-dann Deutsches Theater
1933 / J U G E N D Nr. 49 Bei etwaigen Bestellungen bittet man auf die Münchner „Jugend“ Bezug zu nehmen
780