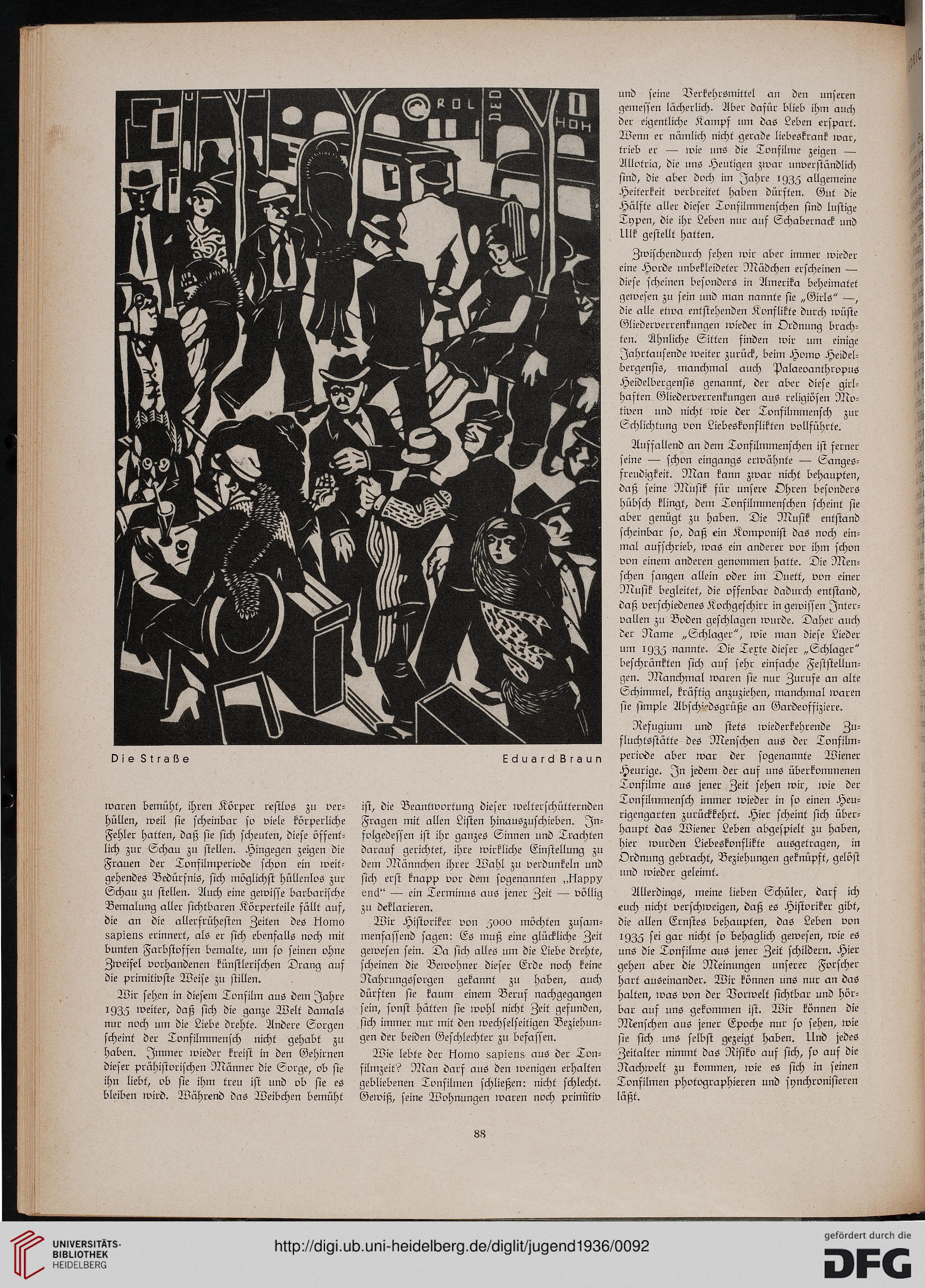und seine Verkehrsmittel an den unseren
gemessen lächerlich. Aber dafür blieb ihm auch
der eigentliche Kampf um daS Leben erspart.
Wenn er nämlich nicht gerade liebeskrank war,
trieb er — wie uns die Tonfilme zeigen —
Allotria, die uns Heutigen zwar unverständlich
sind, die aber doch im Jahre 1935 allgemeine
Heiterkeit verbreitet haben dürften. Gut die
Hälfte aller dieser Tonfilmmenschen sind lustige
Typen, die ihr Leben nur auf Schabernack und
bllk gestellt hatten.
Zwischendurch sehen wir aber immer wieder
eine Horde unbekleideter Mädchen erscheinen —
diese scheinen besonders in Amerika beheimatet
gewesen zu sein und man nannte sie „Girls" —,
die alle etwa entstehenden Konflikte durch wüste
Gliederverrenkungen wieder in Ordnung brach-
ten. Ähnliche Sitten finden wir um einige
Jahrtausende weiter zurück, beim Homo Heidel-
bergensis, manchmal auch Palaeoanthropus
Heidelbergensis genannt, der aber diese girl-
haften Gliederverrenkungen auS religiösen Mo-
tiven und nicht wie der Tonfilmmensch zur
Schlichtung von Liebeskonslikten vollsührte.
Auffallend an dem Tonfilminenschen ist ferner
seine — schon eingangs erwähnte — SangeS-
freudigkeit. Man kann zwar nicht behaupten,
daß seine Musik für unsere Ohren besonders
hübsch klingt, dem Tonfilminenschen scheint sie
aber genügt zu haben. Die Musik entstand
scheinbar so, daß ein Komponist daS noch ein-
mal ausschrieb, waS ein anderer vor ihm schon
von einem anderen genominen hatte. Die Men-
schen sangen allein oder im Duett, von einer
Musik begleitet, die offenbar dadurch entstand,
daß verschiedenes Kochgeschirr in gewissen Inter-
vallen zu Boden geschlagen wurde. Daher auch
der Name „Schlager", lvie man diese Lieder
um 1933 nannte. Die Texte dieser „Schlager"
beschränkten sich aus sehr einfache Feststellun-
gen. Manchmal waren sie nur Zurufe an alte
Schimniel, kräftig anzuziehen, manchmal waren
sie simple Absch'"dSgrüße an Gardeoffiziere.
Refugium und stets iviederkehrende Zu-
fluchtsstätte deS Menschen auS der Tonfilm-
periode aber war der sogenannte Wiener-
Heurige. In jedem der aus iinö überkommenen
Tonfilme auS jener Zeit sehen wir, wie der
Tonsilmmensch immer wieder in so einen Heu-
rigengarten zurückkehrt. Hier scheint sich über-
haupt daS Wiener Leben abgespielt zu haben,
hier wurden Liebeskonflikte ausgetragen, in
Ordnung gebracht, Beziehungen geknüpft, gelöst
und wieder geleimt.
Allerdings, meine lieben Schüler, darf ich
euch nicht verschweigen, daß es Historiker gibt,
die allen Ernstes behaupten, das Leben von
1933 sei gar nicht so behaglich gewesen, wie eS
uns die Tonfilme auS jener Zeit schildern. Hier
gehen aber die Meinungen unserer Forscher-
hart auseinander. Wir können unö nur an das
halten, waS von der Vorwelt sichtbar und hör-
bar aus uns gekommen ist. Wir können die
Menschen aus jener Epoche nur so sehen, wie
sie sich unS selbst gezeigt haben, blnd jedes
Zeitalter nimmt das Risiko aus sich, so aus die
Nachwelt zu kommen, wie eS sich in seinen
Tonfilmen photographieren und synchronijieren
läßt.
waren bemüht, ihren Körper restlos zu ver-
hüllen, weil sie scheinbar so viele körperliche
Fehler hatten, daß sie sich scheuten, diese öffent-
lich zur Schau zu stellen. Hingegen zeigen die
Frauen der Tonfilmperiode schon ein weit-
gehendes Bedürfnis, sich möglichst hüllenlos zur
Schau zu stellen. Auch eine gewisse barbarische
Bemalung aller sichtbaren Körperteile fällt aus,
die an die allerfrühesten Zeiten des Homo
sapiens erinnert, als er sich ebenfalls noch mit
bunten Farbstoffen bemalte, um so seinen ohne
Zweifel vorhandenen künstlerischen Drang auf
die primitivste Weise zu stillen.
Wir sehen in diesem Tonfilm auS dem Jahre
i93o kveiter, daß sich die ganze Welt damals
nur noch um die Liebe drehte. Andere Sorgen
scheint der Tonfilmmensch nicht gehabt zu
haben. Immer wieder kreist in den Gehirnen
dieser prähistorischen Männer die Sorge, ob sie
ihn liebt, ob sie ihm treu ist und ob sie es
bleiben wird. Während das Weibchen bemüht
ist, die Beantwortung dieser welterschütternden
Fragen mit allen Listen hinauszuschieben. In-
folgedessen ist ihr ganzes Sinnen und Trachten
daraus gerichtet, ihre wirkliche Einstellung zu
dem Männchen ihrer Wahl zu verdunkeln und
sich erst knapp vor dem sogenannten ,,Happy
end“ — ein Terminus aus jener Zeit — völlig
zu deklarieren.
Wir Historiker von 3000 möchten zusam-
mensassend sagen: Es muß eine glückliche Zeit
gewesen sein. Da sich alles um die Liebe drehte,
scheinen die Bewohner dieser Erde noch keine
Nahrungssorgen gekannt zu haben, auch
dürsten sie kaum einem Berus nachgegangen
sein, sonst hätten sie wohl nicht Zeit gesunden,
sich immer nur mit den wechselseitigen Beziehun-
gen der beiden Geschlechter zu befassen.
Wie lebte der Homo sapiens auS der Ton-
filmzeit? Man darf auö den wenigen erhalten
gebliebenen Tonfilmen schließen: nicht schlecht.
Gewiß, seine Wohnungen mären noch primitiv
88
gemessen lächerlich. Aber dafür blieb ihm auch
der eigentliche Kampf um daS Leben erspart.
Wenn er nämlich nicht gerade liebeskrank war,
trieb er — wie uns die Tonfilme zeigen —
Allotria, die uns Heutigen zwar unverständlich
sind, die aber doch im Jahre 1935 allgemeine
Heiterkeit verbreitet haben dürften. Gut die
Hälfte aller dieser Tonfilmmenschen sind lustige
Typen, die ihr Leben nur auf Schabernack und
bllk gestellt hatten.
Zwischendurch sehen wir aber immer wieder
eine Horde unbekleideter Mädchen erscheinen —
diese scheinen besonders in Amerika beheimatet
gewesen zu sein und man nannte sie „Girls" —,
die alle etwa entstehenden Konflikte durch wüste
Gliederverrenkungen wieder in Ordnung brach-
ten. Ähnliche Sitten finden wir um einige
Jahrtausende weiter zurück, beim Homo Heidel-
bergensis, manchmal auch Palaeoanthropus
Heidelbergensis genannt, der aber diese girl-
haften Gliederverrenkungen auS religiösen Mo-
tiven und nicht wie der Tonfilmmensch zur
Schlichtung von Liebeskonslikten vollsührte.
Auffallend an dem Tonfilminenschen ist ferner
seine — schon eingangs erwähnte — SangeS-
freudigkeit. Man kann zwar nicht behaupten,
daß seine Musik für unsere Ohren besonders
hübsch klingt, dem Tonfilminenschen scheint sie
aber genügt zu haben. Die Musik entstand
scheinbar so, daß ein Komponist daS noch ein-
mal ausschrieb, waS ein anderer vor ihm schon
von einem anderen genominen hatte. Die Men-
schen sangen allein oder im Duett, von einer
Musik begleitet, die offenbar dadurch entstand,
daß verschiedenes Kochgeschirr in gewissen Inter-
vallen zu Boden geschlagen wurde. Daher auch
der Name „Schlager", lvie man diese Lieder
um 1933 nannte. Die Texte dieser „Schlager"
beschränkten sich aus sehr einfache Feststellun-
gen. Manchmal waren sie nur Zurufe an alte
Schimniel, kräftig anzuziehen, manchmal waren
sie simple Absch'"dSgrüße an Gardeoffiziere.
Refugium und stets iviederkehrende Zu-
fluchtsstätte deS Menschen auS der Tonfilm-
periode aber war der sogenannte Wiener-
Heurige. In jedem der aus iinö überkommenen
Tonfilme auS jener Zeit sehen wir, wie der
Tonsilmmensch immer wieder in so einen Heu-
rigengarten zurückkehrt. Hier scheint sich über-
haupt daS Wiener Leben abgespielt zu haben,
hier wurden Liebeskonflikte ausgetragen, in
Ordnung gebracht, Beziehungen geknüpft, gelöst
und wieder geleimt.
Allerdings, meine lieben Schüler, darf ich
euch nicht verschweigen, daß es Historiker gibt,
die allen Ernstes behaupten, das Leben von
1933 sei gar nicht so behaglich gewesen, wie eS
uns die Tonfilme auS jener Zeit schildern. Hier
gehen aber die Meinungen unserer Forscher-
hart auseinander. Wir können unö nur an das
halten, waS von der Vorwelt sichtbar und hör-
bar aus uns gekommen ist. Wir können die
Menschen aus jener Epoche nur so sehen, wie
sie sich unS selbst gezeigt haben, blnd jedes
Zeitalter nimmt das Risiko aus sich, so aus die
Nachwelt zu kommen, wie eS sich in seinen
Tonfilmen photographieren und synchronijieren
läßt.
waren bemüht, ihren Körper restlos zu ver-
hüllen, weil sie scheinbar so viele körperliche
Fehler hatten, daß sie sich scheuten, diese öffent-
lich zur Schau zu stellen. Hingegen zeigen die
Frauen der Tonfilmperiode schon ein weit-
gehendes Bedürfnis, sich möglichst hüllenlos zur
Schau zu stellen. Auch eine gewisse barbarische
Bemalung aller sichtbaren Körperteile fällt aus,
die an die allerfrühesten Zeiten des Homo
sapiens erinnert, als er sich ebenfalls noch mit
bunten Farbstoffen bemalte, um so seinen ohne
Zweifel vorhandenen künstlerischen Drang auf
die primitivste Weise zu stillen.
Wir sehen in diesem Tonfilm auS dem Jahre
i93o kveiter, daß sich die ganze Welt damals
nur noch um die Liebe drehte. Andere Sorgen
scheint der Tonfilmmensch nicht gehabt zu
haben. Immer wieder kreist in den Gehirnen
dieser prähistorischen Männer die Sorge, ob sie
ihn liebt, ob sie ihm treu ist und ob sie es
bleiben wird. Während das Weibchen bemüht
ist, die Beantwortung dieser welterschütternden
Fragen mit allen Listen hinauszuschieben. In-
folgedessen ist ihr ganzes Sinnen und Trachten
daraus gerichtet, ihre wirkliche Einstellung zu
dem Männchen ihrer Wahl zu verdunkeln und
sich erst knapp vor dem sogenannten ,,Happy
end“ — ein Terminus aus jener Zeit — völlig
zu deklarieren.
Wir Historiker von 3000 möchten zusam-
mensassend sagen: Es muß eine glückliche Zeit
gewesen sein. Da sich alles um die Liebe drehte,
scheinen die Bewohner dieser Erde noch keine
Nahrungssorgen gekannt zu haben, auch
dürsten sie kaum einem Berus nachgegangen
sein, sonst hätten sie wohl nicht Zeit gesunden,
sich immer nur mit den wechselseitigen Beziehun-
gen der beiden Geschlechter zu befassen.
Wie lebte der Homo sapiens auS der Ton-
filmzeit? Man darf auö den wenigen erhalten
gebliebenen Tonfilmen schließen: nicht schlecht.
Gewiß, seine Wohnungen mären noch primitiv
88