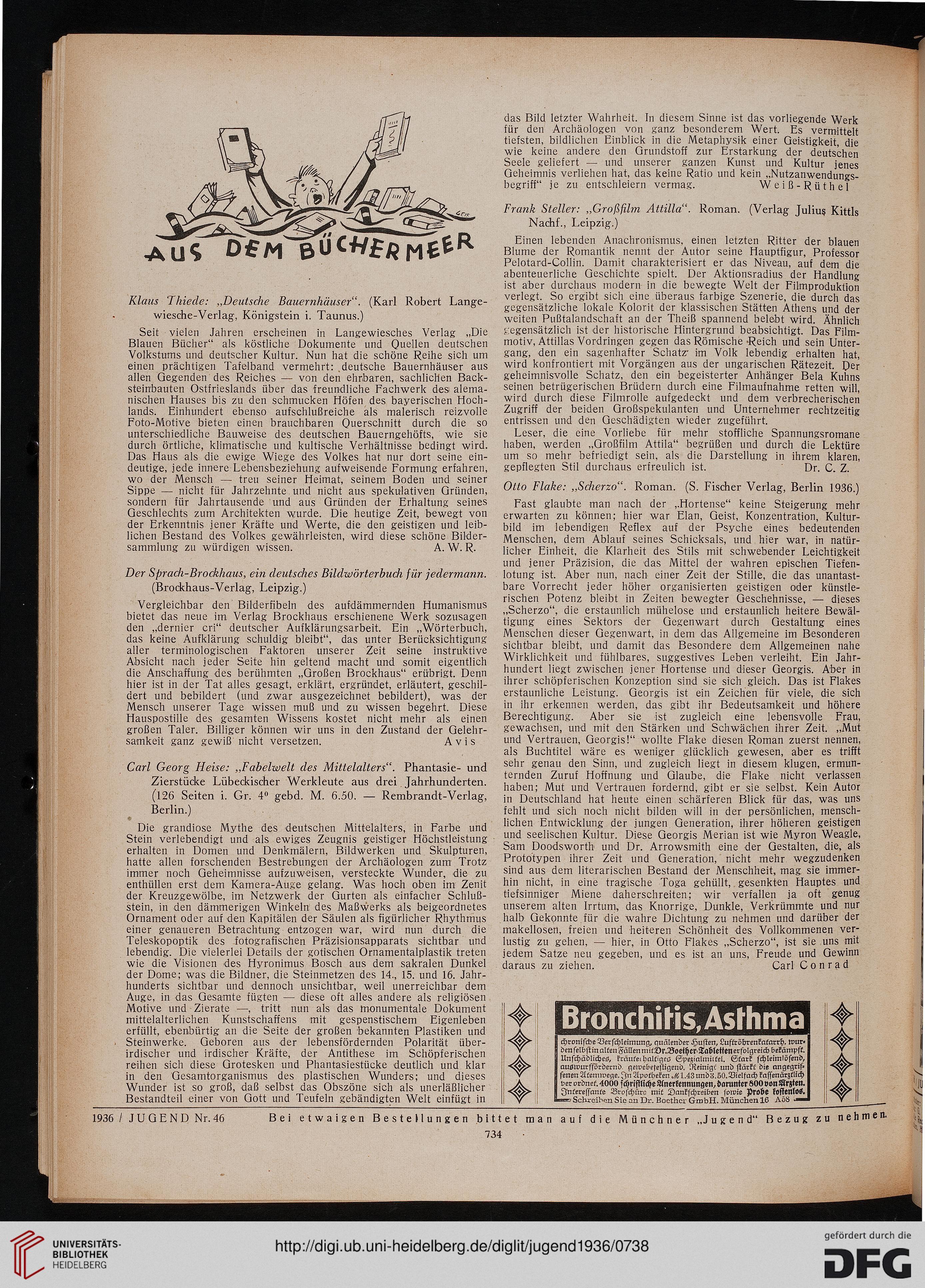Klaus Thiecle: „Deutsche Bauernhäuser ‘. (Karl Robert Lange-
wiesche-Verlag, Königstein i. Taunus.)
Seit vielen Jahren erscheinen in Langewiesches Verlag „Die
Blauen Bücher“ als köstliche Dokumente und Quellen deutschen
Volkstums und deutscher Kultur. Nun hat die schöne Reihe sich um
einen prächtigen Tafelband vermehrt: .deutsche Bauernhäuser aus
allen Gegenden des Reiches — von den ehrbaren, sachlichen Back-
steinbauten Ostfrieslands über das freundliche Fachwerk des alema-
nischen Hauses bis zu den schmucken Höfen des bayerischen Hoch-
lands. Einhundert ebenso aufschlußreiche als malerisch reizvolle
Foto-Motive bieten einen brauchbaren Querschnitt durch die so
unterschiedliche Bauweise des deutschen Bauerngehöfts, wie sie
durch örtliche, klimatische und kultische Verhältnisse bedingt wird.
Das Haus als die ewige Wiege des Volkes hat nur dort seine ein-
deutige, jede innere Lebensbeziehung aufweisende Formung erfahren,
wo der Mensch — treu seiner Heimat, seinem Boden und seiner
Sippe — nicht für Jahrzehnte und nicht aus spekulativen Gründen,
sondern für Jahrtausende und aus Gründen der Erhaltung seines
Geschlechts zum Architekten wurde. Die heutige Zeit, bewegt von
der Erkenntnis jener Kräfte und Werte, die den geistigen und leib-
lichen Bestand des Volkes gewährleisten, wird diese schöne Bilder-
sammlung zu würdigen wissen. A. W. R.
Der Sprach-Brockhaus, ein deutsches Bildwörterbuch für jedermann.
(Brockhaus-Verlag, Leipzig.)
Vergleichbar den Bilderfibeln des aufdämmernden Humanismus
bietet das neue im Verlag Brockhaus erschienene Werk sozusagen
den „dernier cri“ deutscher Aufklärungsarbeit. Ein „Wörterbuch,
das keine Aufklärung schuldig bleibt“, das unter Berücksichtigung
aller terminologischen Faktoren unserer Zeit seine instruktive
Absicht nach jeder Seite hin geltend macht und somit eigentlich
die Anschaffung des berühmten „Großen Brockhaus“ erübrigt. Denn
hier ist in der Tat alles gesagt, erklärt, ergründet, erläutert, geschil-
dert und bebildert (und zwar ausgezeichnet bebildert), was der
Mensch unserer Tage wissen muß und zu wissen begehrt. Diese
Hauspostille des gesamten Wissens kostet nicht mehr als einen
großen Taler. Billiger können wir uns in den Zustand der Gelehr-
samkeit ganz gewiß nicht versetzen. Avis
Carl Georg Heise: „Fabelwelt des Mittelalters“. Phantasie- und
Zierstücke Lübeckischer Werkleute aus drei Jahrhunderten.
(126 Seiten i. Gr. 4° gebd. M. 6.50. — Rembrandt-Verlag,
Berlin.)
Die grandiose Mythe des deutschen Mittelalters, in Farbe und
Stein verlebendigt und als ewiges Zeugnis geistiger Höchstleistung
erhalten in Domen und Denkmälern, Bildwerken und Skulpturen,
hatte allen forschenden Bestrebungen der Archäologen zum Trotz
immer noch Geheimnisse aufzuweisen, versteckte Wunder, die zu
enthüllen erst dem Kamera-Auge gelang. Was hoch oben im Zenit
der Kreuzgewölbe, im Netzwerk der Gurten als einfacher Schluß-
stein, in den dämmerigen Winkeln des Maßwerks als beigeordnetes
Ornament oder auf den Kapitälen der Säulen als figürlicher Rhythmus
einer genaueren Betrachtung entzogen war, wird nun durch die
Teleskopoptik des fotografischen Präzisionsapparats sichtbar und
lebendig. Die vielerlei Details der gotischen Ornamentalplastik treten
wie die Visionen des Hyronimus Bosch aus dem sakralen Dunkel
der Dome; was die Bildner, die Steinmetzen des 14., 15. und 16. Jahr-
hunderts sichtbar und dennoch unsichtbar, weil unerreichbar dem
Auge, in das Gesamte fügten —- diese oft alles andere als religiösen
Motive und Zierate —, tritt nun als das monumentale Dokument
mittelalterlichen Kunstschaffens mit gespenstischem Eigenleben
erfüllt, ebenbürtig an die Seite der großen bekannten Plastiken und
Steinwerke. Geboren aus der lebensfördernden Polarität über-
irdischer und irdischer Kräfte, der Antithese im Schöpferischen
reihen sich diese Grotesken und Phantasiestücke deutlich und klar
in den Gesamtorganismus des plastischen Wunders; und dieses
Wunder ist so groß, daß selbst das Obszöne sich als unerläßlicher
Bestandteil einer von Gott und Teufeln gebändigten Welt einfügt in
das Bild letzter Wahrheit. In diesem Sinne ist das vorliegende Werk
für den Archäologen von ganz besonderem Wert. Es vermittelt
tiefsten, bildlichen Einblick in die Metaphysik einer Geistigkeit, die
wie keine andere den Grundstoff zur Erstarkung der deutschen
Seele geliefert — und unserer ganzen Kunst und Kultur jenes
Geheimnis verliehen hat, das keine Ratio und kein „Nutzanwendungs-
begriff“ je zu entschleiern vermag. Weiß-Rüthel
Frank Steller: „Großfilm Attilla“. Roman. (Verlag Julius Kittls
Nachf., Leipzig.)
Einen lebenden Anachronismus, einen letzten Ritter der blauen
Blume der Romantik nennt der Autor seine Hauptfigur, Professor
Pelotard-Collin. Damit charakterisiert er das Niveau, auf dem die
abenteuerliche Geschichte spielt. Der Aktionsradius der Handlung
ist aber durchaus modern in die bewegte Welt der Filmproduktion
verlegt. So ergibt sich eine überaus farbige Szenerie, die durch das
gegensätzliche lokale Kolorit der klassischen Stätten Athens und der
weiten Pußtalandschaft an der Theiß spannend belebt wird. Ähnlich
gegensätzlich ist der historische Hintergrund beabsichtigt. Das Film-
motiv, Attillas Vordringen gegen das Römische Reich und sein Unter-
gang, den ein sagenhafter Schatz' im Volk lebendig erhalten hat,
wird konfrontiert mit Vorgängen aus der ungarischen Rätezeit. Der
geheimnisvolle Schatz, den ein begeisterter Anhänger Bela Kuhns
seinen betrügerischen Brüdern durch eine Filmaufnahme retten will,
wird durch diese Filmrolle aufgedeckt und dem verbrecherischen
Zugriff der beiden Großspekulanten und Unternehmer rechtzeitig
entrissen und den Geschädigten wieder zugeführt.
Leser, die eine Vorliebe für mehr stoffliche Spannungsromane
haben, werden „Großfilm Attila“ begrüßen und durch die Lektüre
um so mehr befriedigt sein, als die Darstellung in ihrem klaren,
gepflegten Stil durchaus erfreulich ist. Dr. C. Z.
Otto Flake: „Scherzo“. Roman. (S. Fischer Verlag, Berlin 1936.)
Fast glaubte man nach der ,.Hortense“ keine Steigerung mehr
erwarten zu können; hier war Elan, Geist, Konzentration, Kultur-
bild im lebendigen Reflex auf der Psyche eines bedeutenden
Menschen, dem Ablauf seines Schicksals, und hier war, in natür-
licher Einheit, die Klarheit des Stils mit schwebender Leichtigkeit
und jener Präzision, die das Mittel der wahren epischen Tiefen-
lotung ist. Aber nun, nach einer Zeit der Stille, die das unantast-
bare Vorrecht jeder höher organisierten geistigen oder künstle-
rischen Potenz bleibt in Zeiten bewegter Geschehnisse, — dieses
„Scherzo“, die erstaunlich mühelose und erstaunlich heitere Bewäl-
tigung eines Sektors der Gegenwart durch Gestaltung eines
Menschen dieser Gegenwart, in dem das Allgemeine im Besonderen
sichtbar bleibt, und damit das Besondere dem Allgemeinen nahe
Wirklichkeit und fühlbares, suggestives Leben verleiht. Ein Jahr-
hundert liegt zwischen jener Hortense und dieser Georgis. Aber in
ihrer schöpferischen Konzeption sind sie sich gleich. Das ist Flakes
erstaunliche Leistung. Georgis ist ein Zeichen für viele, die sich
in ihr erkennen werden, das gibt ihr Bedeutsamkeit und höhere
Berechtigung. Aber sie ist zugleich eine lebensvolle Frau,
gewachsen, und mit den Stärken und Schwächen ihrer Zeit. „Mut
und Vertrauen, Georgis!“ wollte Flake diesen Roman zuerst nennen,
als Buchtitel wäre es weniger glücklich gewesen, aber es trifft
sehr genau den Sinn, und zugleich liegt in diesem klugen, ermun-
ternden Zuruf Hoffnung und Glaube, die Flake nicht verlassen
haben; Mut und Vertrauen fordernd, gibt er sie selbst. Kein Autor
in Deutschland hat heute einen schärferen Blick für das, was uns
fehlt und sich noch nicht bilden will in der persönlichen, mensch-
lichen Entwicklung der jungen Generation, ihrer höheren geistigen
und seelischen Kultur. Diese Georgis Merlan ist wie Myron Weagle,
Sam Doodsworth und Dr. Arrowsmith eine der Gestalten, die, als
Prototypen ihrer Zeit und Generation, nicht mehr wegzudenken
sind aus dem literarischen Bestand der Menschheit, mag sie immer-
hin nicht, in eine tragische Toga gehüllt, gesenkten Hauptes und
tiefsinniger Miene daherschreiten; wir verfallen ja oft genug
unserem alten Irrtum, das Knorrige, Dunkle, Verkrümmte und nur
halb Gekonnte für die wahre Dichtung zu nehmen und darüber der
makellosen, freien und heiteren Schönheit des Vollkommenen ver-
lustig zu gehen, — hier, in Otto Flakes „Scherzo“, ist sie uns mit
jedem Satze neu gegeben, und es ist an uns, Freude und Gewinn
daraus zu ziehen. Carl Conrad
Bronchitis, Asthma
I chronische Verschleimung, qucilenber Husten, Luströbrenkatarrh. Wur-
den selbstin alten Fällen mitOr.BoethepTablettenerfolgreich bekämpft.
Unschädliches, kräutei haltiges Spezialmiitel. Stark schleimlösend,
auSwurffordernd. gewebesestigend. Neinigt und stärkt die angegrif-
fenen Atemwege. In Apotheken J61.43 und3.50.Vielsach kassenärztlich
ver ordnet. 4000 schriftliche Anerkennungen, darunter 800 von Ärzten.
Interessante Broschüre mit Dankschreiben sowie Probe kostenlos.
Schreiben Sie an Dr. Boethcr GmbH. München 16 AöS
Bei etwaigen Bestellungen bittet man auf die Münchner „Jugend“ Bezug zu nehmen.
734
1936 / JUGEND Nr.46
wiesche-Verlag, Königstein i. Taunus.)
Seit vielen Jahren erscheinen in Langewiesches Verlag „Die
Blauen Bücher“ als köstliche Dokumente und Quellen deutschen
Volkstums und deutscher Kultur. Nun hat die schöne Reihe sich um
einen prächtigen Tafelband vermehrt: .deutsche Bauernhäuser aus
allen Gegenden des Reiches — von den ehrbaren, sachlichen Back-
steinbauten Ostfrieslands über das freundliche Fachwerk des alema-
nischen Hauses bis zu den schmucken Höfen des bayerischen Hoch-
lands. Einhundert ebenso aufschlußreiche als malerisch reizvolle
Foto-Motive bieten einen brauchbaren Querschnitt durch die so
unterschiedliche Bauweise des deutschen Bauerngehöfts, wie sie
durch örtliche, klimatische und kultische Verhältnisse bedingt wird.
Das Haus als die ewige Wiege des Volkes hat nur dort seine ein-
deutige, jede innere Lebensbeziehung aufweisende Formung erfahren,
wo der Mensch — treu seiner Heimat, seinem Boden und seiner
Sippe — nicht für Jahrzehnte und nicht aus spekulativen Gründen,
sondern für Jahrtausende und aus Gründen der Erhaltung seines
Geschlechts zum Architekten wurde. Die heutige Zeit, bewegt von
der Erkenntnis jener Kräfte und Werte, die den geistigen und leib-
lichen Bestand des Volkes gewährleisten, wird diese schöne Bilder-
sammlung zu würdigen wissen. A. W. R.
Der Sprach-Brockhaus, ein deutsches Bildwörterbuch für jedermann.
(Brockhaus-Verlag, Leipzig.)
Vergleichbar den Bilderfibeln des aufdämmernden Humanismus
bietet das neue im Verlag Brockhaus erschienene Werk sozusagen
den „dernier cri“ deutscher Aufklärungsarbeit. Ein „Wörterbuch,
das keine Aufklärung schuldig bleibt“, das unter Berücksichtigung
aller terminologischen Faktoren unserer Zeit seine instruktive
Absicht nach jeder Seite hin geltend macht und somit eigentlich
die Anschaffung des berühmten „Großen Brockhaus“ erübrigt. Denn
hier ist in der Tat alles gesagt, erklärt, ergründet, erläutert, geschil-
dert und bebildert (und zwar ausgezeichnet bebildert), was der
Mensch unserer Tage wissen muß und zu wissen begehrt. Diese
Hauspostille des gesamten Wissens kostet nicht mehr als einen
großen Taler. Billiger können wir uns in den Zustand der Gelehr-
samkeit ganz gewiß nicht versetzen. Avis
Carl Georg Heise: „Fabelwelt des Mittelalters“. Phantasie- und
Zierstücke Lübeckischer Werkleute aus drei Jahrhunderten.
(126 Seiten i. Gr. 4° gebd. M. 6.50. — Rembrandt-Verlag,
Berlin.)
Die grandiose Mythe des deutschen Mittelalters, in Farbe und
Stein verlebendigt und als ewiges Zeugnis geistiger Höchstleistung
erhalten in Domen und Denkmälern, Bildwerken und Skulpturen,
hatte allen forschenden Bestrebungen der Archäologen zum Trotz
immer noch Geheimnisse aufzuweisen, versteckte Wunder, die zu
enthüllen erst dem Kamera-Auge gelang. Was hoch oben im Zenit
der Kreuzgewölbe, im Netzwerk der Gurten als einfacher Schluß-
stein, in den dämmerigen Winkeln des Maßwerks als beigeordnetes
Ornament oder auf den Kapitälen der Säulen als figürlicher Rhythmus
einer genaueren Betrachtung entzogen war, wird nun durch die
Teleskopoptik des fotografischen Präzisionsapparats sichtbar und
lebendig. Die vielerlei Details der gotischen Ornamentalplastik treten
wie die Visionen des Hyronimus Bosch aus dem sakralen Dunkel
der Dome; was die Bildner, die Steinmetzen des 14., 15. und 16. Jahr-
hunderts sichtbar und dennoch unsichtbar, weil unerreichbar dem
Auge, in das Gesamte fügten —- diese oft alles andere als religiösen
Motive und Zierate —, tritt nun als das monumentale Dokument
mittelalterlichen Kunstschaffens mit gespenstischem Eigenleben
erfüllt, ebenbürtig an die Seite der großen bekannten Plastiken und
Steinwerke. Geboren aus der lebensfördernden Polarität über-
irdischer und irdischer Kräfte, der Antithese im Schöpferischen
reihen sich diese Grotesken und Phantasiestücke deutlich und klar
in den Gesamtorganismus des plastischen Wunders; und dieses
Wunder ist so groß, daß selbst das Obszöne sich als unerläßlicher
Bestandteil einer von Gott und Teufeln gebändigten Welt einfügt in
das Bild letzter Wahrheit. In diesem Sinne ist das vorliegende Werk
für den Archäologen von ganz besonderem Wert. Es vermittelt
tiefsten, bildlichen Einblick in die Metaphysik einer Geistigkeit, die
wie keine andere den Grundstoff zur Erstarkung der deutschen
Seele geliefert — und unserer ganzen Kunst und Kultur jenes
Geheimnis verliehen hat, das keine Ratio und kein „Nutzanwendungs-
begriff“ je zu entschleiern vermag. Weiß-Rüthel
Frank Steller: „Großfilm Attilla“. Roman. (Verlag Julius Kittls
Nachf., Leipzig.)
Einen lebenden Anachronismus, einen letzten Ritter der blauen
Blume der Romantik nennt der Autor seine Hauptfigur, Professor
Pelotard-Collin. Damit charakterisiert er das Niveau, auf dem die
abenteuerliche Geschichte spielt. Der Aktionsradius der Handlung
ist aber durchaus modern in die bewegte Welt der Filmproduktion
verlegt. So ergibt sich eine überaus farbige Szenerie, die durch das
gegensätzliche lokale Kolorit der klassischen Stätten Athens und der
weiten Pußtalandschaft an der Theiß spannend belebt wird. Ähnlich
gegensätzlich ist der historische Hintergrund beabsichtigt. Das Film-
motiv, Attillas Vordringen gegen das Römische Reich und sein Unter-
gang, den ein sagenhafter Schatz' im Volk lebendig erhalten hat,
wird konfrontiert mit Vorgängen aus der ungarischen Rätezeit. Der
geheimnisvolle Schatz, den ein begeisterter Anhänger Bela Kuhns
seinen betrügerischen Brüdern durch eine Filmaufnahme retten will,
wird durch diese Filmrolle aufgedeckt und dem verbrecherischen
Zugriff der beiden Großspekulanten und Unternehmer rechtzeitig
entrissen und den Geschädigten wieder zugeführt.
Leser, die eine Vorliebe für mehr stoffliche Spannungsromane
haben, werden „Großfilm Attila“ begrüßen und durch die Lektüre
um so mehr befriedigt sein, als die Darstellung in ihrem klaren,
gepflegten Stil durchaus erfreulich ist. Dr. C. Z.
Otto Flake: „Scherzo“. Roman. (S. Fischer Verlag, Berlin 1936.)
Fast glaubte man nach der ,.Hortense“ keine Steigerung mehr
erwarten zu können; hier war Elan, Geist, Konzentration, Kultur-
bild im lebendigen Reflex auf der Psyche eines bedeutenden
Menschen, dem Ablauf seines Schicksals, und hier war, in natür-
licher Einheit, die Klarheit des Stils mit schwebender Leichtigkeit
und jener Präzision, die das Mittel der wahren epischen Tiefen-
lotung ist. Aber nun, nach einer Zeit der Stille, die das unantast-
bare Vorrecht jeder höher organisierten geistigen oder künstle-
rischen Potenz bleibt in Zeiten bewegter Geschehnisse, — dieses
„Scherzo“, die erstaunlich mühelose und erstaunlich heitere Bewäl-
tigung eines Sektors der Gegenwart durch Gestaltung eines
Menschen dieser Gegenwart, in dem das Allgemeine im Besonderen
sichtbar bleibt, und damit das Besondere dem Allgemeinen nahe
Wirklichkeit und fühlbares, suggestives Leben verleiht. Ein Jahr-
hundert liegt zwischen jener Hortense und dieser Georgis. Aber in
ihrer schöpferischen Konzeption sind sie sich gleich. Das ist Flakes
erstaunliche Leistung. Georgis ist ein Zeichen für viele, die sich
in ihr erkennen werden, das gibt ihr Bedeutsamkeit und höhere
Berechtigung. Aber sie ist zugleich eine lebensvolle Frau,
gewachsen, und mit den Stärken und Schwächen ihrer Zeit. „Mut
und Vertrauen, Georgis!“ wollte Flake diesen Roman zuerst nennen,
als Buchtitel wäre es weniger glücklich gewesen, aber es trifft
sehr genau den Sinn, und zugleich liegt in diesem klugen, ermun-
ternden Zuruf Hoffnung und Glaube, die Flake nicht verlassen
haben; Mut und Vertrauen fordernd, gibt er sie selbst. Kein Autor
in Deutschland hat heute einen schärferen Blick für das, was uns
fehlt und sich noch nicht bilden will in der persönlichen, mensch-
lichen Entwicklung der jungen Generation, ihrer höheren geistigen
und seelischen Kultur. Diese Georgis Merlan ist wie Myron Weagle,
Sam Doodsworth und Dr. Arrowsmith eine der Gestalten, die, als
Prototypen ihrer Zeit und Generation, nicht mehr wegzudenken
sind aus dem literarischen Bestand der Menschheit, mag sie immer-
hin nicht, in eine tragische Toga gehüllt, gesenkten Hauptes und
tiefsinniger Miene daherschreiten; wir verfallen ja oft genug
unserem alten Irrtum, das Knorrige, Dunkle, Verkrümmte und nur
halb Gekonnte für die wahre Dichtung zu nehmen und darüber der
makellosen, freien und heiteren Schönheit des Vollkommenen ver-
lustig zu gehen, — hier, in Otto Flakes „Scherzo“, ist sie uns mit
jedem Satze neu gegeben, und es ist an uns, Freude und Gewinn
daraus zu ziehen. Carl Conrad
Bronchitis, Asthma
I chronische Verschleimung, qucilenber Husten, Luströbrenkatarrh. Wur-
den selbstin alten Fällen mitOr.BoethepTablettenerfolgreich bekämpft.
Unschädliches, kräutei haltiges Spezialmiitel. Stark schleimlösend,
auSwurffordernd. gewebesestigend. Neinigt und stärkt die angegrif-
fenen Atemwege. In Apotheken J61.43 und3.50.Vielsach kassenärztlich
ver ordnet. 4000 schriftliche Anerkennungen, darunter 800 von Ärzten.
Interessante Broschüre mit Dankschreiben sowie Probe kostenlos.
Schreiben Sie an Dr. Boethcr GmbH. München 16 AöS
Bei etwaigen Bestellungen bittet man auf die Münchner „Jugend“ Bezug zu nehmen.
734
1936 / JUGEND Nr.46