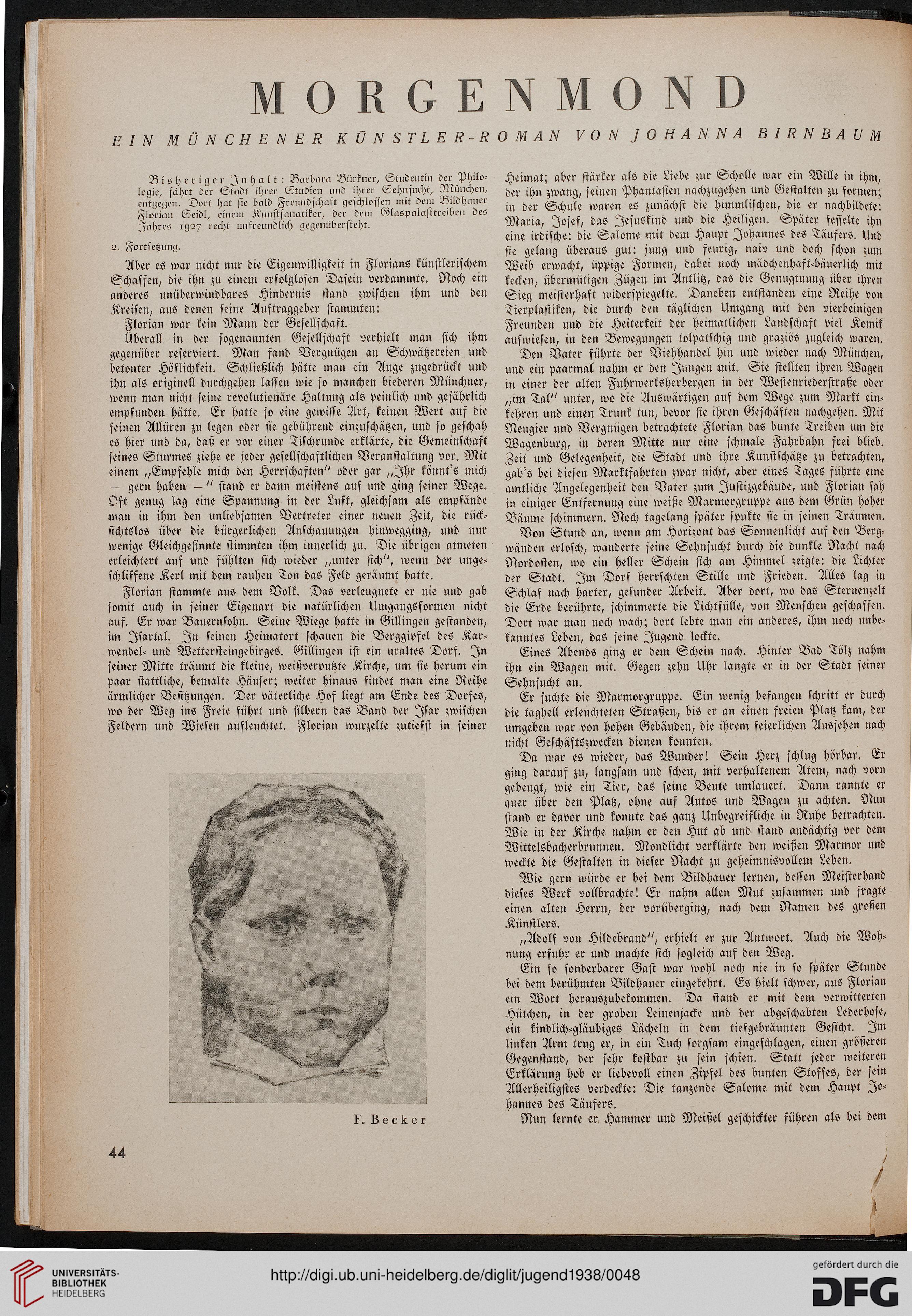MORGENMOND
EIN MÜNCHENER KÜNSTLER-ROMAN VON JOHANNA BIRNBAUM
Bisheriger Inhalt: Barbara Bürkner, Studentin der Philo-
logie, fährt der Stadt ihrer Studien nnd ihrer Sehnsucht, München,
entgegen. Dort hat sie bald Freundschaft geschlossen mit dem Bildhauer
Florian Seidl, einem Kunstfanatiker, der dem Glaspalajttrcibcn des
Jahres 1927 recht unfreundlich gegenübcrsteht.
2. Fortsetzung.
Aber eS war nicht nur die Eigenwilligkeit in Florians künstlerischem
Schaffen, die ihn zu einem erfolglosen Dasein verdammte. Noch ein
anderes unüberwindbares Hindernis stand zwischen ihm und den
Kreisen, aus denen seine Auftraggeber stammten:
Florian war kein Mann der Gesellschaft.
Überall in der sogenannten Gesellschaft verhielt man sich ihm
gegenüber reserviert. Man fand Vergnügen an Schwatzereien und
betonter Höflichkeit. Schließlich hätte man ein Auge zugedrückt und
ihn als originell durchgehen lasten wie so manchen biederen Münchner,
wenn man nicht seine revolutionäre Haltung als peinlich und gefährlich
empfunden hätte. Cr batte so eine gewisse Art, keinen Wert auf die
feinen Allüren zu legen oder sie gebührend einzuschätzen, und so geschah
es hier und da, daß er vor einer Tischrunde erklärte, die Gemeinschaft
seines Sturmes ziehe er jeder gesellschaftlichen Veranstaltung vor. Mit
einem „Empfehle mich den Herrschaften" oder gar „Ihr könnt's mich
— gern haben — " stand er dann meistens auf und ging seiner Wege.
Oft genug lag eine Spannung in der Luft, gleichsam als empfände
man in ihm den unliebsamen Vertreter einer neuen Zeit, die rück-
sichtslos über die bürgerlichen Anschauungen hinwegging, und nur
wenige Gleichgesinnte stimmten ihm innerlich zu. Die übrigen atmeten
erleichtert auf und fühlten sich wieder „unter sich", wenn der unge-
schliffene Kerl mit dem rauhen Ton das Feld geräumt hatte.
Florian stammte aus dem Volk. Das verleugnete er nie und gab
somit auch in seiner Eigenart die natürlichen Umgangsformen nicht
auf. Er war Bauernsohn. Seine Wiege hatte in Gillingen gestanden,
im Isartal. In seinen Heimatort schauen die Berggipfel des Kar-
wendel- und Wettersteingebirges. Gillingen ist ein uraltes Dorf. In
seiner Mitte träumt die kleine, weißverputzte Kirche, um sie herum ein
paar stattliche, bemalte Häuser; weiter hinaus findet man eine Reihe
ärmlicher Besitzungen. Der väterliche Hof liegt am Ende des Dorfes,
wo der Weg ins Freie führt und silbern das Band der Isar zwischen
Feldern und Wiesen aufleuchtet. Florian wurzelte zutiefst in seiner
Fo Becker
Heimat; aber stärker als oie Liebe zur Scholle war ein Wille in ihm,
der ihn zwang, seinen Phantasten nachzugehen und Gestalten zu formen;
in der Schule waren es zunächst die himmlischen, die er nachbildete:
Maria, Josef, das Jesuskind und die Heiligen. Später fesselte ihn
eine irdische: die Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers. Und
sie gelang überaus gut: jung und feurig, naiv und doch schon zum
Weib erwacht, üppige Formen, dabei noch mädchenhaft-bäuerlich mit
kecken, übermütigen Zügen im Antlitz, das die Genugtuung über ihren
Sieg meisterhaft widerspiegelte. Daneben entstanden eine Reihe von
Tierplastiken, die durch den täglichen Umgang mit den vierbeinigen
Freunden und die Heiterkeit der heimatlichen Landschaft viel Komik
auswiesen, in den Bewegungen tolpatschig und graziös zugleich waren.
Den Vater führte der Viehhandel hin und wieder nach München,
und ein paarmal nahm er den Jungen mit. Sie stellten ihren Wagen
in einer der alten Fuhrwerksherbergen in der Westenriederstraße oder
„im Tal" unter, wo die Auswärtigen auf dem Wege zum Markt ein-
kehren und einen Trunk tun, bevor sie ihren Geschäften nachgehen. Mit
Neugier und Vergnügen betrachtete Florian das bunte Treiben um die
Wagenburg, in deren Mitte nur eine schmale Fahrbahn frei blieb.
Zeit und Gelegenheit, die Stadt und ihre Kunstschätze zu betrachten,
gab's bei diesen Marktfahrten zwar nicht, aber eines Tages führte eine
amtliche Angelegenheit den Vater zum Justizgebäude, und Florian sah
in einiger Entfernung eine weiße Marmorgruppe aus dem Grün hoher
Bäume schimmern. Noch tagelang später spukte sie in seinen Träumen.
Von Stund an, wenn am Horizont das Sonnenlicht auf den Berg-
wänden erlosch, wanderte seine Sehnsucht durch die dunkle Nacht nach
Nordosten, wo ein heller Schein sich am Himmel zeigte: die Lichter
der Stadt. Im Dorf herrschten Stille und Frieden. Alles lag in
Schlaf nach harter, gesunder Arbeit. Aber dort, wo daö Sternenzelt
die Erde berührte, schimmerte die Lichtfülle, von Menschen geschaffen.
Dort war man noch wach; dort lebte man ein anderes, ihm noch unbe-
kanntes Leben, das seine Jugend lockte.
Eines Abends ging er dem Schein nach. Hinter Bad Tölz nahm
ihn ein Wagen mit. Gegen zehn Uhr langte er in der Stadt seiner
Sehnsucht an.
Er suchte die Marmorgruppe. Ein wenig befangen schritt er durch
die taghell erleuchteten Straßen, bis er an einen freien Platz kam, der
umgeben war von hohen Gebäuden, die ihrem feierlichen Aussehen nach
nicht Geschäftszwecken dienen konnten.
Da war es wieder, das Wunder! Sein Herz schlug hörbar. Er-
ging darauf zu, langsam und scheu, mit verhaltenem Atem, nach vorn
gebeugt, wie ein Tier, das seine Beute umlauert. Dann rannte er
quer über den Platz, ohne auf Autos und Wagen zu achten. Nun
stand er davor und konnte das ganz Unbegreifliche in Ruhe betrachten.
Wie in der Kirche nahm er den Hut ab und stand andächtig vor dem
Wittelsbacherbrunnen. Mondlicht verklärte den weißen Marmor und
weckte die Gestalten in dieser Nacht zu geheimnisvollem Leben.
Wie gern würde er bei dem Bildhauer lernen, dessen Meisterhand
dieses Werk vollbrachte! Er nahm allen Mut zusammen und fragte
einen alten Herrn, der vorüberging, nach dem Namen deS großen
Künstlers.
„Adolf von Hildebrand", erhielt er zur Antwort. Auch die Woh-
nung erfuhr er und machte sich sogleich auf den Weg.
Ein so sonderbarer Gast war wohl noch nie in so später Stunde
bei dem berühmten Bildhauer eingekehrt. Es hielt schwer, aus Florian
ein Wort herauszubekommen. Da stand er mit dem verwitterten
Hütchen, in der groben Leinenjacke und der abgeschabten Lederhose,
ein kindlich-gläubiges Lächeln in dem tiefgebräunten Gesicht. Im
linken Arm trug er, in ein Tuch sorgsam eingeschlagen, einen größeren
Gegenstand, der sehr kostbar zu sein schien. Statt jeder weiteren
Erklärung hob er liebevoll einen Zipfel des bunten Stoffes, der sein
Allerheiligstes verdeckte: Die tanzende Salome mit dem Haupt Jo-
hannes des Täufers.
Nun lernte er Hammer und Meißel geschickter führen als bei dem
I
i
44
EIN MÜNCHENER KÜNSTLER-ROMAN VON JOHANNA BIRNBAUM
Bisheriger Inhalt: Barbara Bürkner, Studentin der Philo-
logie, fährt der Stadt ihrer Studien nnd ihrer Sehnsucht, München,
entgegen. Dort hat sie bald Freundschaft geschlossen mit dem Bildhauer
Florian Seidl, einem Kunstfanatiker, der dem Glaspalajttrcibcn des
Jahres 1927 recht unfreundlich gegenübcrsteht.
2. Fortsetzung.
Aber eS war nicht nur die Eigenwilligkeit in Florians künstlerischem
Schaffen, die ihn zu einem erfolglosen Dasein verdammte. Noch ein
anderes unüberwindbares Hindernis stand zwischen ihm und den
Kreisen, aus denen seine Auftraggeber stammten:
Florian war kein Mann der Gesellschaft.
Überall in der sogenannten Gesellschaft verhielt man sich ihm
gegenüber reserviert. Man fand Vergnügen an Schwatzereien und
betonter Höflichkeit. Schließlich hätte man ein Auge zugedrückt und
ihn als originell durchgehen lasten wie so manchen biederen Münchner,
wenn man nicht seine revolutionäre Haltung als peinlich und gefährlich
empfunden hätte. Cr batte so eine gewisse Art, keinen Wert auf die
feinen Allüren zu legen oder sie gebührend einzuschätzen, und so geschah
es hier und da, daß er vor einer Tischrunde erklärte, die Gemeinschaft
seines Sturmes ziehe er jeder gesellschaftlichen Veranstaltung vor. Mit
einem „Empfehle mich den Herrschaften" oder gar „Ihr könnt's mich
— gern haben — " stand er dann meistens auf und ging seiner Wege.
Oft genug lag eine Spannung in der Luft, gleichsam als empfände
man in ihm den unliebsamen Vertreter einer neuen Zeit, die rück-
sichtslos über die bürgerlichen Anschauungen hinwegging, und nur
wenige Gleichgesinnte stimmten ihm innerlich zu. Die übrigen atmeten
erleichtert auf und fühlten sich wieder „unter sich", wenn der unge-
schliffene Kerl mit dem rauhen Ton das Feld geräumt hatte.
Florian stammte aus dem Volk. Das verleugnete er nie und gab
somit auch in seiner Eigenart die natürlichen Umgangsformen nicht
auf. Er war Bauernsohn. Seine Wiege hatte in Gillingen gestanden,
im Isartal. In seinen Heimatort schauen die Berggipfel des Kar-
wendel- und Wettersteingebirges. Gillingen ist ein uraltes Dorf. In
seiner Mitte träumt die kleine, weißverputzte Kirche, um sie herum ein
paar stattliche, bemalte Häuser; weiter hinaus findet man eine Reihe
ärmlicher Besitzungen. Der väterliche Hof liegt am Ende des Dorfes,
wo der Weg ins Freie führt und silbern das Band der Isar zwischen
Feldern und Wiesen aufleuchtet. Florian wurzelte zutiefst in seiner
Fo Becker
Heimat; aber stärker als oie Liebe zur Scholle war ein Wille in ihm,
der ihn zwang, seinen Phantasten nachzugehen und Gestalten zu formen;
in der Schule waren es zunächst die himmlischen, die er nachbildete:
Maria, Josef, das Jesuskind und die Heiligen. Später fesselte ihn
eine irdische: die Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers. Und
sie gelang überaus gut: jung und feurig, naiv und doch schon zum
Weib erwacht, üppige Formen, dabei noch mädchenhaft-bäuerlich mit
kecken, übermütigen Zügen im Antlitz, das die Genugtuung über ihren
Sieg meisterhaft widerspiegelte. Daneben entstanden eine Reihe von
Tierplastiken, die durch den täglichen Umgang mit den vierbeinigen
Freunden und die Heiterkeit der heimatlichen Landschaft viel Komik
auswiesen, in den Bewegungen tolpatschig und graziös zugleich waren.
Den Vater führte der Viehhandel hin und wieder nach München,
und ein paarmal nahm er den Jungen mit. Sie stellten ihren Wagen
in einer der alten Fuhrwerksherbergen in der Westenriederstraße oder
„im Tal" unter, wo die Auswärtigen auf dem Wege zum Markt ein-
kehren und einen Trunk tun, bevor sie ihren Geschäften nachgehen. Mit
Neugier und Vergnügen betrachtete Florian das bunte Treiben um die
Wagenburg, in deren Mitte nur eine schmale Fahrbahn frei blieb.
Zeit und Gelegenheit, die Stadt und ihre Kunstschätze zu betrachten,
gab's bei diesen Marktfahrten zwar nicht, aber eines Tages führte eine
amtliche Angelegenheit den Vater zum Justizgebäude, und Florian sah
in einiger Entfernung eine weiße Marmorgruppe aus dem Grün hoher
Bäume schimmern. Noch tagelang später spukte sie in seinen Träumen.
Von Stund an, wenn am Horizont das Sonnenlicht auf den Berg-
wänden erlosch, wanderte seine Sehnsucht durch die dunkle Nacht nach
Nordosten, wo ein heller Schein sich am Himmel zeigte: die Lichter
der Stadt. Im Dorf herrschten Stille und Frieden. Alles lag in
Schlaf nach harter, gesunder Arbeit. Aber dort, wo daö Sternenzelt
die Erde berührte, schimmerte die Lichtfülle, von Menschen geschaffen.
Dort war man noch wach; dort lebte man ein anderes, ihm noch unbe-
kanntes Leben, das seine Jugend lockte.
Eines Abends ging er dem Schein nach. Hinter Bad Tölz nahm
ihn ein Wagen mit. Gegen zehn Uhr langte er in der Stadt seiner
Sehnsucht an.
Er suchte die Marmorgruppe. Ein wenig befangen schritt er durch
die taghell erleuchteten Straßen, bis er an einen freien Platz kam, der
umgeben war von hohen Gebäuden, die ihrem feierlichen Aussehen nach
nicht Geschäftszwecken dienen konnten.
Da war es wieder, das Wunder! Sein Herz schlug hörbar. Er-
ging darauf zu, langsam und scheu, mit verhaltenem Atem, nach vorn
gebeugt, wie ein Tier, das seine Beute umlauert. Dann rannte er
quer über den Platz, ohne auf Autos und Wagen zu achten. Nun
stand er davor und konnte das ganz Unbegreifliche in Ruhe betrachten.
Wie in der Kirche nahm er den Hut ab und stand andächtig vor dem
Wittelsbacherbrunnen. Mondlicht verklärte den weißen Marmor und
weckte die Gestalten in dieser Nacht zu geheimnisvollem Leben.
Wie gern würde er bei dem Bildhauer lernen, dessen Meisterhand
dieses Werk vollbrachte! Er nahm allen Mut zusammen und fragte
einen alten Herrn, der vorüberging, nach dem Namen deS großen
Künstlers.
„Adolf von Hildebrand", erhielt er zur Antwort. Auch die Woh-
nung erfuhr er und machte sich sogleich auf den Weg.
Ein so sonderbarer Gast war wohl noch nie in so später Stunde
bei dem berühmten Bildhauer eingekehrt. Es hielt schwer, aus Florian
ein Wort herauszubekommen. Da stand er mit dem verwitterten
Hütchen, in der groben Leinenjacke und der abgeschabten Lederhose,
ein kindlich-gläubiges Lächeln in dem tiefgebräunten Gesicht. Im
linken Arm trug er, in ein Tuch sorgsam eingeschlagen, einen größeren
Gegenstand, der sehr kostbar zu sein schien. Statt jeder weiteren
Erklärung hob er liebevoll einen Zipfel des bunten Stoffes, der sein
Allerheiligstes verdeckte: Die tanzende Salome mit dem Haupt Jo-
hannes des Täufers.
Nun lernte er Hammer und Meißel geschickter führen als bei dem
I
i
44