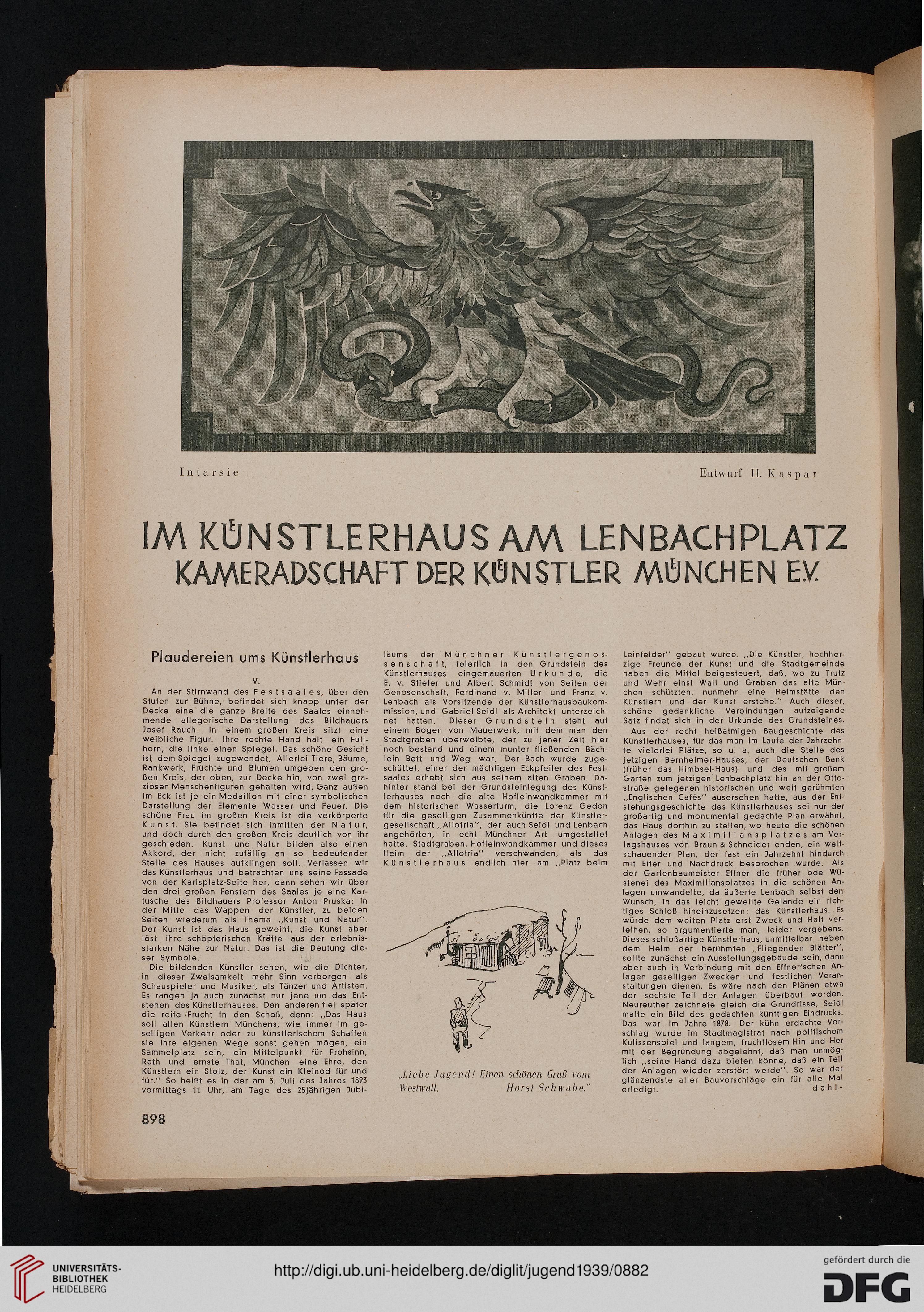Intarsie Entwurf H. Kaspar
IM KÜNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ
KAMERADSCHAFT DER KÜNSTLER MÜNCHEN EV
Plaudereien ums Künstlerhaus
V.
An der Stirnwand des Festsaales, über den
Stufen zur Bühne, befindet sich knapp unter der
Decke eine die ganze Breite des Saales einneh-
mende allegorische Darstellung des Bildhauers
Josef Rauch: In einem großen Kreis sitzt eine
weibliche Figur. Ihre rechte Hand hält ein Füll-
horn, die linke einen Spiegel. Das schöne Gesicht
ist dem Spiegel zugewendet. Allerlei Tiere, Bäume,
Rankwerk, Früchte und Blumen umgeben den gro-
ßen Kreis, der oben, zur Decke hin, von zwei gra-
ziösen Menschenfiguren gehalten wird. Ganz außen
im Eck ist je ein Medaillon mit einer symbolischen
Darstellung der Elemente Wasser und Feuer. Die
schöne Frau im großen Kreis ist die verkörperte
Kunst. Sie befindet sich inmitten der Natur,
und doch durch den großen Kreis deutlich von ihr
geschieden. Kunst und Natur bilden also einen
Akkord, der nicht zufällig an so bedeutender
Stelle des Hauses aufklingen soll. Verlassen wir
das Künstlerhaus und betrachten uns seine Fassade
von der Karlsplatz-Seite her, dann sehen wir über
den drei großen Fenstern des Saales je eine Kar-
tusche des Bildhauers Professor Anton Pruska: in
der Mitte das Wappen der Künstler, zu beiden
Seiten wiederum als Thema ,,Kunst und Natur".
Der Kunst ist das Haus geweiht, die Kunst aber
löst ihre schöpferischen Kräfte aus der erlebnis-
starken Nähe zur Natur. Das ist die Deutung die-
ser Symbole.
Die bildenden Künstler sehen, wie die Dichter,
in dieser Zweisamkeit mehr Sinn verborgen als
Schauspieler und Musiker, als Tänzer und Artisten.
Es rangen ja auch zunächst nur jene um das Ent-
stehen des Künstlerhauses. Den anderen fiel später
die reife Frucht in den Schoß, denn: ,,Das Haus
soll allen Künstlern Münchens, wie immer im ge-
selligen Verkehr oder zu künstlerischem Schaffen
sie ihre eigenen Wege sonst gehen mögen, ein
Sammelplatz sein, ein Mittelpunkt für Frohsinn,
Rath und ernste That, München eine Ehre, den
Künstlern ein Stolz, der Kunst ein Kleinod für und
für." So heißt es in der am 3. Juli des Jahres 1893
vormittags 11 Uhr, am Tage des 25jährigen Jubi-
läums der Münchner Künstlergenos-
senschaft, feierlich in den Grundstein des
Künstlerhauses eingemauerten Urkunde, die
E. v. Stieler und Albert Schmidt von Seiten der
Genosenschaft, Ferdinand v. Miller und Franz v.
Lenbach als Vorsitzende der Künstlerhausbaukom-
mission, und Gabriel Seidl als Architekt unterzeich-
net hatten. Dieser Grundstein steht auf
einem Bogen von Mauerwerk, mit dem man den
Stadtgraben überwölbte, der zu jener Zeit hier
noch bestand und einem munter fließenden Bäch-
lein Bett und Weg war. Der Bach wurde zuge-
schüttet, einer der mächtigen Eckpfeiler des Fest-
saales erhebt sich aus seinem alten Graben. Da-
hinter stand bei der Grundsteinlegung des Künst-
lerhauses noch die alte Hofleinwandkammer mit
dem historischen Wasserturm, die Lorenz Gedon
für die geselligen Zusammenkünfte der Künstler-
gesellschaft ,,Allotria", der auch Seidl und Lenbach
angehörten, in echt Münchner Art umgestaltet
hatte. Stadtgraben, Hofleinwandkammer und dieses
Heim der „Allotria" verschwanden, als das
Künstlerhaus endlich hier am „Platz beim
„Liebe Jugend! Einen schönen Gruß vom
Westwall. Horst Schwabe."
Leinfelder" gebaut wurde. „Die Künstler, hochher-
zige Freunde der Kunst und die Stadtgemeinde
haben die Mittel beigesteuert, daß, wo zu Trutz
und Wehr einst Wall und Graben das alte Mün-
chen schützten, nunmehr eine Heimstätte den
Künstlern und der Kunst erstehe." Auch dieser,
schöne gedankliche Verbindungen aufzeigende
Satz findet sich in der Urkunde des Grundsteines.
Aus der recht heißatmigen Baugeschichte des
Künstlerhauses, für das man im Laufe der Jahrzehn-
te vielerlei Plätze, so u. a. auch die Stelle des
jetzigen Bernheimer-Hauses, der Deutschen Bank
(früher das Himbsel-Haus) und des mit großem
Garten zum jetzigen Lenbachplatz hin an der Otto-
straße gelegenen historischen und weit gerühmten
„Englischen Cafes" ausersehen hatte, aus der Ent-
stehungsgeschichte des Künstlerhauses sei nur der
großartig und monumental gedachte Plan erwähnt,
das Haus dorthin zu stellen, wo heute die schönen
Anlagen des Maximiliansplatzes am Ver-
lagshauses von Braun & Schneider enden, ein weit-
schauender Plan, der fast ein Jahrzehnt hindurch
mit Eifer und Nachdruck besprochen wurde. Als
der Gartenbaumeister Effner die früher öde Wü-
stenei des Maximiliansplatzes in die schönen An-
lagen umwandelte, da äußerte Lenbach selbst den
Wunsch, in das leicht gewellte Gelände ein rich-
tiges Schloß hineinzusetzen: das Künstlerhaus. Es
würde dem weiten Platz erst Zweck und Halt ver-
leihen, so argumentierte man, leider vergebens.
Dieses schloßartige Künstlerhaus, unmittelbar neben
dem Heim der berühmten „Fliegenden Blätter",
sollte zunächst ein Ausstellungsgebäude sein, dann
aber auch in Verbindung mit den Effner'schen An-
lagen geselligen Zwecken und festlichen Veran-
staltungen dienen. Es wäre nach den Plänen etwa
der sechste Teil der Anlagen überbaut worden.
Neureuther zeichnete gleich die Grundrisse, Seidl
malte ein Bild des gedachten künftigen Eindrucks.
Das war im Jahre 1878. Der kühn erdachte Vor-
schlag wurde im Stadtmagistrat nach politischem
Kulissenspiel und langem, fruchtlosem Hin und Her
mit der Begründung abgelehnt, daß man unmög-
lich „seine Hand dazu bieten könne, daß ein Teil
der Anlagen wieder zerstört werde". So war der
glänzendste aller Bauvorschläge ein für alle Mal
erledigt. d a h I -
898
IM KÜNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ
KAMERADSCHAFT DER KÜNSTLER MÜNCHEN EV
Plaudereien ums Künstlerhaus
V.
An der Stirnwand des Festsaales, über den
Stufen zur Bühne, befindet sich knapp unter der
Decke eine die ganze Breite des Saales einneh-
mende allegorische Darstellung des Bildhauers
Josef Rauch: In einem großen Kreis sitzt eine
weibliche Figur. Ihre rechte Hand hält ein Füll-
horn, die linke einen Spiegel. Das schöne Gesicht
ist dem Spiegel zugewendet. Allerlei Tiere, Bäume,
Rankwerk, Früchte und Blumen umgeben den gro-
ßen Kreis, der oben, zur Decke hin, von zwei gra-
ziösen Menschenfiguren gehalten wird. Ganz außen
im Eck ist je ein Medaillon mit einer symbolischen
Darstellung der Elemente Wasser und Feuer. Die
schöne Frau im großen Kreis ist die verkörperte
Kunst. Sie befindet sich inmitten der Natur,
und doch durch den großen Kreis deutlich von ihr
geschieden. Kunst und Natur bilden also einen
Akkord, der nicht zufällig an so bedeutender
Stelle des Hauses aufklingen soll. Verlassen wir
das Künstlerhaus und betrachten uns seine Fassade
von der Karlsplatz-Seite her, dann sehen wir über
den drei großen Fenstern des Saales je eine Kar-
tusche des Bildhauers Professor Anton Pruska: in
der Mitte das Wappen der Künstler, zu beiden
Seiten wiederum als Thema ,,Kunst und Natur".
Der Kunst ist das Haus geweiht, die Kunst aber
löst ihre schöpferischen Kräfte aus der erlebnis-
starken Nähe zur Natur. Das ist die Deutung die-
ser Symbole.
Die bildenden Künstler sehen, wie die Dichter,
in dieser Zweisamkeit mehr Sinn verborgen als
Schauspieler und Musiker, als Tänzer und Artisten.
Es rangen ja auch zunächst nur jene um das Ent-
stehen des Künstlerhauses. Den anderen fiel später
die reife Frucht in den Schoß, denn: ,,Das Haus
soll allen Künstlern Münchens, wie immer im ge-
selligen Verkehr oder zu künstlerischem Schaffen
sie ihre eigenen Wege sonst gehen mögen, ein
Sammelplatz sein, ein Mittelpunkt für Frohsinn,
Rath und ernste That, München eine Ehre, den
Künstlern ein Stolz, der Kunst ein Kleinod für und
für." So heißt es in der am 3. Juli des Jahres 1893
vormittags 11 Uhr, am Tage des 25jährigen Jubi-
läums der Münchner Künstlergenos-
senschaft, feierlich in den Grundstein des
Künstlerhauses eingemauerten Urkunde, die
E. v. Stieler und Albert Schmidt von Seiten der
Genosenschaft, Ferdinand v. Miller und Franz v.
Lenbach als Vorsitzende der Künstlerhausbaukom-
mission, und Gabriel Seidl als Architekt unterzeich-
net hatten. Dieser Grundstein steht auf
einem Bogen von Mauerwerk, mit dem man den
Stadtgraben überwölbte, der zu jener Zeit hier
noch bestand und einem munter fließenden Bäch-
lein Bett und Weg war. Der Bach wurde zuge-
schüttet, einer der mächtigen Eckpfeiler des Fest-
saales erhebt sich aus seinem alten Graben. Da-
hinter stand bei der Grundsteinlegung des Künst-
lerhauses noch die alte Hofleinwandkammer mit
dem historischen Wasserturm, die Lorenz Gedon
für die geselligen Zusammenkünfte der Künstler-
gesellschaft ,,Allotria", der auch Seidl und Lenbach
angehörten, in echt Münchner Art umgestaltet
hatte. Stadtgraben, Hofleinwandkammer und dieses
Heim der „Allotria" verschwanden, als das
Künstlerhaus endlich hier am „Platz beim
„Liebe Jugend! Einen schönen Gruß vom
Westwall. Horst Schwabe."
Leinfelder" gebaut wurde. „Die Künstler, hochher-
zige Freunde der Kunst und die Stadtgemeinde
haben die Mittel beigesteuert, daß, wo zu Trutz
und Wehr einst Wall und Graben das alte Mün-
chen schützten, nunmehr eine Heimstätte den
Künstlern und der Kunst erstehe." Auch dieser,
schöne gedankliche Verbindungen aufzeigende
Satz findet sich in der Urkunde des Grundsteines.
Aus der recht heißatmigen Baugeschichte des
Künstlerhauses, für das man im Laufe der Jahrzehn-
te vielerlei Plätze, so u. a. auch die Stelle des
jetzigen Bernheimer-Hauses, der Deutschen Bank
(früher das Himbsel-Haus) und des mit großem
Garten zum jetzigen Lenbachplatz hin an der Otto-
straße gelegenen historischen und weit gerühmten
„Englischen Cafes" ausersehen hatte, aus der Ent-
stehungsgeschichte des Künstlerhauses sei nur der
großartig und monumental gedachte Plan erwähnt,
das Haus dorthin zu stellen, wo heute die schönen
Anlagen des Maximiliansplatzes am Ver-
lagshauses von Braun & Schneider enden, ein weit-
schauender Plan, der fast ein Jahrzehnt hindurch
mit Eifer und Nachdruck besprochen wurde. Als
der Gartenbaumeister Effner die früher öde Wü-
stenei des Maximiliansplatzes in die schönen An-
lagen umwandelte, da äußerte Lenbach selbst den
Wunsch, in das leicht gewellte Gelände ein rich-
tiges Schloß hineinzusetzen: das Künstlerhaus. Es
würde dem weiten Platz erst Zweck und Halt ver-
leihen, so argumentierte man, leider vergebens.
Dieses schloßartige Künstlerhaus, unmittelbar neben
dem Heim der berühmten „Fliegenden Blätter",
sollte zunächst ein Ausstellungsgebäude sein, dann
aber auch in Verbindung mit den Effner'schen An-
lagen geselligen Zwecken und festlichen Veran-
staltungen dienen. Es wäre nach den Plänen etwa
der sechste Teil der Anlagen überbaut worden.
Neureuther zeichnete gleich die Grundrisse, Seidl
malte ein Bild des gedachten künftigen Eindrucks.
Das war im Jahre 1878. Der kühn erdachte Vor-
schlag wurde im Stadtmagistrat nach politischem
Kulissenspiel und langem, fruchtlosem Hin und Her
mit der Begründung abgelehnt, daß man unmög-
lich „seine Hand dazu bieten könne, daß ein Teil
der Anlagen wieder zerstört werde". So war der
glänzendste aller Bauvorschläge ein für alle Mal
erledigt. d a h I -
898