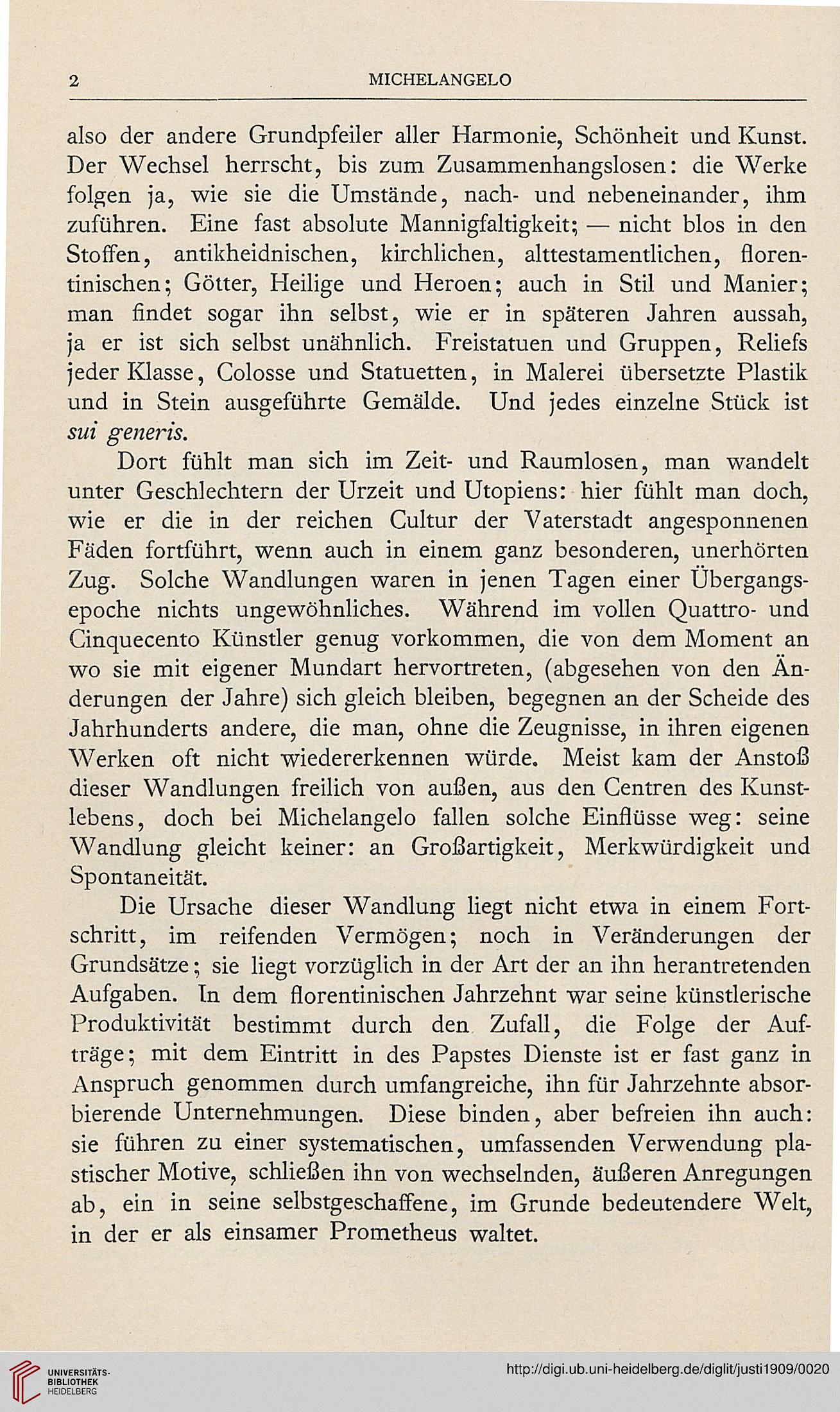2
MICHELANGELO
also der andere Grundpfeiler aller Harmonie, Schönheit und Kunst.
Der Wechsel herrscht, bis zum Zusammenhangslosen: die Werke
folgen ja, wie sie die Umstände, nach- und nebeneinander, ihm
zuführen. Eine fast absolute Mannigfaltigkeit; — nicht blos in den
Stoffen, antikheidnischen, kirchlichen, alttestamentlichen, floren-
tinischen; Götter, Heilige und Heroen; auch in Stil und Manier;
man rindet sogar ihn selbst, wie er in späteren Jahren aussah,
ja er ist sich selbst unähnlich. Freistatuen und Gruppen, Reliefs
jeder Klasse, Colosse und Statuetten, in Malerei übersetzte Plastik
und in Stein ausgeführte Gemälde. Und jedes einzelne Stück ist
sui generis.
Dort fühlt man sich im Zeit- und Raumlosen, man wandelt
unter Geschlechtern der Urzeit und Utopiens: hier fühlt man doch,
wie er die in der reichen Cultur der Vaterstadt angesponnenen
Fäden fortführt, wenn auch in einem ganz besonderen, unerhörten
Zug. Solche Wandlungen waren in jenen Tagen einer Übergangs-
epoche nichts ungewöhnliches. Während im vollen Quattro- und
Cinquecento Künstler genug vorkommen, die von dem Moment an
wo sie mit eigener Mundart hervortreten, (abgesehen von den Än-
derungen der Jahre) sich gleich bleiben, begegnen an der Scheide des
Jahrhunderts andere, die man, ohne die Zeugnisse, in ihren eigenen
Werken oft nicht wiedererkennen würde. Meist kam der Anstoß
dieser Wandlungen freilich von außen, aus den Centren des Kunst-
lebens, doch bei Michelangelo fallen solche Einflüsse weg: seine
Wandlung gleicht keiner: an Großartigkeit, Merkwürdigkeit und
Spontaneität.
Die Ursache dieser Wandlung liegt nicht etwa in einem Fort-
schritt, im reifenden Vermögen; noch in Veränderungen der
Grundsätze; sie liegt vorzüglich in der Art der an ihn herantretenden
Aufgaben. In dem florentinischen Jahrzehnt war seine künstlerische
Produktivität bestimmt durch den Zufall, die Folge der Auf-
träge; mit dem Eintritt in des Papstes Dienste ist er fast ganz in
Anspruch genommen durch umfangreiche, ihn für Jahrzehnte absor-
bierende Unternehmungen. Diese binden, aber befreien ihn auch:
sie führen zu einer systematischen, umfassenden Verwendung pla-
stischer Motive, schließen ihn von wechselnden, äußeren Anregungen
ab, ein in seine selbstgeschaffene, im Grunde bedeutendere Welt,
in der er als einsamer Prometheus waltet.
MICHELANGELO
also der andere Grundpfeiler aller Harmonie, Schönheit und Kunst.
Der Wechsel herrscht, bis zum Zusammenhangslosen: die Werke
folgen ja, wie sie die Umstände, nach- und nebeneinander, ihm
zuführen. Eine fast absolute Mannigfaltigkeit; — nicht blos in den
Stoffen, antikheidnischen, kirchlichen, alttestamentlichen, floren-
tinischen; Götter, Heilige und Heroen; auch in Stil und Manier;
man rindet sogar ihn selbst, wie er in späteren Jahren aussah,
ja er ist sich selbst unähnlich. Freistatuen und Gruppen, Reliefs
jeder Klasse, Colosse und Statuetten, in Malerei übersetzte Plastik
und in Stein ausgeführte Gemälde. Und jedes einzelne Stück ist
sui generis.
Dort fühlt man sich im Zeit- und Raumlosen, man wandelt
unter Geschlechtern der Urzeit und Utopiens: hier fühlt man doch,
wie er die in der reichen Cultur der Vaterstadt angesponnenen
Fäden fortführt, wenn auch in einem ganz besonderen, unerhörten
Zug. Solche Wandlungen waren in jenen Tagen einer Übergangs-
epoche nichts ungewöhnliches. Während im vollen Quattro- und
Cinquecento Künstler genug vorkommen, die von dem Moment an
wo sie mit eigener Mundart hervortreten, (abgesehen von den Än-
derungen der Jahre) sich gleich bleiben, begegnen an der Scheide des
Jahrhunderts andere, die man, ohne die Zeugnisse, in ihren eigenen
Werken oft nicht wiedererkennen würde. Meist kam der Anstoß
dieser Wandlungen freilich von außen, aus den Centren des Kunst-
lebens, doch bei Michelangelo fallen solche Einflüsse weg: seine
Wandlung gleicht keiner: an Großartigkeit, Merkwürdigkeit und
Spontaneität.
Die Ursache dieser Wandlung liegt nicht etwa in einem Fort-
schritt, im reifenden Vermögen; noch in Veränderungen der
Grundsätze; sie liegt vorzüglich in der Art der an ihn herantretenden
Aufgaben. In dem florentinischen Jahrzehnt war seine künstlerische
Produktivität bestimmt durch den Zufall, die Folge der Auf-
träge; mit dem Eintritt in des Papstes Dienste ist er fast ganz in
Anspruch genommen durch umfangreiche, ihn für Jahrzehnte absor-
bierende Unternehmungen. Diese binden, aber befreien ihn auch:
sie führen zu einer systematischen, umfassenden Verwendung pla-
stischer Motive, schließen ihn von wechselnden, äußeren Anregungen
ab, ein in seine selbstgeschaffene, im Grunde bedeutendere Welt,
in der er als einsamer Prometheus waltet.