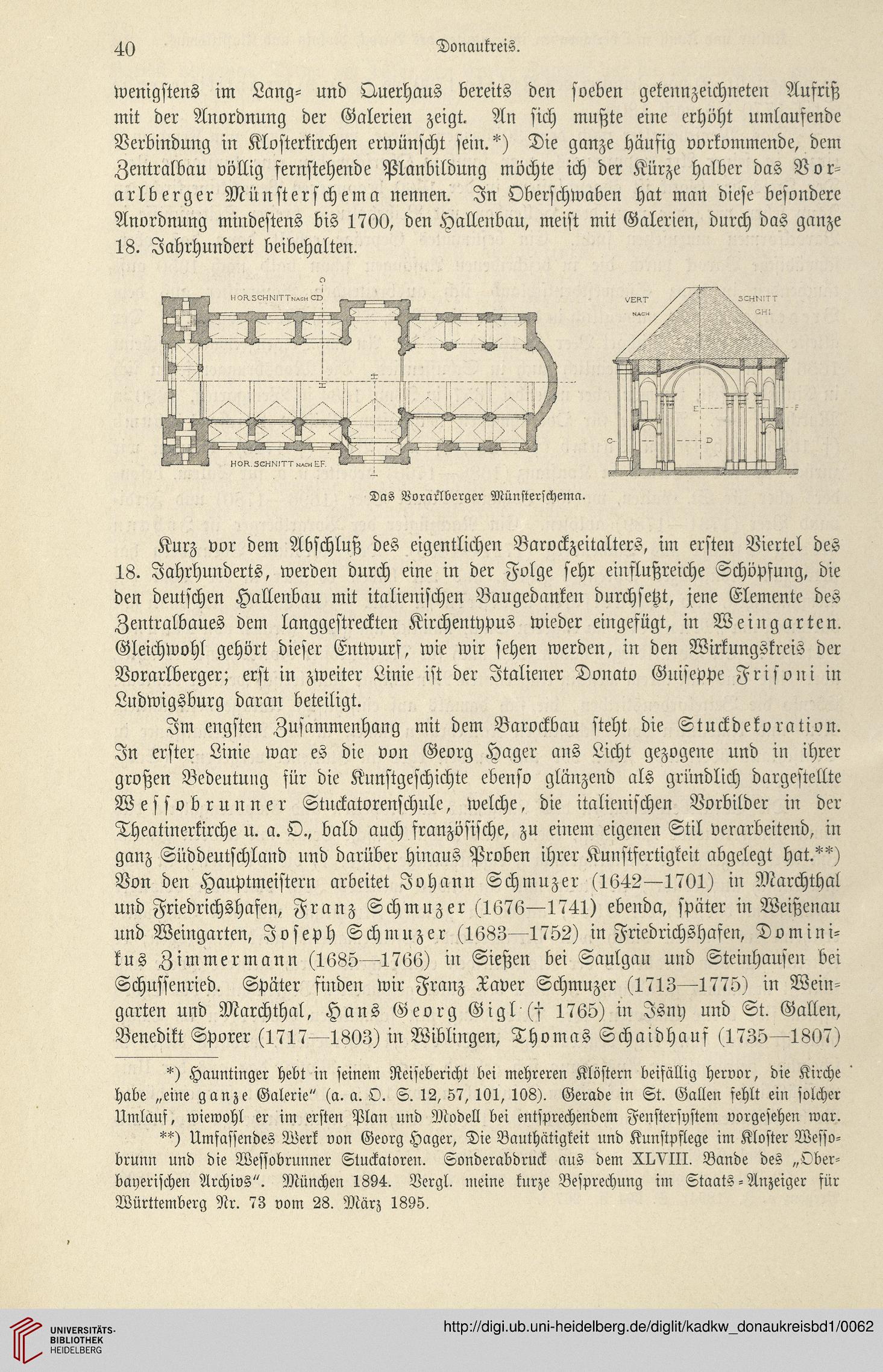40 Donautreis.
wenigstens im Lang- und Querhaus bereits den ſoeben getennzeichneten Aufriß
mit der Anordnung der Galerien zeigt. An sich mußte eine erhöht umlaufende
Verbindung in Kloſsterkirchen erwünſcht sein. *) Die ganze häufig vorkommende, dem
Zentralbau völlig fernſtehende Planbildung möchte ich der Kürze halber das Vor-
arlberger Münſsterſ ch ema nennen. In Oberschwaben hat man diese beſondere
Anordnung mindestens bis 1700, den Hallenbau, meiſt mit Galerien, durch das ganze
18. Jahrhundert beibehalten.
Das Voraklberger Münſterſchema.
Kurz vor dem Abschluß des eigentlichen Barockzeitalters, im erſten Viertel des
18. Jahrhunderts, werden durch eine in der Folge ſehr einflußreiche Schöpfung, die
den deutſchen Hallenbau mit italieniſchen Baugedanken durchsett, jene Elemente des
Zentralbaues dem langgestreckten Kirchentypus wieder eingefügt, in Weingarten.
Gleichwohl gehört dieser Entwurf, wie wir ſehen werden, in den Wirkungskreis der
Vorarlberger; erst in zweiter Linie iſt der Italiener Donato Guiſeppe Fris oni in
Ludwigsburg daran beteiligt.
Im engsten Zuſammenhang mit dem Barockbau steht die Stuckdekoration.
In erster Linie war es die von Georg Hager ans Licht gezogene und in ihrer
großen Bedeutung für die Kunſtgeſchichte ebenſo glänzend als gründlich dargestellte
Wess o brunner Stuckatorenſchule, welche, die italieniſchen Vorbilder in der
Theatinerkirche u. a. O., bald auch franzöſiſche, zu einem eigenen Stil verarbeitend, in
ganz Süddeutschland und darüber hinaus Proben ihrer Kunstfertigkeit abgelegt hat.**)
Von den Hauptmeistern arbeitet Iohann Schmuzer (164201701) in Marchthal
und Friedrichshafen, Franz Schmuz er (1676-1741) ebenda, später in Weißenau
und Weingarten, Joſeph Schmuzer (1683-1752) in Friedrichshafen, Do mini-
kus Zimmermann (1685-1766) in Sießen bei Saulgau und Steinhauſen bei
Schussenried. Später finden wir Franz Xaver Schmuzer (1713-1775) in Wein-
garten und Marchthal, Hans Georg Gigl (f 1765) in Isny und St. Gallen,
Benedikt Sporer (1717-1803) in Wiblingen, Thomas Schaidhauf (1735-1807)
*) Hauntinger hebt in seinem Reiſebericht bei mehreren Klöſtern beifällig hervor, die Kirche |
habe „eine g anz e Galerie“ (a. a. O. S. 12, 57, 101, 108). Gerade in St. Gallen fehlt ein jſolcher
Umlauf, wiewohl er im erſten Plan und Modell bei entſprechendem Fenſterſyſtem vorgeſehen war.
**) Umfassendes Werk von Georg Hager, Die Bauthätigkeit und Kunstpflege im Kloſter Wesſo-
brunn und die Wessobrunner Stuckatoren. Sonderabdruck aus dem XLVIUI. Bande des „Ober-
bayeriſchen Archivs“. München 1894. Vergl. meine kurze Beſprechung im Staats - Anzeiger für
Württemberg Nr. 73 vom 28. März 1895.
wenigstens im Lang- und Querhaus bereits den ſoeben getennzeichneten Aufriß
mit der Anordnung der Galerien zeigt. An sich mußte eine erhöht umlaufende
Verbindung in Kloſsterkirchen erwünſcht sein. *) Die ganze häufig vorkommende, dem
Zentralbau völlig fernſtehende Planbildung möchte ich der Kürze halber das Vor-
arlberger Münſsterſ ch ema nennen. In Oberschwaben hat man diese beſondere
Anordnung mindestens bis 1700, den Hallenbau, meiſt mit Galerien, durch das ganze
18. Jahrhundert beibehalten.
Das Voraklberger Münſterſchema.
Kurz vor dem Abschluß des eigentlichen Barockzeitalters, im erſten Viertel des
18. Jahrhunderts, werden durch eine in der Folge ſehr einflußreiche Schöpfung, die
den deutſchen Hallenbau mit italieniſchen Baugedanken durchsett, jene Elemente des
Zentralbaues dem langgestreckten Kirchentypus wieder eingefügt, in Weingarten.
Gleichwohl gehört dieser Entwurf, wie wir ſehen werden, in den Wirkungskreis der
Vorarlberger; erst in zweiter Linie iſt der Italiener Donato Guiſeppe Fris oni in
Ludwigsburg daran beteiligt.
Im engsten Zuſammenhang mit dem Barockbau steht die Stuckdekoration.
In erster Linie war es die von Georg Hager ans Licht gezogene und in ihrer
großen Bedeutung für die Kunſtgeſchichte ebenſo glänzend als gründlich dargestellte
Wess o brunner Stuckatorenſchule, welche, die italieniſchen Vorbilder in der
Theatinerkirche u. a. O., bald auch franzöſiſche, zu einem eigenen Stil verarbeitend, in
ganz Süddeutschland und darüber hinaus Proben ihrer Kunstfertigkeit abgelegt hat.**)
Von den Hauptmeistern arbeitet Iohann Schmuzer (164201701) in Marchthal
und Friedrichshafen, Franz Schmuz er (1676-1741) ebenda, später in Weißenau
und Weingarten, Joſeph Schmuzer (1683-1752) in Friedrichshafen, Do mini-
kus Zimmermann (1685-1766) in Sießen bei Saulgau und Steinhauſen bei
Schussenried. Später finden wir Franz Xaver Schmuzer (1713-1775) in Wein-
garten und Marchthal, Hans Georg Gigl (f 1765) in Isny und St. Gallen,
Benedikt Sporer (1717-1803) in Wiblingen, Thomas Schaidhauf (1735-1807)
*) Hauntinger hebt in seinem Reiſebericht bei mehreren Klöſtern beifällig hervor, die Kirche |
habe „eine g anz e Galerie“ (a. a. O. S. 12, 57, 101, 108). Gerade in St. Gallen fehlt ein jſolcher
Umlauf, wiewohl er im erſten Plan und Modell bei entſprechendem Fenſterſyſtem vorgeſehen war.
**) Umfassendes Werk von Georg Hager, Die Bauthätigkeit und Kunstpflege im Kloſter Wesſo-
brunn und die Wessobrunner Stuckatoren. Sonderabdruck aus dem XLVIUI. Bande des „Ober-
bayeriſchen Archivs“. München 1894. Vergl. meine kurze Beſprechung im Staats - Anzeiger für
Württemberg Nr. 73 vom 28. März 1895.