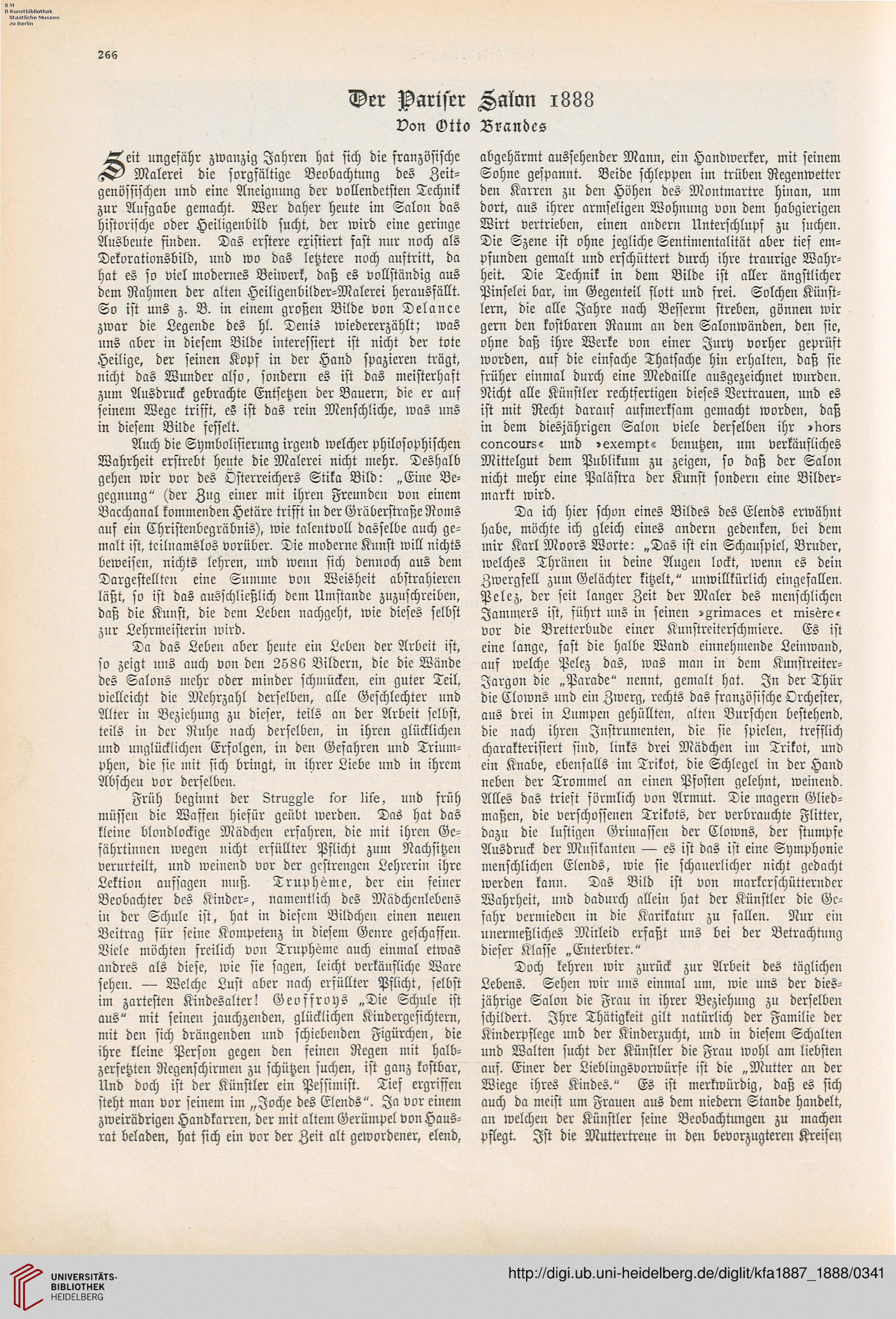2K6
Der Vilser
von Gtto
^eit ungefähr zwanzig Jahren hat sich die französische
Malerei die sorgfältige Beobachtung des Zeit-
genössischen und eine Aneignung der vollendetsten Technik
zur Aufgabe gemacht. Wer daher heute im Salon das
historische oder Heiligenbild sucht, der wird eine geringe
Ausbeute finden. Das erstere existiert fast nur noch als
Dekorationsbild, und wo das letztere noch auftritt, da
hat es so viel modernes Beiwerk, daß es vollständig aus
dem Rahmen der alten Heiligenbilder-Malerei herausfällt.
So ist uns z. B. in einem großen Bilde von Delance
zwar die Legende des hl. Denis wiedererzählt; was
nns aber in diesem Bilde interessiert ist nicht der tote
Heilige, der seinen Kopf in der Hand spazieren trägt,
nicht das Wunder also, sondern es ist das meisterhaft
zum Ausdruck gebrachte Entsetzen der Bauern, die er auf
seinem Wege trifft, es ist das rein Menschliche, was uns
in diesem Bilde fesselt.
Auch die Symbolisierung irgend welcher philosophischen
Wahrheit erstrebt heute die Malerei nicht mehr. Deshalb
gehen wir vor des Österreichers Stika Bild: „Eine Be-
gegnung" (der Zug einer mit ihren Freunden von einem
Bacchanal kommenden Hetäre trifft in der Gräberstraße Roms
auf ein Christenbcgräbnis), wie talentvoll dasselbe auch ge-
malt ist, tcilnamslos vorüber. Die moderne Kunst will nichts
beweisen, nichts lehren, und wenn sich dennoch aus dem
Dargestellten eine Summe von Weisheit abstrahieren
läßt, so ist das ausschließlich dem Umstande zuzuschreiben,
daß die Kunst, die dem Leben nachgeht, wie dieses selbst
zur Lehrmeisterin wird.
Da das Leben aber heute ein Leben der Arbeit ist,
so zeigt uns auch von den 2586 Bildern, die die Wände
des Salons mehr oder minder schmücken, ein guter Teil,
vielleicht die Mehrzahl derselben, alle Geschlechter und
Alter in Beziehung zu dieser, teils an der Arbeit selbst,
teils in der Ruhe nach derselben, in ihren glücklichen
und unglücklichen Erfolgen, in den Gefahren und Trium-
phen, die sie mit sich bringt, in ihrer Liebe und in ihrem
Abscheu vor derselben.
Früh beginnt der Ltruggle tor Ute, und früh
müssen die Waffen hiefür geübt werden. Das hat das
kleine blondlockige Mädchen erfahren, die mit ihren Ge-
fährtinnen wegen nicht erfüllter Pflicht zum Nachsitzen
verurteilt, und weinend vor der gestrengen Lehrerin ihre
Lektion aufsagen muß. Trupheme, der ein feiner
Beobachter des Kinder-, namentlich des Mädchcnlebens
in der Schule ist, hat in diesem Bildchen einen neuen
Beitrag für seine Kompetenz in diesem Genre geschaffen.
Viele möchten freilich von Trupheme auch einmal etwas
andres als diese, wie sie sagen, leicht verkäufliche Ware
sehen. — Welche Lust aber nach erfüllter Pflicht, selbst
im zartesten Kindesalter! Geoffroys „Die Schule ist
aus" mit seinen jauchzenden, glücklichen Kiudergesichtern,
mit den sich drängenden und schiebenden Figürchen, die
ihre kleine Person gegen den feinen Regen mit halb-
zerfetzten Regenschirmen zu schützen suchen, ist ganz kostbar,
Und doch ist der Künstler ein Pessimist. Tief ergriffen
steht man vor seinem im „Joche des Elends". Ja vor einem
zweirädrigen Handkarren, der mit altem Gerümpel von Haus-
rat beladen, hat sich ein vor der Zeit alt gewordener, elend,
Salon 1888
Brandes
abgehärmt aussehender Mann, ein Handwerker, mit seinem
Sohne gespannt. Beide schleppen im trüben Regenwetter
den Karren zu den Höhen des Montmartre hinan, um
dort, aus ihrer armseligen Wohnung von dem habgierigen
Wirt vertrieben, einen andern Unterschlupf zu suchen.
Die Szene ist ohne jegliche Sentimentalität aber tief em-
pfunden gemalt und erschüttert durch ihre traurige Wahr-
heit. Die Technik in dem Bilde ist aller ängstlicher
Pinselei bar, im Gegenteil flott und frei. Solchen Künst-
lern, die alle Jahre nach Besserm streben, gönnen wir
gern den kostbaren Raum an den Salonwänden, den sie,
ohne daß ihre Werke von einer Jury vorher geprüft
worden, auf die einfache Thatsache hin erhalten, daß sie
früher einmal durch eine Medaille ausgezeichnet wurden.
Nicht alle Künstler rechtfertigen dieses Vertrauen, und es
ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß
in dem diesjährigen Salon viele derselben ihr »Kars
concours« und »exempt« benutzen, um verkäufliches
Mittelgut dem Publikum zu zeigen, so daß der Salon
nicht mehr eine Palästra der Kunst sondern eine Bilder-
markt wird.
Da ich hier schon eines Bildes des Elends erwähnt
habe, möchte ich gleich eines andern gedenken, bei dem
mir Karl Moors Worte: „Das ist ein Schauspiel, Bruder,
welches Thränen iu deine Augen lockt, wenn cs dein
Zwergfell zum Gelächter kitzelt," unwillkürlich eingefallen.
Pelez, der seit langer Zeit der Maler des menschlichen
Jammers ist, führt uns in seinen »grimaces et unsere«
vor die Bretterbude einer Kunstreiterschmiere. Es ist
eine lange, fast die halbe Wand einnehmende Leinwand,
auf welche Pelez das, was mau in dem Kunstreiter-
Jargon die „Parade" nennt, gemalt hat. In der Thür
die Clowns und ein Zwerg, rechts das französische Orchester,
aus drei in Lumpen gehüllten, alten Burschen bestehend,
die nach ihren Instrumenten, die sie spielen, trefflich
charakterisiert sind, links drei Mädchen im Trikot, und
ein Knabe, ebenfalls im Trikot, die Schlegel in der Hand
neben der Trommel an einen Pfosten gelehnt, weinend.
Alles das trieft förmlich von Armut. Die magern Glied-
maßen, die verschossenen Trikots, der verbrauchte Flitter,
dazu die lustigen Grimassen der Clowns, der stumpfe
Ausdruck der Musikanten — es ist das ist eine Symphonie
menschlichen Elends, wie sie schauerlicher nicht gedacht
werden kann. Das Bild ist von markerschütternder
Wahrheit, und dadurch allein hat der Künstler die Ge-
fahr vermieden in die Karikatur zu fallen. Nur ein
unermeßliches Milleid erfaßt uns bei der Betrachtung
dieser Klasse „Enterbter."
Doch kehren wir zurück zur Arbeit des täglichen
Lebens. Sehen wir uns einmal um, wie uns der dies-
jährige Salon die Frau in ihrer Beziehung zu derselben
schildert. Ihre Thätigkeit gilt natürlich der Familie der
Kinderpflege und der Kinderzucht, und in diesem Schalten
und Walten sucht der Künstler die Frau wohl am liebsten
auf. Einer der Lieblingsvorwürfe ist die „Mutter an der
Wiege ihres Kindes." Es ist merkwürdig, daß es sich
auch da meist um Frauen aus dem niedern Stande handelt,
an welchen der Künstler seine Beobachtungen zu machen
pflegt. Ist die Muttertreue in den bevorzugteren Kreisen
Der Vilser
von Gtto
^eit ungefähr zwanzig Jahren hat sich die französische
Malerei die sorgfältige Beobachtung des Zeit-
genössischen und eine Aneignung der vollendetsten Technik
zur Aufgabe gemacht. Wer daher heute im Salon das
historische oder Heiligenbild sucht, der wird eine geringe
Ausbeute finden. Das erstere existiert fast nur noch als
Dekorationsbild, und wo das letztere noch auftritt, da
hat es so viel modernes Beiwerk, daß es vollständig aus
dem Rahmen der alten Heiligenbilder-Malerei herausfällt.
So ist uns z. B. in einem großen Bilde von Delance
zwar die Legende des hl. Denis wiedererzählt; was
nns aber in diesem Bilde interessiert ist nicht der tote
Heilige, der seinen Kopf in der Hand spazieren trägt,
nicht das Wunder also, sondern es ist das meisterhaft
zum Ausdruck gebrachte Entsetzen der Bauern, die er auf
seinem Wege trifft, es ist das rein Menschliche, was uns
in diesem Bilde fesselt.
Auch die Symbolisierung irgend welcher philosophischen
Wahrheit erstrebt heute die Malerei nicht mehr. Deshalb
gehen wir vor des Österreichers Stika Bild: „Eine Be-
gegnung" (der Zug einer mit ihren Freunden von einem
Bacchanal kommenden Hetäre trifft in der Gräberstraße Roms
auf ein Christenbcgräbnis), wie talentvoll dasselbe auch ge-
malt ist, tcilnamslos vorüber. Die moderne Kunst will nichts
beweisen, nichts lehren, und wenn sich dennoch aus dem
Dargestellten eine Summe von Weisheit abstrahieren
läßt, so ist das ausschließlich dem Umstande zuzuschreiben,
daß die Kunst, die dem Leben nachgeht, wie dieses selbst
zur Lehrmeisterin wird.
Da das Leben aber heute ein Leben der Arbeit ist,
so zeigt uns auch von den 2586 Bildern, die die Wände
des Salons mehr oder minder schmücken, ein guter Teil,
vielleicht die Mehrzahl derselben, alle Geschlechter und
Alter in Beziehung zu dieser, teils an der Arbeit selbst,
teils in der Ruhe nach derselben, in ihren glücklichen
und unglücklichen Erfolgen, in den Gefahren und Trium-
phen, die sie mit sich bringt, in ihrer Liebe und in ihrem
Abscheu vor derselben.
Früh beginnt der Ltruggle tor Ute, und früh
müssen die Waffen hiefür geübt werden. Das hat das
kleine blondlockige Mädchen erfahren, die mit ihren Ge-
fährtinnen wegen nicht erfüllter Pflicht zum Nachsitzen
verurteilt, und weinend vor der gestrengen Lehrerin ihre
Lektion aufsagen muß. Trupheme, der ein feiner
Beobachter des Kinder-, namentlich des Mädchcnlebens
in der Schule ist, hat in diesem Bildchen einen neuen
Beitrag für seine Kompetenz in diesem Genre geschaffen.
Viele möchten freilich von Trupheme auch einmal etwas
andres als diese, wie sie sagen, leicht verkäufliche Ware
sehen. — Welche Lust aber nach erfüllter Pflicht, selbst
im zartesten Kindesalter! Geoffroys „Die Schule ist
aus" mit seinen jauchzenden, glücklichen Kiudergesichtern,
mit den sich drängenden und schiebenden Figürchen, die
ihre kleine Person gegen den feinen Regen mit halb-
zerfetzten Regenschirmen zu schützen suchen, ist ganz kostbar,
Und doch ist der Künstler ein Pessimist. Tief ergriffen
steht man vor seinem im „Joche des Elends". Ja vor einem
zweirädrigen Handkarren, der mit altem Gerümpel von Haus-
rat beladen, hat sich ein vor der Zeit alt gewordener, elend,
Salon 1888
Brandes
abgehärmt aussehender Mann, ein Handwerker, mit seinem
Sohne gespannt. Beide schleppen im trüben Regenwetter
den Karren zu den Höhen des Montmartre hinan, um
dort, aus ihrer armseligen Wohnung von dem habgierigen
Wirt vertrieben, einen andern Unterschlupf zu suchen.
Die Szene ist ohne jegliche Sentimentalität aber tief em-
pfunden gemalt und erschüttert durch ihre traurige Wahr-
heit. Die Technik in dem Bilde ist aller ängstlicher
Pinselei bar, im Gegenteil flott und frei. Solchen Künst-
lern, die alle Jahre nach Besserm streben, gönnen wir
gern den kostbaren Raum an den Salonwänden, den sie,
ohne daß ihre Werke von einer Jury vorher geprüft
worden, auf die einfache Thatsache hin erhalten, daß sie
früher einmal durch eine Medaille ausgezeichnet wurden.
Nicht alle Künstler rechtfertigen dieses Vertrauen, und es
ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß
in dem diesjährigen Salon viele derselben ihr »Kars
concours« und »exempt« benutzen, um verkäufliches
Mittelgut dem Publikum zu zeigen, so daß der Salon
nicht mehr eine Palästra der Kunst sondern eine Bilder-
markt wird.
Da ich hier schon eines Bildes des Elends erwähnt
habe, möchte ich gleich eines andern gedenken, bei dem
mir Karl Moors Worte: „Das ist ein Schauspiel, Bruder,
welches Thränen iu deine Augen lockt, wenn cs dein
Zwergfell zum Gelächter kitzelt," unwillkürlich eingefallen.
Pelez, der seit langer Zeit der Maler des menschlichen
Jammers ist, führt uns in seinen »grimaces et unsere«
vor die Bretterbude einer Kunstreiterschmiere. Es ist
eine lange, fast die halbe Wand einnehmende Leinwand,
auf welche Pelez das, was mau in dem Kunstreiter-
Jargon die „Parade" nennt, gemalt hat. In der Thür
die Clowns und ein Zwerg, rechts das französische Orchester,
aus drei in Lumpen gehüllten, alten Burschen bestehend,
die nach ihren Instrumenten, die sie spielen, trefflich
charakterisiert sind, links drei Mädchen im Trikot, und
ein Knabe, ebenfalls im Trikot, die Schlegel in der Hand
neben der Trommel an einen Pfosten gelehnt, weinend.
Alles das trieft förmlich von Armut. Die magern Glied-
maßen, die verschossenen Trikots, der verbrauchte Flitter,
dazu die lustigen Grimassen der Clowns, der stumpfe
Ausdruck der Musikanten — es ist das ist eine Symphonie
menschlichen Elends, wie sie schauerlicher nicht gedacht
werden kann. Das Bild ist von markerschütternder
Wahrheit, und dadurch allein hat der Künstler die Ge-
fahr vermieden in die Karikatur zu fallen. Nur ein
unermeßliches Milleid erfaßt uns bei der Betrachtung
dieser Klasse „Enterbter."
Doch kehren wir zurück zur Arbeit des täglichen
Lebens. Sehen wir uns einmal um, wie uns der dies-
jährige Salon die Frau in ihrer Beziehung zu derselben
schildert. Ihre Thätigkeit gilt natürlich der Familie der
Kinderpflege und der Kinderzucht, und in diesem Schalten
und Walten sucht der Künstler die Frau wohl am liebsten
auf. Einer der Lieblingsvorwürfe ist die „Mutter an der
Wiege ihres Kindes." Es ist merkwürdig, daß es sich
auch da meist um Frauen aus dem niedern Stande handelt,
an welchen der Künstler seine Beobachtungen zu machen
pflegt. Ist die Muttertreue in den bevorzugteren Kreisen