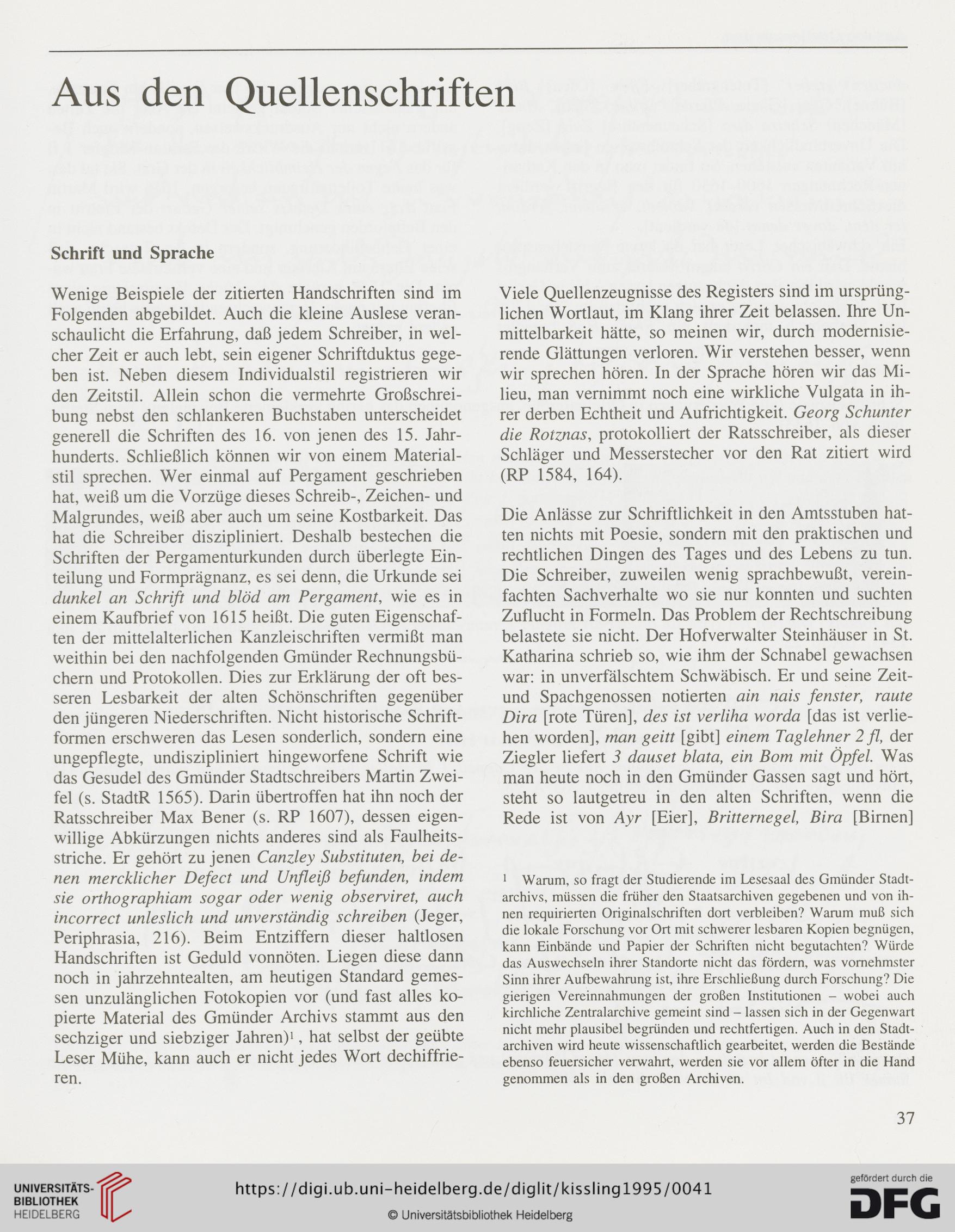Aus den Quellenschriften
Schrift und Sprache
Wenige Beispiele der zitierten Handschriften sind im
Folgenden abgebildet. Auch die kleine Auslese veran-
schaulicht die Erfahrung, daß jedem Schreiber, in wel-
cher Zeit er auch lebt, sein eigener Schriftduktus gege-
ben ist. Neben diesem Individualstil registrieren wir
den Zeitstil. Allein schon die vermehrte Großschrei-
bung nebst den schlankeren Buchstaben unterscheidet
generell die Schriften des 16. von jenen des 15. Jahr-
hunderts. Schließlich können wir von einem Material-
stil sprechen. Wer einmal auf Pergament geschrieben
hat, weiß um die Vorzüge dieses Schreib-, Zeichen- und
Malgrundes, weiß aber auch um seine Kostbarkeit. Das
hat die Schreiber diszipliniert. Deshalb bestechen die
Schriften der Pergamenturkunden durch überlegte Ein-
teilung und Formprägnanz, es sei denn, die Urkunde sei
dunkel an Schrift und blöd am Pergament, wie es in
einem Kaufbrief von 1615 heißt. Die guten Eigenschaf-
ten der mittelalterlichen Kanzleischriften vermißt man
weithin bei den nachfolgenden Gmünder Rechnungsbü-
chern und Protokollen. Dies zur Erklärung der oft bes-
seren Lesbarkeit der alten Schönschriften gegenüber
den jüngeren Niederschriften. Nicht historische Schrift-
formen erschweren das Lesen sonderlich, sondern eine
ungepflegte, undiszipliniert hingeworfene Schrift wie
das Gesudel des Gmünder Stadtschreibers Martin Zwei-
fel (s. StadtR 1565). Darin übertroffen hat ihn noch der
Ratsschreiber Max Bener (s. RP 1607), dessen eigen-
willige Abkürzungen nichts anderes sind als Faulheits-
striche. Er gehört zu jenen Canzley Substituten, bei de-
nen mercklicher Defect und Unfleiß befunden, indem
sie orthographiam sogar oder wenig observiret, auch
incorrect unleslich und unverständig schreiben (Jeger,
Periphrasia, 216). Beim Entziffern dieser haltlosen
Handschriften ist Geduld vonnöten. Liegen diese dann
noch in jahrzehntealten, am heutigen Standard gemes-
sen unzulänglichen Fotokopien vor (und fast alles ko-
pierte Material des Gmünder Archivs stammt aus den
sechziger und siebziger Jahren)1, hat selbst der geübte
Leser Mühe, kann auch er nicht jedes Wort dechiffrie-
ren.
Viele Quellenzeugnisse des Registers sind im ursprüng-
lichen Wortlaut, im Klang ihrer Zeit belassen. Ihre Un-
mittelbarkeit hätte, so meinen wir, durch modernisie-
rende Glättungen verloren. Wir verstehen besser, wenn
wir sprechen hören. In der Sprache hören wir das Mi-
lieu, man vernimmt noch eine wirkliche Vulgata in ih-
rer derben Echtheit und Aufrichtigkeit. Georg Schunter
die Rotznas, protokolliert der Ratsschreiber, als dieser
Schläger und Messerstecher vor den Rat zitiert wird
(RP 1584, 164).
Die Anlässe zur Schriftlichkeit in den Amtsstuben hat-
ten nichts mit Poesie, sondern mit den praktischen und
rechtlichen Dingen des Tages und des Lebens zu tun.
Die Schreiber, zuweilen wenig sprachbewußt, verein-
fachten Sachverhalte wo sie nur konnten und suchten
Zuflucht in Formeln. Das Problem der Rechtschreibung
belastete sie nicht. Der Hofverwalter Steinhäuser in St.
Katharina schrieb so, wie ihm der Schnabel gewachsen
war: in unverfälschtem Schwäbisch. Er und seine Zeit-
und Spachgenossen notierten ain nais fenster, raute
Dira [rote Türen], des ist verliha worda [das ist verlie-
hen worden], man geitt [gibt] einem Taglehner 2 fl, der
Ziegler liefert 3 dauset blata, ein Born mit Öpfel. Was
man heute noch in den Gmünder Gassen sagt und hört,
steht so lautgetreu in den alten Schriften, wenn die
Rede ist von Ayr [Eier], Britternegel, Bira [Birnen]
1 Warum, so fragt der Studierende im Lesesaal des Gmünder Stadt-
archivs, müssen die früher den Staatsarchiven gegebenen und von ih-
nen requirierten Originalschriften dort verbleiben? Warum muß sich
die lokale Forschung vor Ort mit schwerer lesbaren Kopien begnügen,
kann Einbände und Papier der Schriften nicht begutachten? Würde
das Auswechseln ihrer Standorte nicht das fördern, was vornehmster
Sinn ihrer Aufbewahrung ist, ihre Erschließung durch Forschung? Die
gierigen Vereinnahmungen der großen Institutionen - wobei auch
kirchliche Zentralarchive gemeint sind - lassen sich in der Gegenwart
nicht mehr plausibel begründen und rechtfertigen. Auch in den Stadt-
archiven wird heute wissenschaftlich gearbeitet, werden die Bestände
ebenso feuersicher verwahrt, werden sie vor allem öfter in die Hand
genommen als in den großen Archiven.
37
Schrift und Sprache
Wenige Beispiele der zitierten Handschriften sind im
Folgenden abgebildet. Auch die kleine Auslese veran-
schaulicht die Erfahrung, daß jedem Schreiber, in wel-
cher Zeit er auch lebt, sein eigener Schriftduktus gege-
ben ist. Neben diesem Individualstil registrieren wir
den Zeitstil. Allein schon die vermehrte Großschrei-
bung nebst den schlankeren Buchstaben unterscheidet
generell die Schriften des 16. von jenen des 15. Jahr-
hunderts. Schließlich können wir von einem Material-
stil sprechen. Wer einmal auf Pergament geschrieben
hat, weiß um die Vorzüge dieses Schreib-, Zeichen- und
Malgrundes, weiß aber auch um seine Kostbarkeit. Das
hat die Schreiber diszipliniert. Deshalb bestechen die
Schriften der Pergamenturkunden durch überlegte Ein-
teilung und Formprägnanz, es sei denn, die Urkunde sei
dunkel an Schrift und blöd am Pergament, wie es in
einem Kaufbrief von 1615 heißt. Die guten Eigenschaf-
ten der mittelalterlichen Kanzleischriften vermißt man
weithin bei den nachfolgenden Gmünder Rechnungsbü-
chern und Protokollen. Dies zur Erklärung der oft bes-
seren Lesbarkeit der alten Schönschriften gegenüber
den jüngeren Niederschriften. Nicht historische Schrift-
formen erschweren das Lesen sonderlich, sondern eine
ungepflegte, undiszipliniert hingeworfene Schrift wie
das Gesudel des Gmünder Stadtschreibers Martin Zwei-
fel (s. StadtR 1565). Darin übertroffen hat ihn noch der
Ratsschreiber Max Bener (s. RP 1607), dessen eigen-
willige Abkürzungen nichts anderes sind als Faulheits-
striche. Er gehört zu jenen Canzley Substituten, bei de-
nen mercklicher Defect und Unfleiß befunden, indem
sie orthographiam sogar oder wenig observiret, auch
incorrect unleslich und unverständig schreiben (Jeger,
Periphrasia, 216). Beim Entziffern dieser haltlosen
Handschriften ist Geduld vonnöten. Liegen diese dann
noch in jahrzehntealten, am heutigen Standard gemes-
sen unzulänglichen Fotokopien vor (und fast alles ko-
pierte Material des Gmünder Archivs stammt aus den
sechziger und siebziger Jahren)1, hat selbst der geübte
Leser Mühe, kann auch er nicht jedes Wort dechiffrie-
ren.
Viele Quellenzeugnisse des Registers sind im ursprüng-
lichen Wortlaut, im Klang ihrer Zeit belassen. Ihre Un-
mittelbarkeit hätte, so meinen wir, durch modernisie-
rende Glättungen verloren. Wir verstehen besser, wenn
wir sprechen hören. In der Sprache hören wir das Mi-
lieu, man vernimmt noch eine wirkliche Vulgata in ih-
rer derben Echtheit und Aufrichtigkeit. Georg Schunter
die Rotznas, protokolliert der Ratsschreiber, als dieser
Schläger und Messerstecher vor den Rat zitiert wird
(RP 1584, 164).
Die Anlässe zur Schriftlichkeit in den Amtsstuben hat-
ten nichts mit Poesie, sondern mit den praktischen und
rechtlichen Dingen des Tages und des Lebens zu tun.
Die Schreiber, zuweilen wenig sprachbewußt, verein-
fachten Sachverhalte wo sie nur konnten und suchten
Zuflucht in Formeln. Das Problem der Rechtschreibung
belastete sie nicht. Der Hofverwalter Steinhäuser in St.
Katharina schrieb so, wie ihm der Schnabel gewachsen
war: in unverfälschtem Schwäbisch. Er und seine Zeit-
und Spachgenossen notierten ain nais fenster, raute
Dira [rote Türen], des ist verliha worda [das ist verlie-
hen worden], man geitt [gibt] einem Taglehner 2 fl, der
Ziegler liefert 3 dauset blata, ein Born mit Öpfel. Was
man heute noch in den Gmünder Gassen sagt und hört,
steht so lautgetreu in den alten Schriften, wenn die
Rede ist von Ayr [Eier], Britternegel, Bira [Birnen]
1 Warum, so fragt der Studierende im Lesesaal des Gmünder Stadt-
archivs, müssen die früher den Staatsarchiven gegebenen und von ih-
nen requirierten Originalschriften dort verbleiben? Warum muß sich
die lokale Forschung vor Ort mit schwerer lesbaren Kopien begnügen,
kann Einbände und Papier der Schriften nicht begutachten? Würde
das Auswechseln ihrer Standorte nicht das fördern, was vornehmster
Sinn ihrer Aufbewahrung ist, ihre Erschließung durch Forschung? Die
gierigen Vereinnahmungen der großen Institutionen - wobei auch
kirchliche Zentralarchive gemeint sind - lassen sich in der Gegenwart
nicht mehr plausibel begründen und rechtfertigen. Auch in den Stadt-
archiven wird heute wissenschaftlich gearbeitet, werden die Bestände
ebenso feuersicher verwahrt, werden sie vor allem öfter in die Hand
genommen als in den großen Archiven.
37