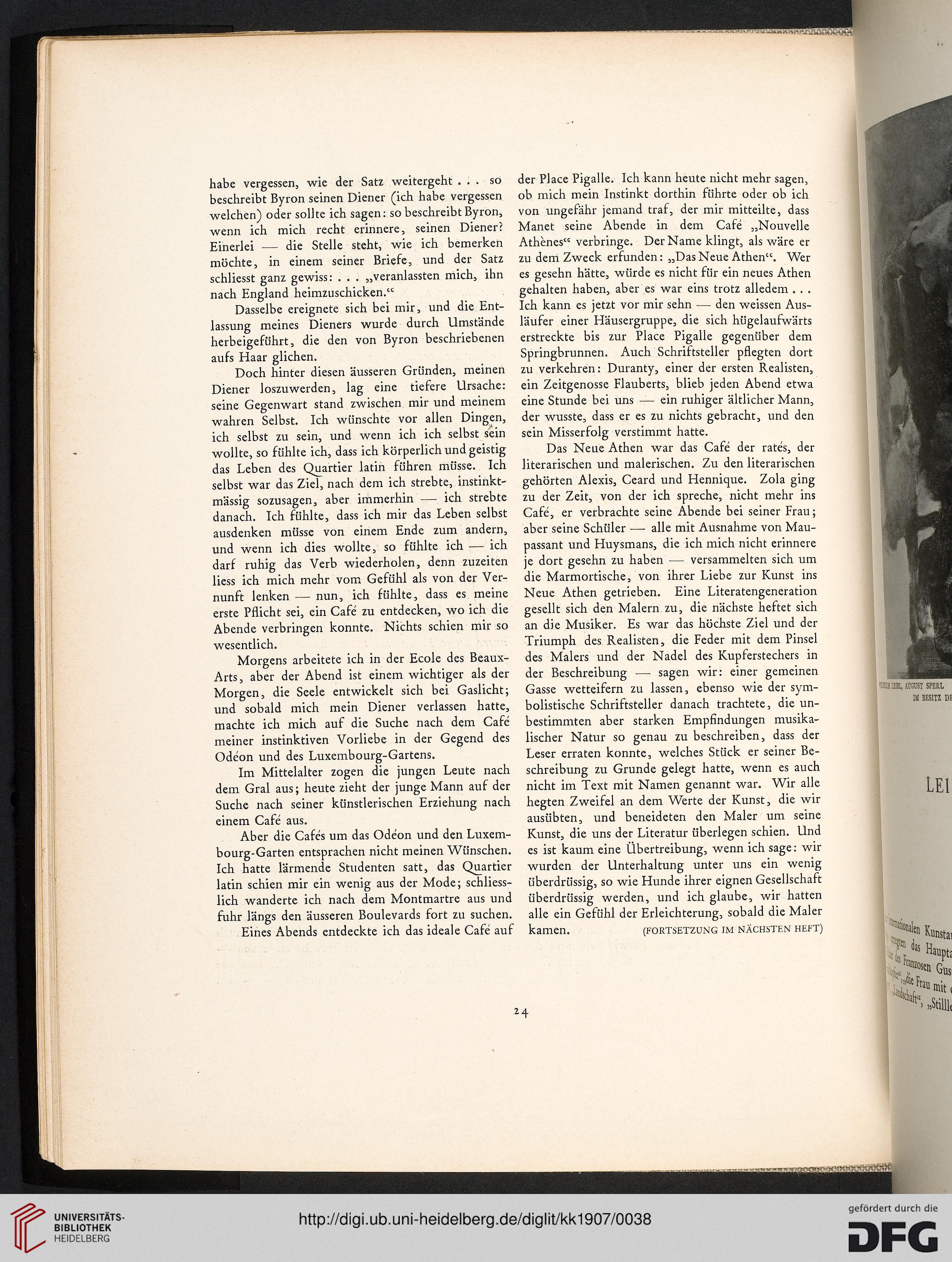so
habe vergessen, wie der Satz weitergeht .
beschreibt Byron seinen Diener (ich habe vergessen
welchen) oder sollte ich sagen: so beschreibt Byron,
wenn ich mich recht erinnere, seinen Diener?
Einerlei — die Stelle steht, wie ich bemerken
möchte, in einem seiner Briefe, und der Satz
schliesst ganz gewiss: . . . „veranlassten mich, ihn
nach England heimzuschicken."
Dasselbe ereignete sich bei mir, und die Ent-
lassung meines Dieners wurde durch Umstände
herbeigeführt, die den von Byron beschriebenen
aufs Haar glichen.
Doch hinter diesen äusseren Gründen, meinen
Diener loszuwerden, lag eine tiefere Ursache:
seine Gegenwart stand zwischen mir und meinem
wahren Selbst. Ich wünschte vor allen Dingen,
ich selbst zu sein, und wenn ich ich selbst sein
wollte, so fühlte ich, dass ich körperlich und geistig
das Leben des Quartier latin führen müsse. Ich
selbst war das Ziel, nach dem ich strebte, instinkt-
mässig sozusagen, aber immerhin — ich strebte
danach. Ich fühlte, dass ich mir das Leben selbst
ausdenken müsse von einem Ende zum andern,
und wenn ich dies wollte, so fühlte ich — ich
darf ruhig das Verb wiederholen, denn zuzeiten
liess ich mich mehr vom Gefühl als von der Ver-
nunft lenken — nun, ich fühlte, dass es meine
erste Pflicht sei, ein Cafe zu entdecken, wo ich die
Abende verbringen konnte. Nichts schien mir so
wesentlich.
Morgens arbeitete ich in der Ecole des Beaux-
Arts, aber der Abend ist einem wichtiger als der
Morgen, die Seele entwickelt sich bei Gaslicht;
und sobald mich mein Diener verlassen hatte,
machte ich mich auf die Suche nach dem Cafe
meiner instinktiven Vorliebe in der Gegend des
Odeon und des Luxembourg-Gartens.
Im Mittelalter zogen die jungen Leute nach
dem Gral aus; heute zieht der junge Mann auf der
Suche nach seiner künstlerischen Erziehung nach
einem Cafe aus.
Aber die Cafes um das Odeon und den Luxem-
bourg-Garten entsprachen nicht meinen Wünschen.
Ich hatte lärmende Studenten satt, das Quartier
latin schien mir ein wenig aus der Mode; schliess-
lich wanderte ich nach dem Montmartre aus und
fuhr längs den äusseren Boulevards fort zu suchen.
Eines Abends entdeckte ich das ideale Cafe auf
der Place Pigalle. Ich kann heute nicht mehr sagen,
ob mich mein Instinkt dorthin führte oder ob ich
von ungefähr jemand traf, der mir mitteilte, dass
Manet seine Abende in dem Cafe „Nouvelle
Athenes" verbringe. Der Name klingt, als wäre er
zu dem Zweck erfunden: „Das Neue Athen". Wer
es gesehn hätte, würde es nicht für ein neues Athen
gehalten haben, aber es war eins trotz alledem . . .
Ich kann es jetzt vor mir sehn — den weissen Aus-
läufer einer Häusergruppe, die sich hügelaufwärts
erstreckte bis zur Place Pigalle gegenüber dem
Springbrunnen. Auch Schriftsteller pflegten dort
zu verkehren: Duranty, einer der ersten Realisten,
ein Zeitgenosse Flauberts, blieb jeden Abend etwa
eine Stunde bei uns — ein ruhiger ältlicher Mann,
der wusste, dass er es zu nichts gebracht, und den
sein Misserfolg verstimmt hatte.
Das Neue Athen war das Cafe der rates, der
literarischen und malerischen. Zu den literarischen
gehörten Alexis, Ceard und Hennique. Zola ging
zu der Zeit, von der ich spreche, nicht mehr ins
Cafe, er verbrachte seine Abende bei seiner Frau;
aber seine Schüler — alle mit Ausnahme von Mau-
passant und Huysmans, die ich mich nicht erinnere
je dort gesehn zu haben — versammelten sich um
die Marmortische, von ihrer Liebe zur Kunst ins
Neue Athen getrieben. Eine Literatengeneration
gesellt sich den Malern zu, die nächste heftet sich
an die Musiker. Es war das höchste Ziel und der
Triumph des Realisten, die Feder mit dem Pinsel
des Malers und der Nadel des Kupferstechers in
der Beschreibung — sagen wir: einer gemeinen
Gasse wetteifern zu lassen, ebenso wie der sym-
bolistische Schriftsteller danach trachtete, die un-
bestimmten aber starken Empfindungen musika-
lischer Natur so genau zu beschreiben, dass der
Leser erraten konnte, welches Stück er seiner Be-
schreibung zu Grunde gelegt hatte, wenn es auch
nicht im Text mit Namen genannt war. Wir alle
hegten Zweifel an dem Werte der Kunst, die wir
ausübten, und beneideten den Maler um seine
Kunst, die uns der Literatur überlegen schien. Und
es ist kaum eine Übertreibung, wenn ich sage: wir
wurden der Unterhaltung unter uns ein wenig
überdrüssig, so wie Hunde ihrer eignen Gesellschaft
überdrüssig werden, und ich glaube, wir hatten
alle ein Gefühl der Erleichterung, sobald die Maler
kamen. (Fortsetzung im nächsten heft)
i II
24
habe vergessen, wie der Satz weitergeht .
beschreibt Byron seinen Diener (ich habe vergessen
welchen) oder sollte ich sagen: so beschreibt Byron,
wenn ich mich recht erinnere, seinen Diener?
Einerlei — die Stelle steht, wie ich bemerken
möchte, in einem seiner Briefe, und der Satz
schliesst ganz gewiss: . . . „veranlassten mich, ihn
nach England heimzuschicken."
Dasselbe ereignete sich bei mir, und die Ent-
lassung meines Dieners wurde durch Umstände
herbeigeführt, die den von Byron beschriebenen
aufs Haar glichen.
Doch hinter diesen äusseren Gründen, meinen
Diener loszuwerden, lag eine tiefere Ursache:
seine Gegenwart stand zwischen mir und meinem
wahren Selbst. Ich wünschte vor allen Dingen,
ich selbst zu sein, und wenn ich ich selbst sein
wollte, so fühlte ich, dass ich körperlich und geistig
das Leben des Quartier latin führen müsse. Ich
selbst war das Ziel, nach dem ich strebte, instinkt-
mässig sozusagen, aber immerhin — ich strebte
danach. Ich fühlte, dass ich mir das Leben selbst
ausdenken müsse von einem Ende zum andern,
und wenn ich dies wollte, so fühlte ich — ich
darf ruhig das Verb wiederholen, denn zuzeiten
liess ich mich mehr vom Gefühl als von der Ver-
nunft lenken — nun, ich fühlte, dass es meine
erste Pflicht sei, ein Cafe zu entdecken, wo ich die
Abende verbringen konnte. Nichts schien mir so
wesentlich.
Morgens arbeitete ich in der Ecole des Beaux-
Arts, aber der Abend ist einem wichtiger als der
Morgen, die Seele entwickelt sich bei Gaslicht;
und sobald mich mein Diener verlassen hatte,
machte ich mich auf die Suche nach dem Cafe
meiner instinktiven Vorliebe in der Gegend des
Odeon und des Luxembourg-Gartens.
Im Mittelalter zogen die jungen Leute nach
dem Gral aus; heute zieht der junge Mann auf der
Suche nach seiner künstlerischen Erziehung nach
einem Cafe aus.
Aber die Cafes um das Odeon und den Luxem-
bourg-Garten entsprachen nicht meinen Wünschen.
Ich hatte lärmende Studenten satt, das Quartier
latin schien mir ein wenig aus der Mode; schliess-
lich wanderte ich nach dem Montmartre aus und
fuhr längs den äusseren Boulevards fort zu suchen.
Eines Abends entdeckte ich das ideale Cafe auf
der Place Pigalle. Ich kann heute nicht mehr sagen,
ob mich mein Instinkt dorthin führte oder ob ich
von ungefähr jemand traf, der mir mitteilte, dass
Manet seine Abende in dem Cafe „Nouvelle
Athenes" verbringe. Der Name klingt, als wäre er
zu dem Zweck erfunden: „Das Neue Athen". Wer
es gesehn hätte, würde es nicht für ein neues Athen
gehalten haben, aber es war eins trotz alledem . . .
Ich kann es jetzt vor mir sehn — den weissen Aus-
läufer einer Häusergruppe, die sich hügelaufwärts
erstreckte bis zur Place Pigalle gegenüber dem
Springbrunnen. Auch Schriftsteller pflegten dort
zu verkehren: Duranty, einer der ersten Realisten,
ein Zeitgenosse Flauberts, blieb jeden Abend etwa
eine Stunde bei uns — ein ruhiger ältlicher Mann,
der wusste, dass er es zu nichts gebracht, und den
sein Misserfolg verstimmt hatte.
Das Neue Athen war das Cafe der rates, der
literarischen und malerischen. Zu den literarischen
gehörten Alexis, Ceard und Hennique. Zola ging
zu der Zeit, von der ich spreche, nicht mehr ins
Cafe, er verbrachte seine Abende bei seiner Frau;
aber seine Schüler — alle mit Ausnahme von Mau-
passant und Huysmans, die ich mich nicht erinnere
je dort gesehn zu haben — versammelten sich um
die Marmortische, von ihrer Liebe zur Kunst ins
Neue Athen getrieben. Eine Literatengeneration
gesellt sich den Malern zu, die nächste heftet sich
an die Musiker. Es war das höchste Ziel und der
Triumph des Realisten, die Feder mit dem Pinsel
des Malers und der Nadel des Kupferstechers in
der Beschreibung — sagen wir: einer gemeinen
Gasse wetteifern zu lassen, ebenso wie der sym-
bolistische Schriftsteller danach trachtete, die un-
bestimmten aber starken Empfindungen musika-
lischer Natur so genau zu beschreiben, dass der
Leser erraten konnte, welches Stück er seiner Be-
schreibung zu Grunde gelegt hatte, wenn es auch
nicht im Text mit Namen genannt war. Wir alle
hegten Zweifel an dem Werte der Kunst, die wir
ausübten, und beneideten den Maler um seine
Kunst, die uns der Literatur überlegen schien. Und
es ist kaum eine Übertreibung, wenn ich sage: wir
wurden der Unterhaltung unter uns ein wenig
überdrüssig, so wie Hunde ihrer eignen Gesellschaft
überdrüssig werden, und ich glaube, wir hatten
alle ein Gefühl der Erleichterung, sobald die Maler
kamen. (Fortsetzung im nächsten heft)
i II
24