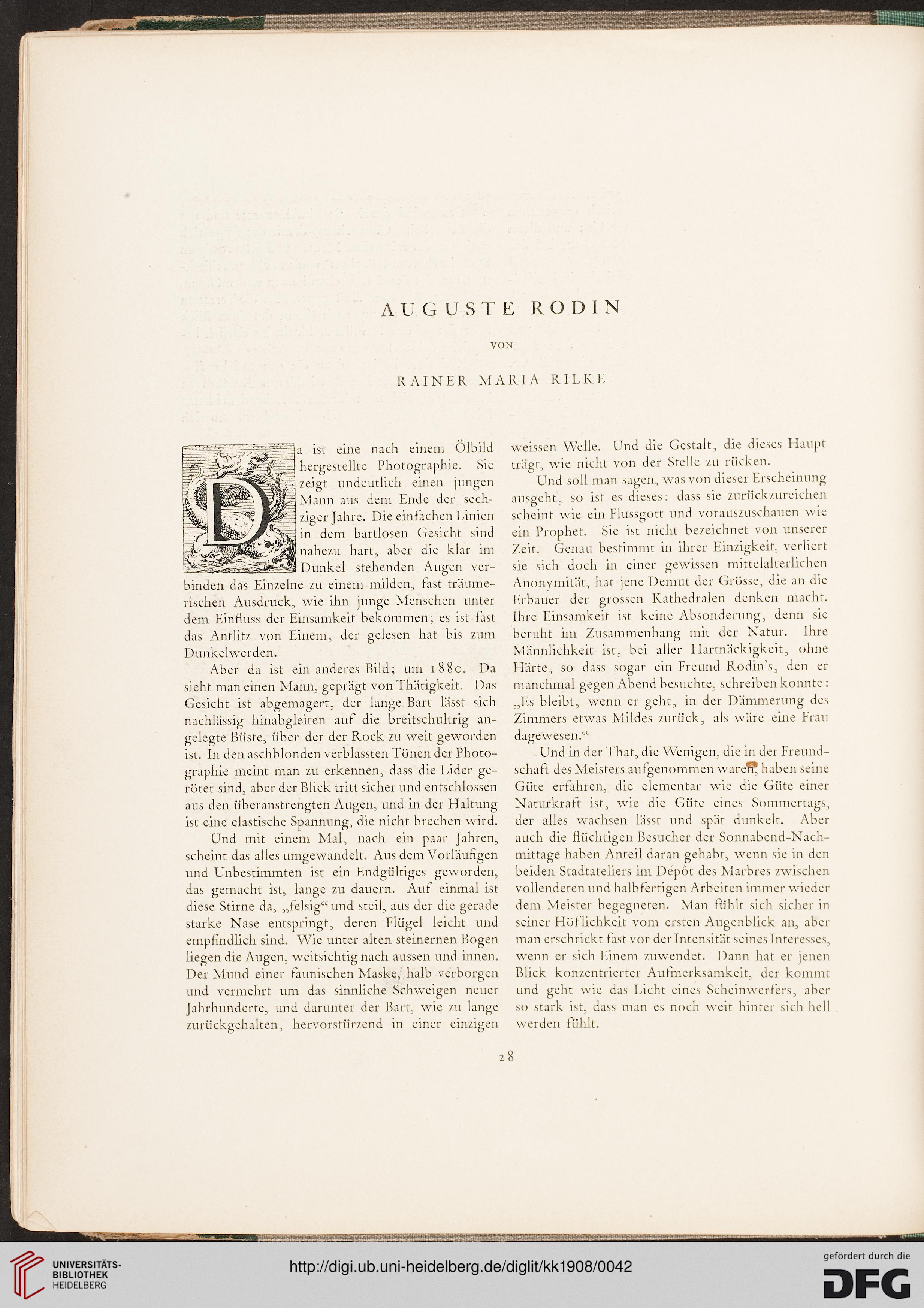■■■
AUGUSTE ROD1N
VON
RAINER MARIA RILKE
a ist eine nach einem Ölbild
hergestellte Photographie. Sie
zeigt undeutlich einen jungen
Mann aus dem Ende der sech-
ziger Jahre. Die einfachen Linien
in dem bartlosen Gesicht sind
nahezu hart, aber die klar im
Dunkel stehenden Augen ver-
binden das Einzelne zu einem milden, fast träume-
rischen Ausdruck, wie ihn junge Menschen unter
dem Einfluss der Einsamkeit bekommen; es ist fast
das Antlitz von Einem, der gelesen hat bis zum
Dunkelwerden.
Aber da ist ein anderes Bild; um 1880. Da
sieht man einen Mann, geprägt von Thätigkeit. Das
Gesicht ist abgemagert, der lange Bart lässt sich
nachlässig hinabgleiten auf die breitschultrig an-
gelegte Büste, über der der Rock zu weit geworden
ist. In den aschblonden verblassten Tönen der Photo-
graphie meint man zu erkennen, dass die Lider ge-
rötet sind, aber der Blick tritt sicher und entschlossen
aus den überanstrengten Augen, und in der I laltung
ist eine elastische Spannung, die nicht brechen wird.
Und mit einem Mal, nach ein paar Jahren,
scheint das alles umgewandelt. Aus dem Vorläufigen
und Unbestimmten ist ein Endgültiges geworden,
das gemacht ist, lange zu dauern. Auf einmal ist
diese Stirne da, „felsig" und steil, aus der die gerade
starke Nase entspringt, deren Flügel leicht und
empfindlich sind. Wie unter alten steinernen Bogen
liegen die Augen, weitsichtig nach aussen und innen.
Der Mund einer faunischen Maske, halb verborgen
und vermehrt um das sinnliche Schweigen neuer
Jahrhunderte, und darunter der Bart, wie zu lange
zurückgehalten, hervorstürzend in einer einzigen
weissen Welle. Und die Gestalt, die dieses Haupt
trägt, wie nicht von der Stelle zu rücken.
Und soll man sagen, was von dieser Erscheinung
ausgeht, so ist es dieses: dass sie zurückzureichen
scheint wie ein Flussgott und vorauszuschauen wie
ein Prophet. Sie ist nicht bezeichnet von unserer
Zeit. Genau bestimmt in ihrer Einzigkeit, verliert
sie sich doch in einer gewissen mittelalterlichen
Anonymität, hat jene Demut der Grösse, die an die
Erbauer der grossen Kathedralen denken macht.
Ihre Einsamkeit ist keine Absonderung, denn sie
beruht im Zusammenhang mit der Nattir. Ihre
Männlichkeit ist, bei aller Flartnäckigkeit, ohne
Härte, so dass sogar ein Freund Rodin's, den er
manchmal gegen Abend besuchte, schreiben konnte:
„Es bleibt, wenn er geht, in der Dämmerung des
Zimmers etwas Mildes zurück, als wäre eine Frau
dagewesen."
Und in der That, die Wenigen, die in der Freund-
schaft des Meisters aufgenommen warefl^ haben seine
Güte erfahren, die elementar wie die Güte einer
Naturkraft ist, wie die Güte eines Sommertags,
der alles wachsen lässt und spät dunkelt. Aber
auch die flüchtigen Besucher der Sonnabend-Nach-
mittage haben Anteil daran gehabt, wenn sie in den
beiden Stadtateliers im Depot des Marbres zwischen
vollendeten und halbfertigen Arbeiten immer wieder
dem Meister begegneten. Man fühlt sich sicher in
seiner Höflichkeit vom ersten Augenblick an, aber
man erschrickt fast vor der Intensität seines Interesses,
wenn er sich Einem zuwendet. Dann hat er jenen
Blick konzentrierter Aufmerksamkeit, der kommt
und geht wie das Licht eines Scheinwerfers, aber
so stark ist, dass man es noch weit hinter sich hell
werden fühlt.
28
AUGUSTE ROD1N
VON
RAINER MARIA RILKE
a ist eine nach einem Ölbild
hergestellte Photographie. Sie
zeigt undeutlich einen jungen
Mann aus dem Ende der sech-
ziger Jahre. Die einfachen Linien
in dem bartlosen Gesicht sind
nahezu hart, aber die klar im
Dunkel stehenden Augen ver-
binden das Einzelne zu einem milden, fast träume-
rischen Ausdruck, wie ihn junge Menschen unter
dem Einfluss der Einsamkeit bekommen; es ist fast
das Antlitz von Einem, der gelesen hat bis zum
Dunkelwerden.
Aber da ist ein anderes Bild; um 1880. Da
sieht man einen Mann, geprägt von Thätigkeit. Das
Gesicht ist abgemagert, der lange Bart lässt sich
nachlässig hinabgleiten auf die breitschultrig an-
gelegte Büste, über der der Rock zu weit geworden
ist. In den aschblonden verblassten Tönen der Photo-
graphie meint man zu erkennen, dass die Lider ge-
rötet sind, aber der Blick tritt sicher und entschlossen
aus den überanstrengten Augen, und in der I laltung
ist eine elastische Spannung, die nicht brechen wird.
Und mit einem Mal, nach ein paar Jahren,
scheint das alles umgewandelt. Aus dem Vorläufigen
und Unbestimmten ist ein Endgültiges geworden,
das gemacht ist, lange zu dauern. Auf einmal ist
diese Stirne da, „felsig" und steil, aus der die gerade
starke Nase entspringt, deren Flügel leicht und
empfindlich sind. Wie unter alten steinernen Bogen
liegen die Augen, weitsichtig nach aussen und innen.
Der Mund einer faunischen Maske, halb verborgen
und vermehrt um das sinnliche Schweigen neuer
Jahrhunderte, und darunter der Bart, wie zu lange
zurückgehalten, hervorstürzend in einer einzigen
weissen Welle. Und die Gestalt, die dieses Haupt
trägt, wie nicht von der Stelle zu rücken.
Und soll man sagen, was von dieser Erscheinung
ausgeht, so ist es dieses: dass sie zurückzureichen
scheint wie ein Flussgott und vorauszuschauen wie
ein Prophet. Sie ist nicht bezeichnet von unserer
Zeit. Genau bestimmt in ihrer Einzigkeit, verliert
sie sich doch in einer gewissen mittelalterlichen
Anonymität, hat jene Demut der Grösse, die an die
Erbauer der grossen Kathedralen denken macht.
Ihre Einsamkeit ist keine Absonderung, denn sie
beruht im Zusammenhang mit der Nattir. Ihre
Männlichkeit ist, bei aller Flartnäckigkeit, ohne
Härte, so dass sogar ein Freund Rodin's, den er
manchmal gegen Abend besuchte, schreiben konnte:
„Es bleibt, wenn er geht, in der Dämmerung des
Zimmers etwas Mildes zurück, als wäre eine Frau
dagewesen."
Und in der That, die Wenigen, die in der Freund-
schaft des Meisters aufgenommen warefl^ haben seine
Güte erfahren, die elementar wie die Güte einer
Naturkraft ist, wie die Güte eines Sommertags,
der alles wachsen lässt und spät dunkelt. Aber
auch die flüchtigen Besucher der Sonnabend-Nach-
mittage haben Anteil daran gehabt, wenn sie in den
beiden Stadtateliers im Depot des Marbres zwischen
vollendeten und halbfertigen Arbeiten immer wieder
dem Meister begegneten. Man fühlt sich sicher in
seiner Höflichkeit vom ersten Augenblick an, aber
man erschrickt fast vor der Intensität seines Interesses,
wenn er sich Einem zuwendet. Dann hat er jenen
Blick konzentrierter Aufmerksamkeit, der kommt
und geht wie das Licht eines Scheinwerfers, aber
so stark ist, dass man es noch weit hinter sich hell
werden fühlt.
28