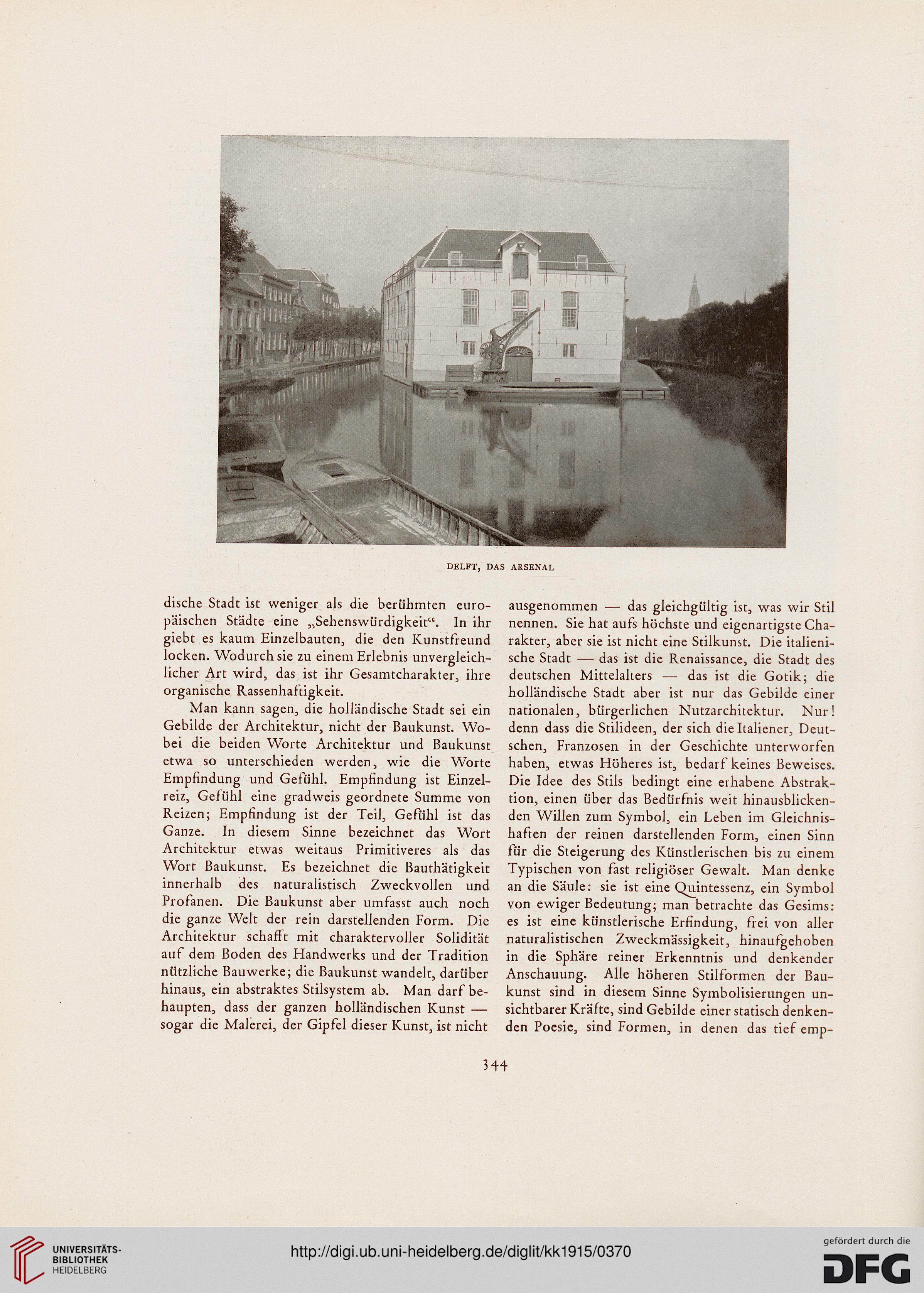Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe — 13.1915
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.4714#0370
DOI Heft:
Heft 8
DOI Artikel:Scheffler, Karl: Die holländische Stadt, [1]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.4714#0370
Schmutztitel
Schmutztitel
KUNST UND KÜNSTLER
Titelblatt
Titelblatt 1
KUNST UND KÜNSTLER
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis 1
KUNST UND KÜNSTLER
…
Burchard, Ludwig: Werke alter Kunst aus Berliner
…
Mayer, August L.: Notizen zu Rembrandts Kunst 487
…
— Moderne Museen deutscher Kunst: Hannover 562
Inhaltsverzeichnis 3
Engelmann, Richard: Figur für ein Wildenbruch-
…
Griechische Originale aus dem Alten Museum zu
…
Klint, Jensen: Entwurf für eine Kirche .... 502
Inhaltsverzeichnis 4
Petersen, Carl: Museum in Faeborg..... 501
…
Kunst und Künstler im Kriege....... 33?
Inhaltsverzeichnis 5
Alte Kunst, Werke aus Berliner Privatbesitz . . 516
…
Ausstellung deutscher Kunst in Darmstadt 387, 479, 530
…
Berlin, Altes Museum.......... 5» 77
…
Darmstädter Ausstellung deutscher Kunst 387, 479, 530
…
Griechische Originale im Alten Museum zu Berlin 5,77
Inhaltsverzeichnis 6
Köln, Wallraf-Richartz-Museum......1 y. ^r
…
Krieg und Schlacht in der Kunst.....1 1 f, 149
…
„Kunst und Künstler im Kriege".......140
…
Kurmainzer Kunst.............482
…
Moderne, Die, im Wallraf-Richartz-Museum zu
Inhaltsverzeichnis 7
Wallraf-Richartz-Museum in Köln.....1$, 61
…
Werke alter Kunst aus Berliner Privatbesitz . . 516
Heft 1
Titelblatt Heft 1.1
KUNST UND KÜNSTLER
…
Museum zu Berlin........
…
dem Alten Museum zu Berlin . . .5—14
…
Museum...........38
…
Kühnen. Brüssel, Museum.....^1
…
KUNST
…
KUNST UND KÜNSTLER
…
Museum zu Berlin........
…
dem Alten Museum zu Berlin . . .5—14
…
Museum...........38
…
Kühnen. Brüssel, Museum.....^1
…
KUNST
1
sie nur dem Augenblick. Was soll ihr jetzt die Kunst!
…
sie nur dem Augenblick. Was soll ihr jetzt die Kunst!
3
die Aufgabe Deutschlands sein wird, die Kunst des
…
Kunst aber bewegt sich parallel. Auch der moderne
…
Schicksal der modernen Kunst entschieden werden.
…
unserer Kunst herauskommen und eine Kunst haben
…
die Aufgabe Deutschlands sein wird, die Kunst des
…
Kunst aber bewegt sich parallel. Auch der moderne
…
Schicksal der modernen Kunst entschieden werden.
…
unserer Kunst herauskommen und eine Kunst haben
4
Gegenstände für ihre jetzt ratlose Idealität und
…
sich das alles einst in schöne Kunst dann verwan-
…
Gegenstände für ihre jetzt ratlose Idealität und
…
sich das alles einst in schöne Kunst dann verwan-
5
GRIECHISCHE ORIGINALE IM ALTEN MUSEUM
…
musste eine Kunst zur Seite stehen, deren Haupt-
…
konnte eine im allgemeinen so formenstrenge Kunst
…
GRIECHISCHE ORIGINALE IM ALTEN MUSEUM
…
musste eine Kunst zur Seite stehen, deren Haupt-
…
konnte eine im allgemeinen so formenstrenge Kunst
6
die Wissenschaft von der Kunst der Alten einstmals
…
hatte, in der alten Kunst Züge zu finden, die dem
…
wärmender Strahl hat auch die antike Kunst ge-
…
von wertvoller alter Kunst zusammengetragen ist.
…
schichtliches Museum. Auch die Antikensamm-
…
Welch schnellen Aufstieg die griechische Kunst in
…
für die Dorfkirche ein Epitaphium malen soll und
…
* E. Waldmann, Kunst und Künstler 1910, S. 41 und 154.
…
die Wissenschaft von der Kunst der Alten einstmals
…
hatte, in der alten Kunst Züge zu finden, die dem
…
wärmender Strahl hat auch die antike Kunst ge-
…
von wertvoller alter Kunst zusammengetragen ist.
…
schichtliches Museum. Auch die Antikensamm-
…
Welch schnellen Aufstieg die griechische Kunst in
…
für die Dorfkirche ein Epitaphium malen soll und
…
* E. Waldmann, Kunst und Künstler 1910, S. 41 und 154.
10
alter Kunst und Nachbildungen alter Werke um-
…
deutlich in der Kunst bemerkbar; die Kultur war
…
alter Kunst und Nachbildungen alter Werke um-
…
deutlich in der Kunst bemerkbar; die Kultur war
13
schönsten in den attischen Werken für uns sichtbar Auf den älteren Grabstelen dieser Gattung ist der
…
schönsten in den attischen Werken für uns sichtbar Auf den älteren Grabstelen dieser Gattung ist der
15
DIE MODERNE IM WALLRAF-R IC HARTZ-MUSEUM
…
eine Sammlung guter zeitgenössischer Kunst zu
…
dem Museum geschenkt hatte, hängten sie hoch
…
behalten, einen Ehrensaal für den grössten Maler,
…
DIE MODERNE IM WALLRAF-R IC HARTZ-MUSEUM
…
eine Sammlung guter zeitgenössischer Kunst zu
…
dem Museum geschenkt hatte, hängten sie hoch
…
behalten, einen Ehrensaal für den grössten Maler,
20
Da das Museum von Leibls Art
…
und für die spätere Zukunft als
…
in seiner Jugend schon am meisten in der Kunst nung zu Leibls Arbeiten der nachpariserischen Zeit,
…
als Werkzeug für seine Gedanken-und Kompositions-
…
Da das Museum von Leibls Art
…
und für die spätere Zukunft als
…
in seiner Jugend schon am meisten in der Kunst nung zu Leibls Arbeiten der nachpariserischen Zeit,
…
als Werkzeug für seine Gedanken-und Kompositions-
23
für Deutschland historisch sehr wichtiges Bild.
…
für Deutschland historisch sehr wichtiges Bild.
26
Verhängnisvoll, wie für den belgischen Besitz
…
ab (das andere wird im Museum zu Ant-
…
mans bewundert wird, das 1403 für die-
…
ben? — Das Museum von Löwen, schlecht
…
und die Quellen seiner Kunst liegen anderswo.
…
Verhängnisvoll, wie für den belgischen Besitz
…
ab (das andere wird im Museum zu Ant-
…
mans bewundert wird, das 1403 für die-
…
ben? — Das Museum von Löwen, schlecht
…
und die Quellen seiner Kunst liegen anderswo.
27
Kunst zu entwickeln, die persönliche Farbe genug
…
Kunst zu entwickeln, die persönliche Farbe genug
28
dem „Abendmahl", die Kunst Dirks mit all ihrer
…
München, geniessen wir diese Kunst, immer aber
…
dem „Abendmahl", die Kunst Dirks mit all ihrer
…
München, geniessen wir diese Kunst, immer aber
30
Früchten, weil viele schöne Werke der Kunst es
…
Werken der Kunst, und allem, was gross und herrlich
…
Früchten, weil viele schöne Werke der Kunst es
…
Werken der Kunst, und allem, was gross und herrlich
31
Antw.Für einen verabscheuungs würdigen Menschen;
…
Fr. Wann hast du dies im stillen für dich wieder-
…
der Kunst.
…
Antw.Für einen verabscheuungs würdigen Menschen;
…
Fr. Wann hast du dies im stillen für dich wieder-
…
der Kunst.
32
Treue, Schönheit, Wissenschaft und Kunst.
…
hat, jetzt ist er es, für die Wackeren unter den Sachsen,
…
der noch ausserdem für den Fortgang des Kriegs, der
…
Fr. Also ist es, für jeden, der auf einer wichtigen
…
Treue, Schönheit, Wissenschaft und Kunst.
…
hat, jetzt ist er es, für die Wackeren unter den Sachsen,
…
der noch ausserdem für den Fortgang des Kriegs, der
…
Fr. Also ist es, für jeden, der auf einer wichtigen
33
stünde, Staatsdiener des Korsenkaisers ist, und für seine
…
herzigen Kaiser von Österreich, der für die Freiheit
…
Genugtuung für die Empfindlichkeit einer Favonte,
…
stünde, Staatsdiener des Korsenkaisers ist, und für seine
…
herzigen Kaiser von Österreich, der für die Freiheit
…
Genugtuung für die Empfindlichkeit einer Favonte,
…
stünde, Staatsdiener des Korsenkaisers ist, und für seine
…
herzigen Kaiser von Österreich, der für die Freiheit
…
Genugtuung für die Empfindlichkeit einer Favonte,
34
barn, für jede Kunst des Friedens, welche sie von ihnen
…
barn, für jede Kunst des Friedens, welche sie von ihnen
35
PETRUS CRISTUS, GRABLEGUNG. BRÜSSEL, MUSEUM
…
turen des Parthenon ins Britische Museum gelangten
…
PETRUS CRISTUS, GRABLEGUNG. BRÜSSEL, MUSEUM
…
turen des Parthenon ins Britische Museum gelangten
36
Reichtum der heimatlichen Kunst haben belgische
…
sternfähig sein, für unser neu zu errichtendes Mu-
…
aus dem Brüsseler Museum, so verbleibt auch kein
…
besitzt das Berliner Museum nur drei, überdies
…
dem heiligen Franziskus aus dem Brüsseler Museum
…
Reichtum der heimatlichen Kunst haben belgische
…
sternfähig sein, für unser neu zu errichtendes Mu-
…
aus dem Brüsseler Museum, so verbleibt auch kein
…
besitzt das Berliner Museum nur drei, überdies
…
dem heiligen Franziskus aus dem Brüsseler Museum
38
GERARD DAVID, DIE TAUFE CHRISTI, BRÜGCE, MUSEUM
…
GERARD DAVID, DIE TAUFE CHRISTI, BRÜGCE, MUSEUM
39
TIZIAN, CEREMOMENBILD. ANTWERPEN, MUSEUM
…
komponiert, wird dieses Gemälde in keinem Mu-
…
Antwerpener Museum, das uns Christus zeigt, um-
…
TIZIAN, CEREMOMENBILD. ANTWERPEN, MUSEUM
…
komponiert, wird dieses Gemälde in keinem Mu-
…
Antwerpener Museum, das uns Christus zeigt, um-
40
ROGIER VAN DER WEYDEN, DIE SIEBEN SAKRAMENTE. ANTWERPEN, MUSEUM
…
Christi" im Brügger Museum zu vergleichen wäre,
…
von Italien. Rom wurde für die jüngere Genera-
…
Wirklichkeitstudium, ihrer Liebe für das Kleine
…
ROGIER VAN DER WEYDEN, DIE SIEBEN SAKRAMENTE. ANTWERPEN, MUSEUM
…
Christi" im Brügger Museum zu vergleichen wäre,
…
von Italien. Rom wurde für die jüngere Genera-
…
Wirklichkeitstudium, ihrer Liebe für das Kleine
41
RWEVDEN SOG. BO.DN.S KARLS DES KÜHNEN. BKÜSSEU MUSEUM
…
RWEVDEN SOG. BO.DN.S KARLS DES KÜHNEN. BKÜSSEU MUSEUM
42
QUENTIN METSYS, GRABLEGUNG CHRISTI. ANTWERPEN, MUSEUM
…
QUENTIN METSYS, GRABLEGUNG CHRISTI. ANTWERPEN, MUSEUM
43
dessen Kunst in Deutschland bisher nur kleinere
…
Mal in der ganzen nordischen Kunst ein vollstän-
…
das hehrste Denkmal nordischer Kunst zum ewigen
…
Kaiser Friedrich-Museum errichtete, und bei uns,
…
"" ht bloss dem Auge eine Wonne, sondern für den dem Berichte des alten Karel van Mander sich im
…
alten und die Freunde der Kunst strömten her-
…
dessen Kunst in Deutschland bisher nur kleinere
…
Mal in der ganzen nordischen Kunst ein vollstän-
…
das hehrste Denkmal nordischer Kunst zum ewigen
…
Kaiser Friedrich-Museum errichtete, und bei uns,
…
"" ht bloss dem Auge eine Wonne, sondern für den dem Berichte des alten Karel van Mander sich im
…
alten und die Freunde der Kunst strömten her-
Heft 2
Titelblatt Heft 2.1
KUNST UND KÜNSTLER
…
Richartz-Museum. II.......61
…
Museum zu Berlin. II.......77
…
Alten Museum in Berlin . . . . 75—82
…
KUNST
…
KUNST UND KÜNSTLER
…
Richartz-Museum. II.......61
…
Museum zu Berlin. II.......77
…
Alten Museum in Berlin . . . . 75—82
…
KUNST
49
los, um der Sache willen, fremde Kunst, Wissen-
…
los, um der Sache willen, fremde Kunst, Wissen-
50
los. Für die deutsche Seele gilt, was Goethe ein-
…
niemand mehr für möglich gehalten hatte. Auch
…
los. Für die deutsche Seele gilt, was Goethe ein-
…
niemand mehr für möglich gehalten hatte. Auch
51
Dann wird unsere Kunst das allzu Induviduali-
…
auch der Kunst ist.
…
Dann wird unsere Kunst das allzu Induviduali-
…
auch der Kunst ist.
53
Qabi beö Mobilmad)ungSplang für bat ©eutfa)e ^)eer unb bie &aiferlid)e Marine friegöbereit
…
Qabi beö Mobilmad)ungSplang für bat ©eutfa)e ^)eer unb bie &aiferlid)e Marine friegöbereit
55
Die SKcnge, rufenD, ftngenD, für Die ungeheure Erregung
…
Die SKcnge, rufenD, ftngenD, für Die ungeheure Erregung
56
banfe für bie Siebe unb Xreuc, bie u)m erwiefen werbe.
…
^Öilfe für unfer braöeö ^)eer!/; Webe beä Äaifere' am 31. 3uli.
…
banfe für bie Siebe unb Xreuc, bie u)m erwiefen werbe.
…
^Öilfe für unfer braöeö ^)eer!/; Webe beä Äaifere' am 31. 3uli.
60
fajfenbe Siebe, bie Seilnabme für bie anberen, Die fte
…
ju nehmen, fo if? cß ein glänjenber 95ewei£ für bie
…
fajfenbe Siebe, bie Seilnabme für bie anberen, Die fte
…
ju nehmen, fo if? cß ein glänjenber 95ewei£ für bie
62
zösische seiner Kunst mit ihrer „raison". E. te
…
nur für ein Thema, etwa für „Reiter am Meere"
…
zösische seiner Kunst mit ihrer „raison". E. te
…
nur für ein Thema, etwa für „Reiter am Meere"
65
ders für ein Museum schwer, Lieber-
…
Diese Perle Liebermannscher Kunst hat ihr Pendant
…
der Grossmeister Berliner Kunst vergangener Jahr-
…
das Kölner Museum eben erworben hat, ist doch
…
ders für ein Museum schwer, Lieber-
…
Diese Perle Liebermannscher Kunst hat ihr Pendant
…
der Grossmeister Berliner Kunst vergangener Jahr-
…
das Kölner Museum eben erworben hat, ist doch
69
Der Junge steht nun so für die Ewigkeit, wer ihn
…
Der Junge steht nun so für die Ewigkeit, wer ihn
72
von holländischer und vlämischer Kunst deutlich
…
Studium der Malerei bemüht, schon für das fünf-
…
Der Begriff „vlämisch" für die habsburgischen
…
von holländischer und vlämischer Kunst deutlich
…
Studium der Malerei bemüht, schon für das fünf-
…
Der Begriff „vlämisch" für die habsburgischen
73
Schicksal der Brügger Kunst bestimmten, ist kaum
…
Maaseyck ist als Quellpunkt niederländischer Kunst
…
Kunst den Charakter gaben, war Quentin Massys
…
Betrachten wir die niederländische Kunst vom
…
schlag in das Gewebe der südniederländischen Kunst
…
schen Kunst, aus Rogers Schöpfungen krasser her-
…
Schicksal der Brügger Kunst bestimmten, ist kaum
…
Maaseyck ist als Quellpunkt niederländischer Kunst
…
Kunst den Charakter gaben, war Quentin Massys
…
Betrachten wir die niederländische Kunst vom
…
schlag in das Gewebe der südniederländischen Kunst
…
schen Kunst, aus Rogers Schöpfungen krasser her-
74
Das Wesentliche in der Kunst Jan van Eycks
…
druck steht seine Kunst arm und eintönig neben
…
rein holländische Kunst vertritt, eher auf der Eyck-
…
drucksweise für zwei Generationen lieferte, kann
…
Ein Symptom mehr, dass den Galliern Begabung für
…
ländische Kunst darf als rein germanisch betrach-
…
Das Wesentliche in der Kunst Jan van Eycks
…
druck steht seine Kunst arm und eintönig neben
…
rein holländische Kunst vertritt, eher auf der Eyck-
…
drucksweise für zwei Generationen lieferte, kann
…
Ein Symptom mehr, dass den Galliern Begabung für
…
ländische Kunst darf als rein germanisch betrach-
77
IM ALTEN MUSEUM ZU BERLIN
…
Natur den wir als klassische Kunst bezeichnen und
…
weder zu gross für den engen Rahmen, noch steht
…
der Kunst der grossen Meister und dem Kunsthand-
…
IM ALTEN MUSEUM ZU BERLIN
…
Natur den wir als klassische Kunst bezeichnen und
…
weder zu gross für den engen Rahmen, noch steht
…
der Kunst der grossen Meister und dem Kunsthand-
78
kunst" entgegenzustellen, geben die Abbildungen auf
…
Reliefkunst, mit ihrer Vorliebe für
…
das Museum eine ganze Reihe. Zum Beispiel Seite 0,
…
kunst" entgegenzustellen, geben die Abbildungen auf
…
Reliefkunst, mit ihrer Vorliebe für
…
das Museum eine ganze Reihe. Zum Beispiel Seite 0,
81
ausgegangen; für den zeichnenden Stift sind diese
…
Die schöne Harmonie der klassischen Kunst
…
ausgegangen; für den zeichnenden Stift sind diese
…
Die schöne Harmonie der klassischen Kunst
82
auch das Berliner Museum hat nur ein paar Platten
…
schliesst, als ein Zeugnis mehr für den treff-
…
auch das Berliner Museum hat nur ein paar Platten
…
schliesst, als ein Zeugnis mehr für den treff-
86
einmal für uns die Luft geworden sind, ohne die
…
für das unvergängliche formale Genie der französi-
…
deutschen Kunst erscheint, in einem tieferen Sinne
…
einmal für uns die Luft geworden sind, ohne die
…
für das unvergängliche formale Genie der französi-
…
deutschen Kunst erscheint, in einem tieferen Sinne
89
lienische Kunst noch so sehr bewundert werden, es
…
diesem für unsere kulturelle Gesundheit unentbehr-
…
Kunst in jenen entscheidenden Jahrhunderten auf-
…
deutschen Kunst erkannt worden ist: immer kamen
…
französisch in seiner Kunst ist und deshalb die Über-
…
lienische Kunst noch so sehr bewundert werden, es
…
diesem für unsere kulturelle Gesundheit unentbehr-
…
Kunst in jenen entscheidenden Jahrhunderten auf-
…
deutschen Kunst erkannt worden ist: immer kamen
…
französisch in seiner Kunst ist und deshalb die Über-
92
Hergabe ihrer guten Namen für
…
Für die endgültige Beurteilung von Jacques Dalcroze ist
…
„für einen solchen Anschluss, ein
…
Hergabe ihrer guten Namen für
…
Für die endgültige Beurteilung von Jacques Dalcroze ist
…
„für einen solchen Anschluss, ein
93
Die Worte, die Meister Gottfried für die Anklage
…
Eisenarm (für den seit langer Zeit fehlenden Taufbecken-
…
Die Worte, die Meister Gottfried für die Anklage
…
Eisenarm (für den seit langer Zeit fehlenden Taufbecken-
94
illusion und lässt gut erkennen, wo für Böcklins Talent
…
lichen Hochschule für die bildenden Künste, das er zwei-
…
dass allen Kulturländern die Erzeugnisse ihrer Kunst
…
Gerade um die Kunstwerke in Belgien für Belgien
…
Bevölkerung schon vorher mit eigener Gefahr für die
…
illusion und lässt gut erkennen, wo für Böcklins Talent
…
lichen Hochschule für die bildenden Künste, das er zwei-
…
dass allen Kulturländern die Erzeugnisse ihrer Kunst
…
Gerade um die Kunstwerke in Belgien für Belgien
…
Bevölkerung schon vorher mit eigener Gefahr für die
95
dann auf der Venezianer Akademie sich der Kunst ge-
…
Sinne Tschudis für entsprechend hält. Wohl ist Dörn-
…
der modernen Kunst vorzüglich offenbarte, und seine
…
dann auf der Venezianer Akademie sich der Kunst ge-
…
Sinne Tschudis für entsprechend hält. Wohl ist Dörn-
…
der modernen Kunst vorzüglich offenbarte, und seine
96
Für die Rolle des alten Simeon im Lukasevangelium
…
Kunst blieb, vor allem in Deutschland, mehr oder weni-
…
Kunst niemals durchdrangen, und dass ihnen dadurch
…
von der grossen Kunst an bis zu den kleinsten häuslichen
…
Kunst hervorging, so musste dies in Ägypten der Fall
…
unbeschreiblich närrisch, eine Kunst kindisch, kindlich
…
teil, eine Kunst, die kindliche Züge zu bewahren weiss
…
alten zum Credo einer neuen Kunst wird.
…
Philosophie und Kunst das Dichterische eines Natur-
…
gangene Kunst verdolmetschen, und zu gleicher Zeit in
…
Gefilden die Feldarbeit für ihn verrichten sollten. Wer
…
Für die Rolle des alten Simeon im Lukasevangelium
…
Kunst blieb, vor allem in Deutschland, mehr oder weni-
…
Kunst niemals durchdrangen, und dass ihnen dadurch
…
von der grossen Kunst an bis zu den kleinsten häuslichen
…
Kunst hervorging, so musste dies in Ägypten der Fall
…
unbeschreiblich närrisch, eine Kunst kindisch, kindlich
…
teil, eine Kunst, die kindliche Züge zu bewahren weiss
…
alten zum Credo einer neuen Kunst wird.
…
Philosophie und Kunst das Dichterische eines Natur-
…
gangene Kunst verdolmetschen, und zu gleicher Zeit in
…
Gefilden die Feldarbeit für ihn verrichten sollten. Wer
97
dieses Gebet nicht verstand, für den blieben sie form-
…
eigenen Kunst.
…
kopieren als die Maasse und Winkel für eine ägyptische
…
dank der Jahrhundert-Ausstellung deutscher Kunst, drei
…
interessierten wir uns sehr lebhaft für den Spanier aus
…
zu sagen, ungeheuerliches Wissen, was für ein unglaub-
…
dieses Gebet nicht verstand, für den blieben sie form-
…
eigenen Kunst.
…
kopieren als die Maasse und Winkel für eine ägyptische
…
dank der Jahrhundert-Ausstellung deutscher Kunst, drei
…
interessierten wir uns sehr lebhaft für den Spanier aus
…
zu sagen, ungeheuerliches Wissen, was für ein unglaub-
Heft 3
Titelblatt Heft 3.1
KUNST UND KÜNSTLER
…
Kunst...........115 Leonardo da Vinci: Kampf um die Fahne . 117
…
KUNST
…
KUNST UND KÜNSTLER
…
Kunst...........115 Leonardo da Vinci: Kampf um die Fahne . 117
…
KUNST
104
seins über Kunst sprechen und uns erinnern, dass
…
bin einer Unterhaltung über Kunst vor allem aus-
…
— das ist ein Gefühl für sich —; es ist vielmehr
…
und Farben, Motive und Bilder, für die ich früher
…
Empfindung erlangt, wie man die Kunst zu einer
…
Der Jüngere: Ich danke Ihnen für das Ver-
…
seins über Kunst sprechen und uns erinnern, dass
…
bin einer Unterhaltung über Kunst vor allem aus-
…
— das ist ein Gefühl für sich —; es ist vielmehr
…
und Farben, Motive und Bilder, für die ich früher
…
Empfindung erlangt, wie man die Kunst zu einer
…
Der Jüngere: Ich danke Ihnen für das Ver-
108
mich wie Sie, um meine Kunst, während ich um
…
nur für uns wichtig, sondern in ähnlicher Weise
…
eine einheitliche Kunst, nicht viele einander be-
…
und nur für den Augenblick. Ich bin entsetzt,
…
patriotischer Kunst ausgehen könnte und dass
…
sprünglichen Gefühle in der Kunst sogar gefürchtet
…
rungen die Kunst;an! Sie ist doch kein Erzichungs-
…
mich wie Sie, um meine Kunst, während ich um
…
nur für uns wichtig, sondern in ähnlicher Weise
…
eine einheitliche Kunst, nicht viele einander be-
…
und nur für den Augenblick. Ich bin entsetzt,
…
patriotischer Kunst ausgehen könnte und dass
…
sprünglichen Gefühle in der Kunst sogar gefürchtet
…
rungen die Kunst;an! Sie ist doch kein Erzichungs-
111
mittel für unmündige Staatsbürger. Dass sie dazu
…
Erneuerung nötig. In der Kunst darf das sehe ich
…
Sie haben ja längst begonnen, die Kunst so auf
…
Kunst! Endlich wieder! Nicht mehr ein Gemengsei
…
fluss der akademischen Kunst zu brechen und sie
…
Vertreter der ganzen Kunst ihrer Zeit, dazu fehlt
…
Kunst geschaffen, indem sie im höchsten Sinne
…
Kunst, die ich vertrete und die Sie nun auch ver-
…
nen eines sind. Dann erst wird es unserer Kunst ge-
…
der Kunst eines Tages wohl von selbst.
…
mittel für unmündige Staatsbürger. Dass sie dazu
…
Erneuerung nötig. In der Kunst darf das sehe ich
…
Sie haben ja längst begonnen, die Kunst so auf
…
Kunst! Endlich wieder! Nicht mehr ein Gemengsei
…
fluss der akademischen Kunst zu brechen und sie
…
Vertreter der ganzen Kunst ihrer Zeit, dazu fehlt
…
Kunst geschaffen, indem sie im höchsten Sinne
…
Kunst, die ich vertrete und die Sie nun auch ver-
…
nen eines sind. Dann erst wird es unserer Kunst ge-
…
der Kunst eines Tages wohl von selbst.
115
DIE ALEXANDERSCHLACHT. ANTIKES MOSAIK IM NEAFELER MUSEUM
…
gründet, es handelte sich gar nicht um Kunst, son-
…
der Kunst zu tun haben" — schreibt Paul Meyer-
…
DIE ALEXANDERSCHLACHT. ANTIKES MOSAIK IM NEAFELER MUSEUM
…
gründet, es handelte sich gar nicht um Kunst, son-
…
der Kunst zu tun haben" — schreibt Paul Meyer-
116
Zeiten das Merkmal europäischer Kunst gegen-
…
der Alexanderschlacht im Neapeler Museum eine
…
einige episodenhafte Details, die dann für zwei Jahr-
…
Zeiten das Merkmal europäischer Kunst gegen-
…
der Alexanderschlacht im Neapeler Museum eine
…
einige episodenhafte Details, die dann für zwei Jahr-
117
sehr wenig in der Kunst zu spüren ist, so liegt das
…
sehr wenig in der Kunst zu spüren ist, so liegt das
119
Blick des grossen Künstlers für das Mögliche wählten
…
Blick des grossen Künstlers für das Mögliche wählten
121
stantinsschlacht für das Auge durch die scharfen
…
Jahre i 5 13 hatte er sich verpflichtet, für den Saal
…
für seine Saumseligkeit mitbestimmend gewesen
…
stantinsschlacht für das Auge durch die scharfen
…
Jahre i 5 13 hatte er sich verpflichtet, für den Saal
…
für seine Saumseligkeit mitbestimmend gewesen
122
maligen zerfahrenen politischen Verhältnissen für
…
maligen zerfahrenen politischen Verhältnissen für
126
der heute nacht starb, Zweige für sein Begräbnis.
…
der heute nacht starb, Zweige für sein Begräbnis.
127
Strecke Thorn- Allenstein ist wieder nur für Militär-
…
Strecke Thorn- Allenstein ist wieder nur für Militär-
130
gesperrt für Truppentransporte nach Österreich. Mög-
…
für eine Zivilperson sonst sehr schwer ist. Es ist ein
…
gesperrt für Truppentransporte nach Österreich. Mög-
…
für eine Zivilperson sonst sehr schwer ist. Es ist ein
131
Kampf. Es war ein komischer Moment für mich, mich
…
Kampf. Es war ein komischer Moment für mich, mich
132
Ich muss dir sagen, dass dieser Moment für mich
…
Ich muss dir sagen, dass dieser Moment für mich
134
Für den menschlichen Fortschritt gab es somit in
…
Reigen nicht fehlen. Das Höchste ist für Daumier stets
…
für ihn das Selbstverständliche.
…
Für den menschlichen Fortschritt gab es somit in
…
Reigen nicht fehlen. Das Höchste ist für Daumier stets
…
für ihn das Selbstverständliche.
137
für die dem Verfall preisgegebene Rasse, wozu sie
…
Empfänglichkeit für das unvergängliche formale
…
für die dem Verfall preisgegebene Rasse, wozu sie
…
Empfänglichkeit für das unvergängliche formale
138
im Novemberheft von „Kunst und Künstler"
…
Dieses ist das Bild, das Louis Chorinth seiner Vaterstadt Tapiau in Ostpreussen für deren Rat-
…
im Novemberheft von „Kunst und Künstler"
…
Dieses ist das Bild, das Louis Chorinth seiner Vaterstadt Tapiau in Ostpreussen für deren Rat-
139
das Kaiser-Friedrich-Museum
…
rativer Sinn aus. Was er in der Kunst wollte, das hat er
…
das Kaiser-Friedrich-Museum
…
rativer Sinn aus. Was er in der Kunst wollte, das hat er
140
war der Architekt Heinrieb Kohl dem Berliner Museum
…
auch alle die Kameraden von der Kunst, deren Name
…
lassen, unter dem Titel „Kunst und Künstler im Kriege".
…
schlag ist von Max Liebermann gezeichnet. „Kunst
…
Freuden unserer lebendigen Kunst auch in dieser Zeit
…
war der Architekt Heinrieb Kohl dem Berliner Museum
…
auch alle die Kameraden von der Kunst, deren Name
…
lassen, unter dem Titel „Kunst und Künstler im Kriege".
…
schlag ist von Max Liebermann gezeichnet. „Kunst
…
Freuden unserer lebendigen Kunst auch in dieser Zeit
141
fübren, unb für eure@ebanfen! Unb wenn euer@ebanfe
…
fübren, unb für eure@ebanfen! Unb wenn euer@ebanfe
142
kunst der Vivarini, nach verbreiteter, von Kristeller
…
Kunst reichen näher an die grossen Monumente, an
…
kunst der Vivarini, nach verbreiteter, von Kristeller
…
Kunst reichen näher an die grossen Monumente, an
143
Das Vorbild giebt für die Stiche das Jahr 1498
…
lombardischen Kupferstiches vorleonardesk. Für den
…
sie für älter, vielleicht beträchtlich älter, als die beiden
…
für dieses Thema umfangreicherbegrenzt werden, wegen
…
mäler gedruckter Kunst mit sicherer Hand zu ordnen,
…
Das Vorbild giebt für die Stiche das Jahr 1498
…
lombardischen Kupferstiches vorleonardesk. Für den
…
sie für älter, vielleicht beträchtlich älter, als die beiden
…
für dieses Thema umfangreicherbegrenzt werden, wegen
…
mäler gedruckter Kunst mit sicherer Hand zu ordnen,
144
Verlag für Kunstwissenschaff. Berlin 1914.
…
für das Resultat ist, spürt man aus diesem Buch, seinen
…
raschenden Effekten verholfen. In den sonst für den
…
rakteristik folgt ein Abschnitt über die Entwürfe für
…
nach, dass die Anregungen für die Denkmalsideen aus
…
Verlag für Kunstwissenschaff. Berlin 1914.
…
für das Resultat ist, spürt man aus diesem Buch, seinen
…
raschenden Effekten verholfen. In den sonst für den
…
rakteristik folgt ein Abschnitt über die Entwürfe für
…
nach, dass die Anregungen für die Denkmalsideen aus
Heft 4
Titelblatt Heft 4.1
KUNST UND KÜNSTLER
…
Kunst. II..........140
…
KUNST
…
für Wandbespannung und Möbel.
…
KUNST UND KÜNSTLER
…
Kunst. II..........140
…
KUNST
…
für Wandbespannung und Möbel.
148
auch ich liebe die Kunst. Meine Eltern besitzen
…
Sisley und Cezanne für die besten halten."
…
Museum gelangen. Auf Ehrenplätze. Wenn Werke
…
Preise für solche Bilder gezahlt."
…
auch ich liebe die Kunst. Meine Eltern besitzen
…
Sisley und Cezanne für die besten halten."
…
Museum gelangen. Auf Ehrenplätze. Wenn Werke
…
Preise für solche Bilder gezahlt."
150
tosenden Orchester der Tintorettoschen Kunst auf;
…
sance in ihrer Kunst so wenig Stellung zum Kriege,
…
tosenden Orchester der Tintorettoschen Kunst auf;
…
sance in ihrer Kunst so wenig Stellung zum Kriege,
152
der Aufgabe entzogen, teilnahmlos für die Welt-
…
für die Seele des Geschützes gehen auf ihn zurück,
…
ausnutzte, ist er wenigstens ein Vorläufer für die
…
der Aufgabe entzogen, teilnahmlos für die Welt-
…
für die Seele des Geschützes gehen auf ihn zurück,
…
ausnutzte, ist er wenigstens ein Vorläufer für die
154
von Imhoff: Albrecht Dürer in seiner Bedeutung für die
…
von Imhoff: Albrecht Dürer in seiner Bedeutung für die
155
Illustration für sie, sind dann die einzigen
…
ab für sein grosses Interesse für die Artillerie.
…
gerettet, das für sie zeitlos war, oder sich ein
…
können, inwieweit für die Entwicklung des Barock-
…
Hauptcharakterzug der Kunst ein kriegerischer,
…
Illustration für sie, sind dann die einzigen
…
ab für sein grosses Interesse für die Artillerie.
…
gerettet, das für sie zeitlos war, oder sich ein
…
können, inwieweit für die Entwicklung des Barock-
…
Hauptcharakterzug der Kunst ein kriegerischer,
156
wenig davon spürbar ist. Die Kunst geht ihre eigenen
…
wenig davon spürbar ist. Die Kunst geht ihre eigenen
158
in einer Wildheit, wie sie bis dahin in der Kunst
…
der damaligen Kunst. Wenn die „Einnahme von
…
risches Gebiet für sich das Genre der „Kriegsgrcuel"
…
tenmalerei selbst für ihn, den so ganz Modernen,
…
in einer Wildheit, wie sie bis dahin in der Kunst
…
der damaligen Kunst. Wenn die „Einnahme von
…
risches Gebiet für sich das Genre der „Kriegsgrcuel"
…
tenmalerei selbst für ihn, den so ganz Modernen,
159
nicht nur für seine Tapferkeit vor dem Feind, sondern auch
…
nicht nur für seine Tapferkeit vor dem Feind, sondern auch
161
Wir hielten sofort, riefen für einen Augenblick
…
Wir hielten sofort, riefen für einen Augenblick
164
führen!" Und das für einen jungen Offizier wund er-
…
die Kugel, die für dich gegossen ist, wird dich
…
führen!" Und das für einen jungen Offizier wund er-
…
die Kugel, die für dich gegossen ist, wird dich
165
dahinter, Schritt für Schritt vor. In jedem Hause
…
dahinter, Schritt für Schritt vor. In jedem Hause
166
halbes Glas für die gänzlich ausgetrocknete Kehle
…
erzählt, sondern als Vorbereitung für die Eindrücke
…
halbes Glas für die gänzlich ausgetrocknete Kehle
…
erzählt, sondern als Vorbereitung für die Eindrücke
167
den wir längst, samt seinen Soldaten, für verloren
…
und wie fürchterlich für uns das Warten auf diesen
…
den wir längst, samt seinen Soldaten, für verloren
…
und wie fürchterlich für uns das Warten auf diesen
168
Abzugsstrasse für uns nach Chatelet in Frage käme.
…
Abzugsstrasse für uns nach Chatelet in Frage käme.
170
und für heute haben wir Luft, wir können im
…
Biwakplätze, wir haben Stroh für uns und Heu
…
Häfen überging, der Gang der Zeit für Brügge ge-
…
und für heute haben wir Luft, wir können im
…
Biwakplätze, wir haben Stroh für uns und Heu
…
Häfen überging, der Gang der Zeit für Brügge ge-
…
und für heute haben wir Luft, wir können im
…
Biwakplätze, wir haben Stroh für uns und Heu
…
Häfen überging, der Gang der Zeit für Brügge ge-
173
schlossen, hat an der einen Seite ein gewaltiges, für
…
schlossen, hat an der einen Seite ein gewaltiges, für
176
bekommen haben, kochen für uns Mittag; wir liefern
…
bekommen haben, kochen für uns Mittag; wir liefern
180a
War es nicht Schande für euch, wenn unter den vordersten Kämpfern,
…
War es nicht Schande für euch, wenn unter den vordersten Kämpfern,
181
man für die Leute sorgen, Appelle usw. usw., schliess-
…
gelaufen, bergauf, bergab. Eine Mordsleistung für
…
man für die Leute sorgen, Appelle usw. usw., schliess-
…
gelaufen, bergauf, bergab. Eine Mordsleistung für
186
den Bayern zur Strafe für
…
Neulich hatte ich einen Tag Urlaub für S., um
…
den Bayern zur Strafe für
…
Neulich hatte ich einen Tag Urlaub für S., um
189
war sein Verhältnis zur Kunst unserer Tage ein Gegen-
…
Teil seiner Sammelthätigkeit ein Schrittmachertum für
…
rote Tuch für die grösste Schaar derer, die um jeden
…
mannigfach Problematische der Kunst unserer Tage,
…
war sein Verhältnis zur Kunst unserer Tage ein Gegen-
…
Teil seiner Sammelthätigkeit ein Schrittmachertum für
…
rote Tuch für die grösste Schaar derer, die um jeden
…
mannigfach Problematische der Kunst unserer Tage,
190
zu Fall entscheiden können. Dass ein Museum von dem
…
zutage, in einem deutschen Museum der deutschen
…
der im Kampfstand für die Kunst unserer Tage, ging
…
zu Fall entscheiden können. Dass ein Museum von dem
…
zutage, in einem deutschen Museum der deutschen
…
der im Kampfstand für die Kunst unserer Tage, ging
191
Kunst aus, nicht weil er lockere, zufällige, mehr oder
…
jenseits aller Kunst stehend, war die tiefere, ergänzende
…
das in seinem ausgesprochenen Sinn für alles Formale,
…
Ein Ersatz für ihn wird unter den mannigfachen be-
…
handlung über „Die Moderne im Wallraf-Richartz-Museum"
…
Kunst aus, nicht weil er lockere, zufällige, mehr oder
…
jenseits aller Kunst stehend, war die tiefere, ergänzende
…
das in seinem ausgesprochenen Sinn für alles Formale,
…
Ein Ersatz für ihn wird unter den mannigfachen be-
…
handlung über „Die Moderne im Wallraf-Richartz-Museum"
192
zur Errichtung eines Denkmals für Peter von Cornelius,
…
Kunst und Leben, 1 9 1 5. Ein Kalender mit 53
…
Ideoplastische Kunst. Ein Vortrag von Max
…
in der christlichen Kunst von Walter Rethes, Köln. Ver-
…
Ministerium für Kultus und Unterricht. Wien 1915.
…
zur Errichtung eines Denkmals für Peter von Cornelius,
…
Kunst und Leben, 1 9 1 5. Ein Kalender mit 53
…
Ideoplastische Kunst. Ein Vortrag von Max
…
in der christlichen Kunst von Walter Rethes, Köln. Ver-
…
Ministerium für Kultus und Unterricht. Wien 1915.
Heft 5
Titelblatt Heft 5.1
KUNST UND KÜNSTLER
…
KUNST
…
Werkstätten für Inneneinrichtung
…
KUNST UND KÜNSTLER
…
KUNST
…
Werkstätten für Inneneinrichtung
195
seits stehende Kunst. Das war gleicherweise so
…
ihre Kunst ist heute noch lebendig wie am ersten
…
dige Kunst und die herrschende Kunst waren um
…
kunst, die sich eben damals als „Kunst für Alle"
…
seits stehende Kunst. Das war gleicherweise so
…
ihre Kunst ist heute noch lebendig wie am ersten
…
dige Kunst und die herrschende Kunst waren um
…
kunst, die sich eben damals als „Kunst für Alle"
196
ist nun aber allein wichtig für die Frage, wie der
…
wirkt hat. Für die Kunstgeschichte existiert dieser
…
schlossen war, ist Menzels Kunst friedlicher gewesen
…
Kunst war gerade in dieser bewegten Zeit voll
…
ziehungen zur französischen Kunst, verkörpert vor
…
seiner Kunst und setzte ihn in den Stand in den
…
ist nun aber allein wichtig für die Frage, wie der
…
wirkt hat. Für die Kunstgeschichte existiert dieser
…
schlossen war, ist Menzels Kunst friedlicher gewesen
…
Kunst war gerade in dieser bewegten Zeit voll
…
ziehungen zur französischen Kunst, verkörpert vor
…
seiner Kunst und setzte ihn in den Stand in den
200
rinnen" fand. Der Krieg und seine Kunst waren
…
Kunst hat er eine Erschütterung, eine Änderung
…
rinnen" fand. Der Krieg und seine Kunst waren
…
Kunst hat er eine Erschütterung, eine Änderung
205
den „Steinklopfern" der Kunst dienstbar gemacht
…
hinreichend, dass zwischen der echten Kunst und
…
den „Steinklopfern" der Kunst dienstbar gemacht
…
hinreichend, dass zwischen der echten Kunst und
206
das Verhältnis zwischen Krieg und Kunst immer so
…
hat ein politisches Faktum daraus gemacht. Für die
…
1 8 13 gewesen. Darum hat er in der Kunst auch
…
ist zwar nicht eben eine gute Kunst im höchsten
…
das Verhältnis zwischen Krieg und Kunst immer so
…
hat ein politisches Faktum daraus gemacht. Für die
…
1 8 13 gewesen. Darum hat er in der Kunst auch
…
ist zwar nicht eben eine gute Kunst im höchsten
208
mehr von denen im Feld, die als Kunst- und Kultur-
…
nicht ein Ende, als leite er für die Deutschen eine
…
es, dass die Kunst sich heute auf einer ganz andern
…
für die deutsche, für die europäische Malerei geben.
…
mehr von denen im Feld, die als Kunst- und Kultur-
…
nicht ein Ende, als leite er für die Deutschen eine
…
es, dass die Kunst sich heute auf einer ganz andern
…
für die deutsche, für die europäische Malerei geben.
210
talen, die europäische Kunst beherrschenden Stil der
…
talen, die europäische Kunst beherrschenden Stil der
211
Organ der lebendigen Kunst sich dem Strom dieser
…
druck für ein neues, unter dem Prestige des deutschen
…
Augen für diese Notwendigkeit das grosse alt-
…
mehr zerrissenen Kunst, in der das Talent allein
…
Organ der lebendigen Kunst sich dem Strom dieser
…
druck für ein neues, unter dem Prestige des deutschen
…
Augen für diese Notwendigkeit das grosse alt-
…
mehr zerrissenen Kunst, in der das Talent allein
217
richtet und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.
…
richtet und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.
218
vieles, es muss für alles ein mit einem Bataillons-
…
Nacht zunehmend für uns. Ich las dazu Homer und
…
alles Verfügbare herangeschafft worden für einen
…
vieles, es muss für alles ein mit einem Bataillons-
…
Nacht zunehmend für uns. Ich las dazu Homer und
…
alles Verfügbare herangeschafft worden für einen
220
müssen viel arbeiten, um die Unterstände für den
…
müssen viel arbeiten, um die Unterstände für den
221
tung für einen Infanterieangriff.
…
Spalier. Viel Sinn für Architektur, die an italieni-
…
tung für einen Infanterieangriff.
…
Spalier. Viel Sinn für Architektur, die an italieni-
223
die Riesenpakete für die Mannschaften mit Wöll-
…
an die Liebesgaben für die Leute zu ordnen und
…
die Riesenpakete für die Mannschaften mit Wöll-
…
an die Liebesgaben für die Leute zu ordnen und
225
frostige, leere Allegorie. Er passte für einen Helden-
…
für ihre Totentänze verwandten, den Rethel, Klinger,
…
frostige, leere Allegorie. Er passte für einen Helden-
…
für ihre Totentänze verwandten, den Rethel, Klinger,
227
einem für viele neuen
…
Jass. Seine Kunst ist
…
graphie für seine Kunst wenig hergeleitet werden.
…
und belebend auf ihre Kunst gewirkt hat, das war
…
einem für viele neuen
…
Jass. Seine Kunst ist
…
graphie für seine Kunst wenig hergeleitet werden.
…
und belebend auf ihre Kunst gewirkt hat, das war
228
Und doch ist die Kunst Altheims frankfurte-
…
frankfurterisch ist seine Kunst, rauh wie sein Schick-
…
Und doch ist die Kunst Altheims frankfurte-
…
frankfurterisch ist seine Kunst, rauh wie sein Schick-
232
der Knaben, ihre Zeichnungen seien Kunst, von selbst
…
der Knaben, ihre Zeichnungen seien Kunst, von selbst
235
jener blühenden deutschen Städte. Zur Vergeltung für
…
losen Zerstörung für alle Zeiten zu bewahren. Augustin
…
jener blühenden deutschen Städte. Zur Vergeltung für
…
losen Zerstörung für alle Zeiten zu bewahren. Augustin
236
für Kunstwerke kennen wollen, wo Menschenleben auf
…
deutschen Kunst erhalten worden sind. Wie wir hoffen:
…
für Kunstwerke kennen wollen, wo Menschenleben auf
…
deutschen Kunst erhalten worden sind. Wie wir hoffen:
…
für Kunstwerke kennen wollen, wo Menschenleben auf
…
deutschen Kunst erhalten worden sind. Wie wir hoffen:
237
Ein Buch, nach dem man als Geschenk für seine
…
für das ganze spätere Leben wichtig werden. Die Übun-
…
Ein Buch, nach dem man als Geschenk für seine
…
für das ganze spätere Leben wichtig werden. Die Übun-
238
Papier und Pappe, Lehren für den Linoleumdruck, An-
…
viel für die Jugend in der Schule nach dieser Richtung
…
Der Krieg und die deutsche Kunst. Von
…
Zur neuen Kunst von Adolf Behne. Verlag des
…
Papier und Pappe, Lehren für den Linoleumdruck, An-
…
viel für die Jugend in der Schule nach dieser Richtung
…
Der Krieg und die deutsche Kunst. Von
…
Zur neuen Kunst von Adolf Behne. Verlag des
Heft 6
Titelblatt Heft 6.1
KUNST UND KUNSTLER
…
Richard Engelmann: Figur für ein Wilden-
…
KUNST
…
Werkstätten für feine Bau-
…
KUNST UND KUNSTLER
…
Richard Engelmann: Figur für ein Wilden-
…
KUNST
…
Werkstätten für feine Bau-
242
druckes, zur Betonung des Besonderen, für die ein-
…
*) Kunst und Künstler, Jahrgang XIII, Heft 2.
…
druckes, zur Betonung des Besonderen, für die ein-
…
*) Kunst und Künstler, Jahrgang XIII, Heft 2.
245
befestigtes Heerlager für die Kreuzfahrer ange-
…
obwohl hier für Plan und Entwurf der Name eines
…
befestigtes Heerlager für die Kreuzfahrer ange-
…
obwohl hier für Plan und Entwurf der Name eines
246
bietend für die Aufstellung von Verteidigungsmann-
…
zu finden, die für die südliche Sinnlichkeit den In-
…
Sinne triebhaft bildenden Kunst sprechen. Vor-
…
bietend für die Aufstellung von Verteidigungsmann-
…
zu finden, die für die südliche Sinnlichkeit den In-
…
Sinne triebhaft bildenden Kunst sprechen. Vor-
249
nordischen Kunst seine schweren, ungelenken
…
wäre der, dass sie für ihre künftige Entwicklung
…
nordischen Kunst seine schweren, ungelenken
…
wäre der, dass sie für ihre künftige Entwicklung
254
den die römische Kunst schon übertrieben hatte,
…
den die römische Kunst schon übertrieben hatte,
267
Kunst und Handel eine geschichtliche Rolle spielte,
…
Kunst und Handel eine geschichtliche Rolle spielte,
268
anderer, noch grossartigerer Plan Pöppelmanns für den
…
anderer, noch grossartigerer Plan Pöppelmanns für den
271
es nicht ohne Verluste für uns ab, doch waren diese
…
es nicht ohne Verluste für uns ab, doch waren diese
273
und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.
…
und für „Kunst und Künstler" zusammengestellt worden.
276
kleine Bescherung vorher für die Burschen. Jeder
…
kleine Bescherung vorher für die Burschen. Jeder
278
Oder gewiss das rechte Geisterwort für so grotesken
…
einer witzigen Romantik gefrönt; Kunst (Schrödter) und
…
gezogen und in die ihm eigenste Welt gebannt; für
…
Oder gewiss das rechte Geisterwort für so grotesken
…
einer witzigen Romantik gefrönt; Kunst (Schrödter) und
…
gezogen und in die ihm eigenste Welt gebannt; für
279
tasie für den offiziell zugelassenen Historienmaler nur
…
das die Nation ihm in ihrer zur Kunst erwachenden Ju-
…
zweihundertjährigen Bestehens zu feiern für gut hielt.
…
tasie für den offiziell zugelassenen Historienmaler nur
…
das die Nation ihm in ihrer zur Kunst erwachenden Ju-
…
zweihundertjährigen Bestehens zu feiern für gut hielt.
280
versucht, „Gespenster" auszurufen und für die Namen
…
„Es haben sich bey derselben (der Kunst) zu Ihren
…
sich für den Künstlerberuf eine solide Grundlage anzu-
…
hiessen, ist kein Wort hinzuzufügen. Für seine Kunst-
…
für ihn nicht; der Impressionismus wuide zur Hölle
…
Kunst kam.
…
dass sein Interesse für die jüngeren Schulen nicht
…
versucht, „Gespenster" auszurufen und für die Namen
…
„Es haben sich bey derselben (der Kunst) zu Ihren
…
sich für den Künstlerberuf eine solide Grundlage anzu-
…
hiessen, ist kein Wort hinzuzufügen. Für seine Kunst-
…
für ihn nicht; der Impressionismus wuide zur Hölle
…
Kunst kam.
…
dass sein Interesse für die jüngeren Schulen nicht
281
EICHARD ENGELMANN, FIGUR FÜR EIN WILDENBRUCH-DENKMAL. BRONZE.
…
EICHARD ENGELMANN, FIGUR FÜR EIN WILDENBRUCH-DENKMAL. BRONZE.
282
werken ist dieser Schaden lokal beschränkt. Das Museum,
…
zen Beschiessung in dem Museum anwesend war, wäh-
…
lichen Turmes als Signalstation für Lichtsignale wie am
…
werken ist dieser Schaden lokal beschränkt. Das Museum,
…
zen Beschiessung in dem Museum anwesend war, wäh-
…
lichen Turmes als Signalstation für Lichtsignale wie am
284
plastisch-stereoskopischer Wirkung zumal für den, der
…
das für die noch immer im Gang befindliche Restauration
…
Kathedrale von Soissons für Lichtsignale zu benutzen,
…
Artillerie gab, für unsere Truppen gefährlich und tod-
…
plastisch-stereoskopischer Wirkung zumal für den, der
…
das für die noch immer im Gang befindliche Restauration
…
Kathedrale von Soissons für Lichtsignale zu benutzen,
…
Artillerie gab, für unsere Truppen gefährlich und tod-
285
Museum, das in der alten zweigiebeligen Boucherie
…
der Türme für die Feuerleitung, direkt gezwungen
…
Museum, das in der alten zweigiebeligen Boucherie
…
der Türme für die Feuerleitung, direkt gezwungen
286
lyse seiner Kunst, sondern mehr eine Improvisation voll
…
das ihn für das romantische Nervenpathos Delacroix'
…
lyse seiner Kunst, sondern mehr eine Improvisation voll
…
das ihn für das romantische Nervenpathos Delacroix'
287
für die moderne Kunst thut und mit unendlicher Rührig-
…
sind gut gewählt. Doch hätte viel mehr für die typo-
…
mässig aus. Was hätte sich für ein Buch der klassischen
…
für die moderne Kunst thut und mit unendlicher Rührig-
…
sind gut gewählt. Doch hätte viel mehr für die typo-
…
mässig aus. Was hätte sich für ein Buch der klassischen
288
kunst und Pädagogik sagt, ist oft recht fatal. Er ist einer
…
der Kunst des Altertums. Mit Goethes Schilderung
…
Dinge leben möchte. Seine Paraphrasen über die Kunst
…
gute Kunst zu popularisieren ohne sie zu trivialisieren,
…
schien in den 1870 er Jahren in Paris. Die . . . an-
…
zugeben, kam für sie nach damaligen Anschauungen und
…
in Zinkätzung kommen für wesentlich gleiche Nach-
…
kunst und Pädagogik sagt, ist oft recht fatal. Er ist einer
…
der Kunst des Altertums. Mit Goethes Schilderung
…
Dinge leben möchte. Seine Paraphrasen über die Kunst
…
gute Kunst zu popularisieren ohne sie zu trivialisieren,
…
schien in den 1870 er Jahren in Paris. Die . . . an-
…
zugeben, kam für sie nach damaligen Anschauungen und
…
in Zinkätzung kommen für wesentlich gleiche Nach-
Heft 7
Titelblatt Heft 7.1
KUNST UND KUNSTLER
…
KUNST
…
Max Slevogt: Kunst und Künstler im Kriege 3 3 5
…
für Kunstmöbel und ganze
…
KUNST UND KUNSTLER
…
KUNST
…
Max Slevogt: Kunst und Künstler im Kriege 3 3 5
…
für Kunstmöbel und ganze
291
mus innerhalb der gesamten deutschen Kunst — mit Aus-
…
jede ideelle Kunst. Das grosse Ziel, das hinter allen Aus-
…
mus innerhalb der gesamten deutschen Kunst — mit Aus-
…
jede ideelle Kunst. Das grosse Ziel, das hinter allen Aus-
292
kunst niemals jene allseitige Vollkommenheit wieder er-
…
unteilbaren, universalen Kunst. Höchstens in vereinzelten
…
Kunst aus und haben sich kaum
…
den Museen alter Kunst, wo die
…
kunst niemals jene allseitige Vollkommenheit wieder er-
…
unteilbaren, universalen Kunst. Höchstens in vereinzelten
…
Kunst aus und haben sich kaum
…
den Museen alter Kunst, wo die
294
Reife zu schaffen. Nie war die neuere deutsche Kunst
…
hin Kunst. Möge es imfolgenden den- (vielen zwar schon
…
Reife zu schaffen. Nie war die neuere deutsche Kunst
…
hin Kunst. Möge es imfolgenden den- (vielen zwar schon
298
für das Besondre, für die Ausübung, dadurch nichts
…
für das Besondre, für die Ausübung, dadurch nichts
303
und über die Gegenwart hinaus; für das Ganze
…
Der Realist für sich allein würde den Kreis der
…
begrenzten Wirken erblickt. Aber der Idealist für
…
und über die Gegenwart hinaus; für das Ganze
…
Der Realist für sich allein würde den Kreis der
…
begrenzten Wirken erblickt. Aber der Idealist für
304
andern einen Eingriff thun, ohne entweder für den
…
andern einen Eingriff thun, ohne entweder für den
305
grossen Begriff zu erwecken und Achtung für ihre
…
grossen Begriff zu erwecken und Achtung für ihre
311
für sich, und doch dienen sie alle einem besonderen
…
für sich, und doch dienen sie alle einem besonderen
312
Städten Deutschlands für unsere Kinder ja nur dieses
…
Städten Deutschlands für unsere Kinder ja nur dieses
320
Besten Dank für den Brief v. 28. 1. Wie man
…
wo man sein Haus bestellte, für einige Monate:
…
Besten Dank für den Brief v. 28. 1. Wie man
…
wo man sein Haus bestellte, für einige Monate:
323
aus für den Kanonendonner. Aber jetzt allerdings,
…
aus für den Kanonendonner. Aber jetzt allerdings,
327
nährung ist für diesen Tag gesichert. Am nächsten
…
für Tag die gleichen Leiden. Die Bagage kommt
…
nährung ist für diesen Tag gesichert. Am nächsten
…
für Tag die gleichen Leiden. Die Bagage kommt
330
als Europäer fühlen konnten. Die Kunst, für Aus-
…
als Europäer fühlen konnten. Die Kunst, für Aus-
334
für die gefährliche Fahrt vorbereiten. Oder Kuehl
…
diesem Landstrich zu ringen. Und für den Anfang mag
…
für die gefährliche Fahrt vorbereiten. Oder Kuehl
…
diesem Landstrich zu ringen. Und für den Anfang mag
335
preussischer Beamter. Seine Kunst war gehorsam und
…
Haltung. Seine Kunst hatte gute gesellschaftliche For-
…
passen ohne weiteres auch für unsere Tage, weil die
…
MAX SLEVOGT, KUNST UND KUNSTLER IM KRIEGE
…
preussischer Beamter. Seine Kunst war gehorsam und
…
Haltung. Seine Kunst hatte gute gesellschaftliche For-
…
passen ohne weiteres auch für unsere Tage, weil die
…
MAX SLEVOGT, KUNST UND KUNSTLER IM KRIEGE
336
zungen der deutschen Kunst nicht
…
musste. Auch das stärkste Talent der deutschen Kunst
…
zungen der deutschen Kunst nicht
…
musste. Auch das stärkste Talent der deutschen Kunst
337
messen können. Für die Technik
…
auch für die Innenzeichnung und,
…
gangspunkt für die ganze Ent-
…
Fortschritte in der Kunst nicht
…
druckskraft gewann, auch für die Gravierung zum Ge-
…
Kunst nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, im
…
messen können. Für die Technik
…
auch für die Innenzeichnung und,
…
gangspunkt für die ganze Ent-
…
Fortschritte in der Kunst nicht
…
druckskraft gewann, auch für die Gravierung zum Ge-
…
Kunst nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, im
338
wahrnehmbar. Seine Vorliebe für den mageren Bau der
…
mit delikatem Geschmack für die Schmuckwirkung ver-
…
kommenen, in sich geschlossenen, für sich allein das
…
in die monumentale Kunst, in die Kunst, die Wirklich-
…
irgendeine Sammlung von Originalen, als für die Nach-
…
liches Hilfsmittel für das Studium bilden. Wer Schon-
…
wahrnehmbar. Seine Vorliebe für den mageren Bau der
…
mit delikatem Geschmack für die Schmuckwirkung ver-
…
kommenen, in sich geschlossenen, für sich allein das
…
in die monumentale Kunst, in die Kunst, die Wirklich-
…
irgendeine Sammlung von Originalen, als für die Nach-
…
liches Hilfsmittel für das Studium bilden. Wer Schon-
Heft 8
Titelblatt Heft 8.1
KUNST UND KUNSTLER
…
KUNST
…
für Wohnungseinrichtungen und
…
KUNST UND KUNSTLER
…
KUNST
…
für Wohnungseinrichtungen und
341
des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"
…
des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"
344
haupten, dass der ganzen holländischen Kunst —
…
für die Steigerung des Künstlerischen bis zu einem
…
haupten, dass der ganzen holländischen Kunst —
…
für die Steigerung des Künstlerischen bis zu einem
348
mehr nebenbei da, wie ein Ding für den Sonntags-
…
formen. Ganz typisch für
…
mehr nebenbei da, wie ein Ding für den Sonntags-
…
formen. Ganz typisch für
350
heute belustigt: der Sinn für eine das Regelmässige
…
der Kirchenarchitektur eine Vorliebe für das Rari-
…
heute belustigt: der Sinn für eine das Regelmässige
…
der Kirchenarchitektur eine Vorliebe für das Rari-
356
ist in seiner Kunst weniger dem Verall en Ausgesetztes
…
ist in seiner Kunst weniger dem Verall en Ausgesetztes
358
Äussern seiner Kunst wenig Sonderbares und
…
quch nicht für einen grossen Maler haken, wie
…
Kunst unterrichtet, die damals in Holland bestand.
…
Kunst einweihte. Diese Begegnung machte Epoche
…
Äussern seiner Kunst wenig Sonderbares und
…
quch nicht für einen grossen Maler haken, wie
…
Kunst unterrichtet, die damals in Holland bestand.
…
Kunst einweihte. Diese Begegnung machte Epoche
360
Franzosen, mag ihm seine Liebe für Corot und Dau-
…
holländischen Kunst die Rolle Barbizons spielte
…
man für das Werk eines Süddeutschen halten. Es
…
Franzosen, mag ihm seine Liebe für Corot und Dau-
…
holländischen Kunst die Rolle Barbizons spielte
…
man für das Werk eines Süddeutschen halten. Es
362
ist der Ton. Auch Israels Kunst ist tonreich. Aber
…
ist der Ton. Auch Israels Kunst ist tonreich. Aber
364
Impressionisten, dass Studie und Bild für ihn zwei
…
seiner Kunst gleitet, der manchmal an den Humor
…
Impressionisten, dass Studie und Bild für ihn zwei
…
seiner Kunst gleitet, der manchmal an den Humor
366
Die grosse Wandlung, die Mauves Kunst in den
…
mals war seine Bewunderung für Millet sehr gross.
…
Merkwürdig und zumal für den Deutschen
…
Die grosse Wandlung, die Mauves Kunst in den
…
mals war seine Bewunderung für Millet sehr gross.
…
Merkwürdig und zumal für den Deutschen
368
Seine Kunst ist, wenn man das Wort auf die Dar-
…
hieraus,diemanin der holländischen Kunst nur noch
…
Seine Kunst ist, wenn man das Wort auf die Dar-
…
hieraus,diemanin der holländischen Kunst nur noch
369
Für die Geschichte der münchener Kunst im neun-
…
für sich gesondert und des Erfolges nicht gewärtig,
…
den Sinn für die malerische Eigenart des Interieurs
…
Für die Geschichte der münchener Kunst im neun-
…
für sich gesondert und des Erfolges nicht gewärtig,
…
den Sinn für die malerische Eigenart des Interieurs
370
wurden die Lehren der holländischen Kunst und
…
barg sich auch die der münchener Kunst immer
…
die münchener Kunst ausgezeichnet eingeführt. Er
…
wurden die Lehren der holländischen Kunst und
…
barg sich auch die der münchener Kunst immer
…
die münchener Kunst ausgezeichnet eingeführt. Er
371
tung, vortreffliches Gefühl für Raum und Atmo-
…
bei Hermann Anschütz, besuchte für einen Winter
…
von der Klarheit eines für die feinsten malerischen
…
tung, vortreffliches Gefühl für Raum und Atmo-
…
bei Hermann Anschütz, besuchte für einen Winter
…
von der Klarheit eines für die feinsten malerischen
372
keit für den Aufbau und die Einheitlichkeit der
…
an ihre Kunst aufrechtzuerhalten. Dieses „ideale
…
Leiblkreises für die münchener Kunst um 1870
…
schichte der münchener Kunst zu gewährende
…
keit für den Aufbau und die Einheitlichkeit der
…
an ihre Kunst aufrechtzuerhalten. Dieses „ideale
…
Leiblkreises für die münchener Kunst um 1870
…
schichte der münchener Kunst zu gewährende
374
für ihre Bewahrung. Jetzt feiert in ihrer Mitte, von
…
für ihre Bewahrung. Jetzt feiert in ihrer Mitte, von
376
völlig in ihren Werken verausgaben, dass sie für das
…
zu würdigen genügt es auch nicht, sein Museum zu
…
aus den Augen leuchtete. So war er in seinem Museum
…
Würde. Da sein Museum vielerlei Werte barg und die
…
mit ihm lebendig war, so erschien sein Museum nie als
…
völlig in ihren Werken verausgaben, dass sie für das
…
zu würdigen genügt es auch nicht, sein Museum zu
…
aus den Augen leuchtete. So war er in seinem Museum
…
Würde. Da sein Museum vielerlei Werte barg und die
…
mit ihm lebendig war, so erschien sein Museum nie als
377
für eine Schilde-
…
lieferter Erfahrung für feste Zwecke geschult, dem Un-
…
lebendiges Gefühl für Bedeutung, Richtung und Ziele
…
Vorbereitung für
…
für eine Schilde-
…
lieferter Erfahrung für feste Zwecke geschult, dem Un-
…
lebendiges Gefühl für Bedeutung, Richtung und Ziele
…
Vorbereitung für
378
er der für ihn vielleicht bedrohlichen Einförmigkeit der
…
ihn als Gehilfen an das Genfer Museum zu fesseln
…
Eitelbergers grosse neue Unternehmung, das Museum
…
Museums für Kunst und Gewerbe als Staatsinstitut in
…
herrliches Museum ist in höherem Grade als die meisten
…
er der für ihn vielleicht bedrohlichen Einförmigkeit der
…
ihn als Gehilfen an das Genfer Museum zu fesseln
…
Eitelbergers grosse neue Unternehmung, das Museum
…
Museums für Kunst und Gewerbe als Staatsinstitut in
…
herrliches Museum ist in höherem Grade als die meisten
379
Kunst gepflegt und gesammelt wurde, so bedeutete
…
Sammlung von Bildnissen sollte den Sinn für Bildnis-
…
dem leider fragmentarischen Werk über Kunst und
…
das hamburgische Museum. Ein höchst merkwürdiges
…
Museum des weiteren veranschaulicht, ohne dass
…
loge sein wollen — geraten für gewöhnlich auf diesem
…
Kunst gepflegt und gesammelt wurde, so bedeutete
…
Sammlung von Bildnissen sollte den Sinn für Bildnis-
…
dem leider fragmentarischen Werk über Kunst und
…
das hamburgische Museum. Ein höchst merkwürdiges
…
Museum des weiteren veranschaulicht, ohne dass
…
loge sein wollen — geraten für gewöhnlich auf diesem
380
rischer Vorzüge führte, dass er auch für die besonderen
…
nach technischen Gruppen nur für die Jugendzeit der
…
bewenden — vielleicht in dem Bewusstsein, für andere
…
Bedienung alle möglichen Herrlichkeiten alter Kunst
…
Frucht einer Kunst, die, an alten Mustern genährt, sich
…
Seinen eigentümlichen Charakter erhält das Museum
…
die wertvollste Ergänzung des Museums für ham-
…
war, stellte er voran, die bäuerliche Kunst des Land-
…
rischer Vorzüge führte, dass er auch für die besonderen
…
nach technischen Gruppen nur für die Jugendzeit der
…
bewenden — vielleicht in dem Bewusstsein, für andere
…
Bedienung alle möglichen Herrlichkeiten alter Kunst
…
Frucht einer Kunst, die, an alten Mustern genährt, sich
…
Seinen eigentümlichen Charakter erhält das Museum
…
die wertvollste Ergänzung des Museums für ham-
…
war, stellte er voran, die bäuerliche Kunst des Land-
381
zel, war das Los gefallen, zwischen der friedsamen Kunst
…
zel, war das Los gefallen, zwischen der friedsamen Kunst
382
bürgt. Und eben weil sie mehr die Kunst als ein Erleben
…
bürgt. Und eben weil sie mehr die Kunst als ein Erleben
…
bürgt. Und eben weil sie mehr die Kunst als ein Erleben
385
losigkeit des für das Hochbauwesen der Stadt Berlin
…
starker Inanspruchnahme, für die Heranziehung eines
…
Annahme gewesen wäre: für den Neubau des am Gross-
…
fähigung für die Aufgaben des modernen Industriebaues
…
kaum erwartet werden kann. Symptomatisch aber für die
…
tektenschaft hätte aufrufen und für dessen Bearbei-
…
für solche neuartigen, spezifisch modernen Bauaufgaben,
…
selbständige, für die neuen Zwecke charakteristische
…
grenzte Wettbewerb für die Berliner Grossmarkthalle
…
Jahren steht, damit eine gewisse Entschädigung für
…
losigkeit des für das Hochbauwesen der Stadt Berlin
…
starker Inanspruchnahme, für die Heranziehung eines
…
Annahme gewesen wäre: für den Neubau des am Gross-
…
fähigung für die Aufgaben des modernen Industriebaues
…
kaum erwartet werden kann. Symptomatisch aber für die
…
tektenschaft hätte aufrufen und für dessen Bearbei-
…
für solche neuartigen, spezifisch modernen Bauaufgaben,
…
selbständige, für die neuen Zwecke charakteristische
…
grenzte Wettbewerb für die Berliner Grossmarkthalle
…
Jahren steht, damit eine gewisse Entschädigung für
386
sich, sehr zum Schaden der Kunst, in der städtischen
…
dass es Qualität in der Kunst auch da giebt, wo die Form
…
durch seine Aufträge für die hamburger Kunsthalle
…
ihrer Kunst weniger durch starke schöpferische Leistun-
…
überstand, die in dieser Theorie eine Gefahr für die
…
sich, sehr zum Schaden der Kunst, in der städtischen
…
dass es Qualität in der Kunst auch da giebt, wo die Form
…
durch seine Aufträge für die hamburger Kunsthalle
…
ihrer Kunst weniger durch starke schöpferische Leistun-
…
überstand, die in dieser Theorie eine Gefahr für die
387
scher Kunst 1650—1800, Darmstadt 1914. Von Georg
…
deutsche Kunst in jenem Zeitabschnitt geleistet hat, wo
…
scher Kunst 1650—1800, Darmstadt 1914. Von Georg
…
deutsche Kunst in jenem Zeitabschnitt geleistet hat, wo
388
wittert, dass er Nonsens schreibt, eignet sich nicht für
…
wittert, dass er Nonsens schreibt, eignet sich nicht für
389
etwas hart, ohne jedes Gefühl für Ton und Valeur, das
…
fluss des Fremden auf die Kunst dieser Epoche über-
…
seinerseits die für ihn neuen und überraschenden Dinge
…
Bedenklich wird dieser Mangel an Gefühl für künst-
…
die Signatur G. M. sagt gar nichts für Marees, sondern
…
Constables gegenüber der deutschen Kunst völlig im
…
etwas hart, ohne jedes Gefühl für Ton und Valeur, das
…
fluss des Fremden auf die Kunst dieser Epoche über-
…
seinerseits die für ihn neuen und überraschenden Dinge
…
Bedenklich wird dieser Mangel an Gefühl für künst-
…
die Signatur G. M. sagt gar nichts für Marees, sondern
…
Constables gegenüber der deutschen Kunst völlig im
390
Marees und Meytens umschreiben jeder für sich Höhe-
…
gen nicht für die Lösung so grosser Aufgaben, mit
…
Mitteilungen der Königlichen Akademie für
…
Marees und Meytens umschreiben jeder für sich Höhe-
…
gen nicht für die Lösung so grosser Aufgaben, mit
…
Mitteilungen der Königlichen Akademie für
Heft 9
396
Violett und Blau ist für die Malerei noch jungfräu-
…
Violett und Blau ist für die Malerei noch jungfräu-
398
Sondern mit einem geläuterten Gefühl für Gleich-
…
Sondern mit einem geläuterten Gefühl für Gleich-
402
Sinn für Form, ist sicherer und grösser geworden,
…
Sinn für Form, ist sicherer und grösser geworden,
407
macht. Sein Wunsch ist ihm durch den Ankauf 1er und dem Museum.
…
macht. Sein Wunsch ist ihm durch den Ankauf 1er und dem Museum.
408
für die folgenden Bemerkungen. Dieses ist auch die
…
kennung dessen, was Deutschland fremder Kunst
…
karge Reihe! Alles Posten für sich, zumeist so
…
für die folgenden Bemerkungen. Dieses ist auch die
…
kennung dessen, was Deutschland fremder Kunst
…
karge Reihe! Alles Posten für sich, zumeist so
409
sche Bedeutung mit seiner Zeit und für sie; die fort-
…
sche Bedeutung mit seiner Zeit und für sie; die fort-
410
für den überraschten Künstler und für die Welt;
…
Helfer für die ununterbrochene Ergiessung des
…
für den überraschten Künstler und für die Welt;
…
Helfer für die ununterbrochene Ergiessung des
412
lungen Liebermannscher Kunst, man bringe Werke
…
Er hat einst unserer Kunst den Weg nach Frankreich
…
begann da, wo alle moderne Kunst begonnen hat:
…
Liebermann aber trat der Helote in die Kunst ein,
…
er eine bestimmte Vorliebe für die schweren, halb-
…
lungen Liebermannscher Kunst, man bringe Werke
…
Er hat einst unserer Kunst den Weg nach Frankreich
…
begann da, wo alle moderne Kunst begonnen hat:
…
Liebermann aber trat der Helote in die Kunst ein,
…
er eine bestimmte Vorliebe für die schweren, halb-
413
— die Poesie. Für das „Genre" setzte er das Leben
…
— die Poesie. Für das „Genre" setzte er das Leben
414
Kunst zu höchster und tiefster Ausdrucksfähigkeit
…
Kunst zu höchster und tiefster Ausdrucksfähigkeit
417
gnügens, ästhetischer Reizungen, auch für kom-
…
er sozusagen für Europa entdeckt. Dieser keck Ge-
…
ftönen: für gewöhnlich aber zog er unbekümmert
…
masse — für jeden etwas mitgebracht hatte. Wie
…
gnügens, ästhetischer Reizungen, auch für kom-
…
er sozusagen für Europa entdeckt. Dieser keck Ge-
…
ftönen: für gewöhnlich aber zog er unbekümmert
…
masse — für jeden etwas mitgebracht hatte. Wie
418
wie Ungesammeltheit wirkte. Für die Unter-
…
Für Corinths Art entscheidend wurde die zeich-
…
wie Ungesammeltheit wirkte. Für die Unter-
…
Für Corinths Art entscheidend wurde die zeich-
420
Diese Welt hatte nichts für ihn, was nicht mal-
…
zurückgeht. Er treibt zunächst also Kunst auf ma-
…
men. Und für ihn als Künstler sind sie Lebens- und
…
visionär; kurz, er übt alle die Tonarten, für
…
Diese Welt hatte nichts für ihn, was nicht mal-
…
zurückgeht. Er treibt zunächst also Kunst auf ma-
…
men. Und für ihn als Künstler sind sie Lebens- und
…
visionär; kurz, er übt alle die Tonarten, für
421
des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"
…
des „Deutschen Museums für Kunst im Handel und Gewerbe"
422
Grundstücke sind charakteristisch für alle nordischen
…
für die Bewohner wurde oder als
…
Grundstücke sind charakteristisch für alle nordischen
…
für die Bewohner wurde oder als
431
Das gilt nicht nur für die Städte, sondern auch
…
Das gilt nicht nur für die Städte, sondern auch
432
„erledigen". Was damit für Wirkungen aber zu
…
meinsamen ist jede eine kleine reizvolle Welt für
…
dann ist jede Stadt eine besondere Landschaft für
…
„erledigen". Was damit für Wirkungen aber zu
…
meinsamen ist jede eine kleine reizvolle Welt für
…
dann ist jede Stadt eine besondere Landschaft für
434
Im Städtischen Museum hat der
…
Künstler Interesse für die neuste Entwicklung derhollän-
…
Kunst oft vermissen lassen. Die spanischen Bilder und
…
würfe für Giebelsteine sind sehr skizzenhaft. Sie lassen
…
Im Städtischen Museum hat der
…
Künstler Interesse für die neuste Entwicklung derhollän-
…
Kunst oft vermissen lassen. Die spanischen Bilder und
…
würfe für Giebelsteine sind sehr skizzenhaft. Sie lassen
Heft 10
Titelblatt Heft 10.1
KUNST UND KÜNSTLER
…
KUNST
…
für Möbel und feine Bautischlerei
…
KUNST UND KÜNSTLER
…
KUNST
…
für Möbel und feine Bautischlerei
438
pano, für die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen,
…
für das, wofür sie den Italienern galten. In seinen
…
pano, für die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen,
…
für das, wofür sie den Italienern galten. In seinen
439
Bezeichnung für eine dem Renaissancegeiste fremde
…
antica" und die Kunst der tedeschi und moderni;
…
der Völkerwanderungszeit für die Zerstörung der
…
zugleich mit den Gebäuden auch die Kunst des
…
Architektur verdanken, für zwei bestimmte, späte
…
ausgeschöpfte Quelle für die Künstlerbiographen
…
Sprache über Kunst schrieb, seine „Teutsche Aka-
…
Kolorismus für Rubens und die Venezianer eintrat,
…
ausschliesslich ruht, erwacht das Interesse für ein
…
Bezeichnung für eine dem Renaissancegeiste fremde
…
antica" und die Kunst der tedeschi und moderni;
…
der Völkerwanderungszeit für die Zerstörung der
…
zugleich mit den Gebäuden auch die Kunst des
…
Architektur verdanken, für zwei bestimmte, späte
…
ausgeschöpfte Quelle für die Künstlerbiographen
…
Sprache über Kunst schrieb, seine „Teutsche Aka-
…
Kolorismus für Rubens und die Venezianer eintrat,
…
ausschliesslich ruht, erwacht das Interesse für ein
440
sierung der neueren Kunst zwischen der „deca-
…
fungen einer barbarisch gescholtenen Kunst. So
…
ständnis für altdeutsche Kunst bewiesen hatte, ver-
…
sierung der neueren Kunst zwischen der „deca-
…
fungen einer barbarisch gescholtenen Kunst. So
…
ständnis für altdeutsche Kunst bewiesen hatte, ver-
441
Türmen, wächst wahre Kunst hervor." — Auch in
…
ein für allemal erledigt, die politische aber scheint
…
Türmen, wächst wahre Kunst hervor." — Auch in
…
ein für allemal erledigt, die politische aber scheint
442
Tafeln für die Namen der Toten. Noch ein
…
befriedigen, und gerade für die Grabstätte oder das
…
die Tradition, die sonst in der Kunst, zu ihrem Heil,
…
Tafeln für die Namen der Toten. Noch ein
…
befriedigen, und gerade für die Grabstätte oder das
…
die Tradition, die sonst in der Kunst, zu ihrem Heil,
446
tung zeigt (Kunst und Künstler XIII, z,
…
Smyrna (Kunst und Künstler XIII, z,
…
Kunst sind die Grenzen des Reliefbildes
…
von Knidos, jetzt im Britischen Museum, wäh-
…
tung zeigt (Kunst und Künstler XIII, z,
…
Smyrna (Kunst und Künstler XIII, z,
…
Kunst sind die Grenzen des Reliefbildes
…
von Knidos, jetzt im Britischen Museum, wäh-
448
wie der eherne Dreifuss in Delphi, der Dank für
…
Wir haben nicht einmal mehr ein Gefühl für
…
sich auch für uns
…
wie der eherne Dreifuss in Delphi, der Dank für
…
Wir haben nicht einmal mehr ein Gefühl für
…
sich auch für uns
451
Beispiel für dessen überlegenes Können. Aber seine
…
die auch für das Vernetbuch gearbeitet hatte.
…
Beispiel für dessen überlegenes Können. Aber seine
…
die auch für das Vernetbuch gearbeitet hatte.
452
kam im Februar 1839 zustande. Für vierhundert
…
renzunternehmungen für das historische Jahr waren
…
kam im Februar 1839 zustande. Für vierhundert
…
renzunternehmungen für das historische Jahr waren
455
das für das dritte Kapitel
…
trauen? für solche rohe
…
das für das dritte Kapitel
…
trauen? für solche rohe
456
Einen Ersatz für die
…
Für das illustrierte deutsche Buch beginnt mit
…
natürlichen Federstrich für eine handwerkliche Be-
…
Einen Ersatz für die
…
Für das illustrierte deutsche Buch beginnt mit
…
natürlichen Federstrich für eine handwerkliche Be-
457
Wärme sich zu eigen machten, das spricht für ihre
…
Wärme sich zu eigen machten, das spricht für ihre
458
für das Buch Partei. Es machte
…
seine Arbeiten für das Buch ab-
…
für das Buch Partei. Es machte
…
seine Arbeiten für das Buch ab-
459
grosse Kunst, das fertige Kunstwerk auf einfache
…
grosse Kunst, das fertige Kunstwerk auf einfache
460
mente. Für solche war Menzel immer feurig inter-
…
belegen, die für die Beurteilung seiner scharf sil-
…
wurde er, wie oben gesagt, für Jahre durch die
…
mente. Für solche war Menzel immer feurig inter-
…
belegen, die für die Beurteilung seiner scharf sil-
…
wurde er, wie oben gesagt, für Jahre durch die
468
speziell einheimischer Kunst sich noch in holländischem
…
Teil des Mauritshausmuseums, für viele dessen schön-
…
Kunst umfasst, führt eigentlich erst die Bausteine vor,
…
für Werke Rembrandts galten.
…
speziell einheimischer Kunst sich noch in holländischem
…
Teil des Mauritshausmuseums, für viele dessen schön-
…
Kunst umfasst, führt eigentlich erst die Bausteine vor,
…
für Werke Rembrandts galten.
471
Es ist ein Christuskopf, eine Studie für
…
für den Leidener Maler typische Figur,
…
Es ist ein Christuskopf, eine Studie für
…
für den Leidener Maler typische Figur,
472
Selbständigkeit gediehenen Kunst.
…
Steens, er kann aber für sich den Ruhm in Anspruch
…
Selbständigkeit gediehenen Kunst.
…
Steens, er kann aber für sich den Ruhm in Anspruch
475
venezianischer Kunst nennen könnte. Der Wert der
…
eine gezeichnete Studie für den barmherzigen Samariter
…
leidenschaftlich. Aber schon die Vorliebe für Felsen-
…
heissungsvolle Möglichkeiten für eine freie Entwicke-
…
venezianischer Kunst nennen könnte. Der Wert der
…
eine gezeichnete Studie für den barmherzigen Samariter
…
leidenschaftlich. Aber schon die Vorliebe für Felsen-
…
heissungsvolle Möglichkeiten für eine freie Entwicke-
…
venezianischer Kunst nennen könnte. Der Wert der
…
eine gezeichnete Studie für den barmherzigen Samariter
…
leidenschaftlich. Aber schon die Vorliebe für Felsen-
…
heissungsvolle Möglichkeiten für eine freie Entwicke-
476
voll angelegten vielumfeindeten Plakat für die nürn-
…
für seine Kunst entscheidend. Schon auf der Sommer-
…
schaft für später ihm und seinen Genossen gesichert.
…
voll angelegten vielumfeindeten Plakat für die nürn-
…
für seine Kunst entscheidend. Schon auf der Sommer-
…
schaft für später ihm und seinen Genossen gesichert.
477
Wer sich jetzt mit der Kunst beschäftigt, thut es, in-
…
Wer sich jetzt mit der Kunst beschäftigt, thut es, in-
478
darum besser für alle Teile, wenn solche aussichtslosen
…
illustrierten Aufsatz über Buris Kunst von Joh. Widmer
…
lebensgross. Die Farben sind: ein fahles Rosa für das
…
darum besser für alle Teile, wenn solche aussichtslosen
…
illustrierten Aufsatz über Buris Kunst von Joh. Widmer
…
lebensgross. Die Farben sind: ein fahles Rosa für das
479
worden, um Gott weiss was für einem modernen Mach-
…
Worte für eine Stadtverwaltung zu finden, die so un-
…
Durch einen Irrtum des „Deutschen Museums für
…
staltete Ausstellung deutscher Kunst i6j0—1800 ge-
…
worden, um Gott weiss was für einem modernen Mach-
…
Worte für eine Stadtverwaltung zu finden, die so un-
…
Durch einen Irrtum des „Deutschen Museums für
…
staltete Ausstellung deutscher Kunst i6j0—1800 ge-
480
über die Prinzipien bei der Sichtung des Materials für
…
über die Prinzipien bei der Sichtung des Materials für
482
angespornt fühlen, ihr Bestes zu geben, indem sie für
…
mainzer Kunst. Herausgegeben von Erwin Hensler.
…
Mehrzahl mit mittelrheinischer Kunst und demgemäss
…
angespornt fühlen, ihr Bestes zu geben, indem sie für
…
mainzer Kunst. Herausgegeben von Erwin Hensler.
…
Mehrzahl mit mittelrheinischer Kunst und demgemäss
483
dass Kunst und Wissenschaft innerhalb Europas stets ein
…
hat Wien die deutsche Kunst vorwiegend beherbergt
…
dass Kunst und Wissenschaft innerhalb Europas stets ein
…
hat Wien die deutsche Kunst vorwiegend beherbergt
484
„Wie werden die Landschaften für den zugleich Wissen-
…
wie die Kunst es sich nur wünschen kann. Insbesondere
…
Rhythmus, Kunst, Natur von Oswald Herzog.
…
„Wie werden die Landschaften für den zugleich Wissen-
…
wie die Kunst es sich nur wünschen kann. Insbesondere
…
Rhythmus, Kunst, Natur von Oswald Herzog.
Heft 11
Titelblatt Heft 11.1
KUNST UND KUNSTLER
…
Ludwig Burchard: Werke alter Kunst aus
…
Carl Petersen: Museum in Faaborg
…
KUNST
…
für Möbel und feine Bautischlerei
…
KUNST UND KUNSTLER
…
Ludwig Burchard: Werke alter Kunst aus
…
Carl Petersen: Museum in Faaborg
…
KUNST
…
für Möbel und feine Bautischlerei
487
NOTIZEN ZU REMBRANDTS KUNST
…
Kunst dieses Einzigartigen noch immer nicht eine
…
die die Kunst des grossen Holländers bietet, wirk-
…
die wachsende Verinnerlichung seiner Kunst, die
…
mit der italienischen Kunst zu erforschen. Allein,
…
lienischen Kellerlichtmalerei für Holland und so-
…
italienischen Kunst entnommen habe, mit der blo-
…
NOTIZEN ZU REMBRANDTS KUNST
…
Kunst dieses Einzigartigen noch immer nicht eine
…
die die Kunst des grossen Holländers bietet, wirk-
…
die wachsende Verinnerlichung seiner Kunst, die
…
mit der italienischen Kunst zu erforschen. Allein,
…
lienischen Kellerlichtmalerei für Holland und so-
…
italienischen Kunst entnommen habe, mit der blo-
491
Über den Dualismus in Rembrandts Kunst,
…
Kunst dieses Meisters wird, desto mehr wird in
…
Für die dreissiger Jahre sehr bezeichnend ist das
…
Über den Dualismus in Rembrandts Kunst,
…
Kunst dieses Meisters wird, desto mehr wird in
…
Für die dreissiger Jahre sehr bezeichnend ist das
492
fremdlich für Rembrandt. Es ist nicht ganz die
…
der Hand, wie sie sonst die venezianische Kunst
…
wendete Motiv für einen Rembrandt recht billig
…
fremdlich für Rembrandt. Es ist nicht ganz die
…
der Hand, wie sie sonst die venezianische Kunst
…
wendete Motiv für einen Rembrandt recht billig
495
Ich könnte noch, als Beispiel für eine andere
…
Museum (um 1658/59) miteinander vergleichen,
…
Engel" im Berliner Kaiser Friedrich-Museum, bei
…
dern auch für die reine Bildkritik von grösster
…
weisen. Das Bild, das von denen, die es für einen
…
herausgreifende Hand des Alten für die Zeit, in
…
Ich könnte noch, als Beispiel für eine andere
…
Museum (um 1658/59) miteinander vergleichen,
…
Engel" im Berliner Kaiser Friedrich-Museum, bei
…
dern auch für die reine Bildkritik von grösster
…
weisen. Das Bild, das von denen, die es für einen
…
herausgreifende Hand des Alten für die Zeit, in
496
gemeinen der dänischen Kunst eigen ist, macht
…
pietätvolle Sympathie für ältere Bauformen. Ent-
…
gemeinen der dänischen Kunst eigen ist, macht
…
pietätvolle Sympathie für ältere Bauformen. Ent-
497
weder für solche, die dazu beitragen, unserm Land
…
oder für solche, die das eigentümliche Stadtbild
…
und Werke vorführen, die als massgebend für die
…
voll für die betreffenden Schiedsrichter als für die
…
weder für solche, die dazu beitragen, unserm Land
…
oder für solche, die das eigentümliche Stadtbild
…
und Werke vorführen, die als massgebend für die
…
voll für die betreffenden Schiedsrichter als für die
498
für die Gruppe der „freien Architekten", grosse
…
wickelt und vervollkommnet. Die antike Kunst oder
…
Für Jensen Klint selbst war namentlich unsere
…
als Sieger in der Konkurrenz für ein Grundtvig-
…
einem grösseren Kirchenentwurf, für die Stadt
…
für die Gruppe der „freien Architekten", grosse
…
wickelt und vervollkommnet. Die antike Kunst oder
…
Für Jensen Klint selbst war namentlich unsere
…
als Sieger in der Konkurrenz für ein Grundtvig-
…
einem grösseren Kirchenentwurf, für die Stadt
500
zwischen diesen Fenstern grosse Kamine, deren offenbarten, mussten einen sympathisch für den
…
zwischen diesen Fenstern grosse Kamine, deren offenbarten, mussten einen sympathisch für den
501
Entwürfe seine Fähigkeit und seinen Sinn auch für
…
Entwürfe seine Fähigkeit und seinen Sinn auch für
502
Unter den intelligentesten und feinsten Kunst- lichkeit bürgt immer dafür, dass er nie Leicht-
…
Unter den intelligentesten und feinsten Kunst- lichkeit bürgt immer dafür, dass er nie Leicht-
503
wichtigen Sinn für die vor-
…
sten Umgebung für sein
…
Museum in Faeborg.
…
Museum aber. Es liegt in einer kleinen Provinz-
…
wichtigen Sinn für die vor-
…
sten Umgebung für sein
…
Museum in Faeborg.
…
Museum aber. Es liegt in einer kleinen Provinz-
504
Der Ort liegt reizend. Das Museum enthält eine
…
dänische Kunst kennen zu lernen, aber auch der
…
Der Ort liegt reizend. Das Museum enthält eine
…
dänische Kunst kennen zu lernen, aber auch der
505
mehr und mehr für einen Namen, der bis jetzt
…
schen Kunst als ein zwar nicht sehr bedeutender,
…
mehr und mehr für einen Namen, der bis jetzt
…
schen Kunst als ein zwar nicht sehr bedeutender,
506
ist das nur für ein Zeichner, von dem Sie so viele
…
So ist es mir oft gegangen, wenn ich für
…
ist das nur für ein Zeichner, von dem Sie so viele
…
So ist es mir oft gegangen, wenn ich für
507
Literatur, Kunst und Kultur sind
…
Von ihm kommen für uns
…
für den merkwürdigen Künstler,
…
Tschudi hat ihn für einen Dilet-
…
sens der Künstler und Schriftsteller; aber für in der er es sagte: aber ein natürlicher Geschmack
…
Literatur, Kunst und Kultur sind
…
Von ihm kommen für uns
…
für den merkwürdigen Künstler,
…
Tschudi hat ihn für einen Dilet-
…
sens der Künstler und Schriftsteller; aber für in der er es sagte: aber ein natürlicher Geschmack
508
Gehen wir aber zu dem über, was für eine
…
1 848 aber gab in der Politik den Ausdruck für Ge-
…
Gehen wir aber zu dem über, was für eine
…
1 848 aber gab in der Politik den Ausdruck für Ge-
509
das Beste, was die mehr dichterische Kunst der
…
nentem Reiz für die Kinder ist. Aber in seiner
…
Verständnis der Kinder für diese Illustrationen
…
für die Mehrzahl seiner Illustrationen zu haben.
…
alles andre eher als für Lektüre durch Kinder ge-
…
zahl den Zweck nicht mehr erfüllen, für den
…
das Beste, was die mehr dichterische Kunst der
…
nentem Reiz für die Kinder ist. Aber in seiner
…
Verständnis der Kinder für diese Illustrationen
…
für die Mehrzahl seiner Illustrationen zu haben.
…
alles andre eher als für Lektüre durch Kinder ge-
…
zahl den Zweck nicht mehr erfüllen, für den
510
götzen und, was für uns die Hauptsache, künst-
…
ihrer Art für die Geschichte der deutschen Gra-
…
den Heftchen zu vergleichen, dann ergiebt sich für
…
götzen und, was für uns die Hauptsache, künst-
…
ihrer Art für die Geschichte der deutschen Gra-
…
den Heftchen zu vergleichen, dann ergiebt sich für
512
ist sogar für Pocci ungewöhnlich reizend. Nament-
…
bücher heraus, für Soldaten,
…
ist sogar für Pocci ungewöhnlich reizend. Nament-
…
bücher heraus, für Soldaten,
513
ihrer wertvollsten Mitarbeiter. Für uns ist heute
…
ihrer wertvollsten Mitarbeiter. Für uns ist heute
514
stilbildende Kraft der romantischen Kunst sich
…
scheinbar nervlosen Kunst gelten. Mit den Zier-
…
sie bedeuten nicht wenig gerade für die hübschen
…
herausgegeben, wenn man von einigen Alben für
…
stilbildende Kraft der romantischen Kunst sich
…
scheinbar nervlosen Kunst gelten. Mit den Zier-
…
sie bedeuten nicht wenig gerade für die hübschen
…
herausgegeben, wenn man von einigen Alben für
515
mit seiner fast unkontrollierbaren Thätigkeit für
…
macher für einen Grossen war: für Wilhelm Busch.
…
mit seiner fast unkontrollierbaren Thätigkeit für
…
macher für einen Grossen war: für Wilhelm Busch.
516
WERKE ALTER KUNST
…
Kunst. Das war ein Ausweg. Denn die mo-
…
führungen alter Kunst viel reichlicher vorhanden
…
stellungen alter Kunst, den breitesten Raum ein,
…
WERKE ALTER KUNST
…
Kunst. Das war ein Ausweg. Denn die mo-
…
führungen alter Kunst viel reichlicher vorhanden
…
stellungen alter Kunst, den breitesten Raum ein,
519
der mit der Kunst Hans Schüchlins
…
sonst für Arbeiten seiner Hand hält.
…
tirolischer Kunst. Es ist kein sorgfältig gemaltes
…
in das Bestreben ein, das in der Kunst Italiens ein
…
der mit der Kunst Hans Schüchlins
…
sonst für Arbeiten seiner Hand hält.
…
tirolischer Kunst. Es ist kein sorgfältig gemaltes
…
in das Bestreben ein, das in der Kunst Italiens ein
520
Typisch für Hans von Kulmbach ist die Tafel
…
Liebe für die Perlen
…
Typisch für Hans von Kulmbach ist die Tafel
…
Liebe für die Perlen
523
Kunst und Objekt enthalten.
…
konnte der deutschen Kunst nur zum
…
Kunst und Objekt enthalten.
…
konnte der deutschen Kunst nur zum
524
Restauratoren zu leiden. Ein Glück für Franz Hals,
…
Restauratoren zu leiden. Ein Glück für Franz Hals,
525
dauert, dass die Besitzer alter Bilder für diese
…
gangene Kunst des Auslandes wäre eine grosse
…
zur Stärkung unseres Empfindens für deutsche Art
…
dauert, dass die Besitzer alter Bilder für diese
…
gangene Kunst des Auslandes wäre eine grosse
…
zur Stärkung unseres Empfindens für deutsche Art
526
mann in „Kunst und Künstler" veranlasst mich dazu.
…
würde. Und zwar insofern! Deutsche Kunst! Über-
…
hat, weniger zur Bereicherung deutscher Kunst beitragen,
…
Thoma hat in seiner Kunst viel mehr von Cezanne als
…
Punkt — Marees! Für Liebermann musste Marees ein
…
wenig schreibt und sich mit der Kunst und mit sich
…
mann in „Kunst und Künstler" veranlasst mich dazu.
…
würde. Und zwar insofern! Deutsche Kunst! Über-
…
hat, weniger zur Bereicherung deutscher Kunst beitragen,
…
Thoma hat in seiner Kunst viel mehr von Cezanne als
…
Punkt — Marees! Für Liebermann musste Marees ein
…
wenig schreibt und sich mit der Kunst und mit sich
527
stellen sich die Leitung von „Kunst und Künstler" wun-
…
Herausgeber von „Kunst und Künstler" nun auch nicht
…
aller Lehren der neueren Kunst, Form sei nur was ge-
…
stellen sich die Leitung von „Kunst und Künstler" wun-
…
Herausgeber von „Kunst und Künstler" nun auch nicht
…
aller Lehren der neueren Kunst, Form sei nur was ge-
528
für den Wert der Form nicht ausschlaggebend. Die
…
und zu rühmen war, ist in „Kunst und Künstler" ge-
…
kläger meinen, „Kunst und Künstler" sei keine natio-
…
erstreben Erkenntnis des Dauernden in der Kunst,
…
liche hassen; für die gute Kunst aber wollen wir un-
…
weil wir von jeher für das Können eingetreten sind,
…
deutschen Kunst und wir sprechen von ihm mit dem
…
für das Echte zu haben; nicht resigniert, sondern in der
…
für den Wert der Form nicht ausschlaggebend. Die
…
und zu rühmen war, ist in „Kunst und Künstler" ge-
…
kläger meinen, „Kunst und Künstler" sei keine natio-
…
erstreben Erkenntnis des Dauernden in der Kunst,
…
liche hassen; für die gute Kunst aber wollen wir un-
…
weil wir von jeher für das Können eingetreten sind,
…
deutschen Kunst und wir sprechen von ihm mit dem
…
für das Echte zu haben; nicht resigniert, sondern in der
529
funden, für die neue Zeit eine neue Kunst angebahnt
…
für die vielen
…
für die begin-
…
funden, für die neue Zeit eine neue Kunst angebahnt
…
für die vielen
…
für die begin-
530
ein Schatz echter Eindrücke. Da ist Baustoff für Bilder,
…
auch für das Verarbeiten des Rohmaterials reichen sollte.
…
im übrigen die alleinige Verantwortung für das Gelingen
…
Dresdener Arbeitskomitee für die Darmstädter Aus-
…
ein Schatz echter Eindrücke. Da ist Baustoff für Bilder,
…
auch für das Verarbeiten des Rohmaterials reichen sollte.
…
im übrigen die alleinige Verantwortung für das Gelingen
…
Dresdener Arbeitskomitee für die Darmstädter Aus-
531
nicht, was in Dresden für Darmstadt gearbeitet wurde.
…
diese Form der Versendung hat Professor Biermann für
…
Biermann als für die Ausstellung absolut minderwertig
…
nicht, was in Dresden für Darmstadt gearbeitet wurde.
…
diese Form der Versendung hat Professor Biermann für
…
Biermann als für die Ausstellung absolut minderwertig
532
„alleinigen Verantwortung für das Gelingen der Aus-
…
Die Kunst Gottlieb Schicks ist uns von der Jahr-
…
Kunst im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, er-
…
Interesse für andere, lebendigere und reichere Künstler
…
Quellen, vor allem der Zeitschriften, die für die
…
„alleinigen Verantwortung für das Gelingen der Aus-
…
Die Kunst Gottlieb Schicks ist uns von der Jahr-
…
Kunst im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, er-
…
Interesse für andere, lebendigere und reichere Künstler
…
Quellen, vor allem der Zeitschriften, die für die
…
„alleinigen Verantwortung für das Gelingen der Aus-
…
Die Kunst Gottlieb Schicks ist uns von der Jahr-
…
Kunst im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, er-
…
Interesse für andere, lebendigere und reichere Künstler
…
Quellen, vor allem der Zeitschriften, die für die
533
bücher anspruchsvoll an die Spitze der deutschen Kunst
…
K. K. Ministerium für Kultus und Unterricht. Mit zehn
…
Stellung Zauners in der Kunst seiner Zeit betreffen,
…
nicht auf jene gewiss „reichsdeutsche" Kunst vor mehr
…
Kunst hervorgerufen". Kunst also hier im einschränken-
…
dings eine Kunst nicht theoretisch hervorgerufen, es
…
nen Schriften zur Kunst Seite 274, 275, wo ich den
…
bücher anspruchsvoll an die Spitze der deutschen Kunst
…
K. K. Ministerium für Kultus und Unterricht. Mit zehn
…
Stellung Zauners in der Kunst seiner Zeit betreffen,
…
nicht auf jene gewiss „reichsdeutsche" Kunst vor mehr
…
Kunst hervorgerufen". Kunst also hier im einschränken-
…
dings eine Kunst nicht theoretisch hervorgerufen, es
…
nen Schriften zur Kunst Seite 274, 275, wo ich den
Heft 12
Titelblatt Heft 13.1
* KUNST UND KÜNSTLER
…
Kunst — Hannover......563 d-u • • l t
…
KUNST
…
* KUNST UND KÜNSTLER
…
Kunst — Hannover......563 d-u • • l t
…
KUNST
537
IM ALTEN MUSEUM ZU BERLIN
…
dende Kraft der griechischen Kunst — nicht erör-
…
Kunst uns übermittelt hat. Nun fragt es sich, wie
…
IM ALTEN MUSEUM ZU BERLIN
…
dende Kraft der griechischen Kunst — nicht erör-
…
Kunst uns übermittelt hat. Nun fragt es sich, wie
538
in der Kunst. Die Bronzestatuette einer Spinnerin
…
in der Kunst. Die Bronzestatuette einer Spinnerin
540
angedeutet wird, dass wir das Gefühl für den Orga-
…
Charakter der Bronze ausnutzen, die sich für grosse
…
angedeutet wird, dass wir das Gefühl für den Orga-
…
Charakter der Bronze ausnutzen, die sich für grosse
542
altfränkische Kunst der Zeit
…
Schraffur nur für Schattengebung und sehr sparsam
…
altfränkische Kunst der Zeit
…
Schraffur nur für Schattengebung und sehr sparsam
544
Kunst, den Parthenon-
…
die das Modell für den
…
Ganz echt hingegen ist die rein plastische, für und bilden einen krausen Kranz; der Rockteil ist
…
Kunst, den Parthenon-
…
die das Modell für den
…
Ganz echt hingegen ist die rein plastische, für und bilden einen krausen Kranz; der Rockteil ist
546
von Kunst nicht viel die Rede. Wer kümmert sich
…
von Kunst nicht viel die Rede. Wer kümmert sich
547
lage für das aufgemalte Muster. Der Künstler
…
Natur, wieviel bewusste Kunst! Das scharfe Ober-
…
lage für das aufgemalte Muster. Der Künstler
…
Natur, wieviel bewusste Kunst! Das scharfe Ober-
550
relief (Kunst und Künstler, XIII, Nr. i, S. 7) sahen
…
lichen griechischen Kunst dem
…
bekannte Hilfen für den künst-
…
relief (Kunst und Künstler, XIII, Nr. i, S. 7) sahen
…
lichen griechischen Kunst dem
…
bekannte Hilfen für den künst-
552
attischen Kunst lassen frische Erfindung vermissen.
…
Zitterstriche auf der Oberfläche des Chitons. Für ein
…
sagen, wie griechische Frauen in der Kunst aussehen?
…
attischen Kunst lassen frische Erfindung vermissen.
…
Zitterstriche auf der Oberfläche des Chitons. Für ein
…
sagen, wie griechische Frauen in der Kunst aussehen?
554
lichenForm für die klären-
…
digen, aber nicht für die Hauptsache halten, und
…
kendenKunst„dieAntike"
…
sen für unser Volk und
…
Sinne moderne Kunst erzeugen.
…
lichenForm für die klären-
…
digen, aber nicht für die Hauptsache halten, und
…
kendenKunst„dieAntike"
…
sen für unser Volk und
…
Sinne moderne Kunst erzeugen.
558
vogts Kunst in den vortrefflichen Drucken der
…
Jahrhundert, dass er für eine neue Art des Sehens ein
…
vogts Kunst in den vortrefflichen Drucken der
…
Jahrhundert, dass er für eine neue Art des Sehens ein
560
gedruckte Kunst vergleicht. Wie glücklich und mit
…
gedruckte Kunst vergleicht. Wie glücklich und mit
561
schichte der deutschen Kunst ist reich an Beispielen
…
Schwarz-Weiss-Kunst hauptsächlich um ihrer ge-
…
schichte der deutschen Kunst ist reich an Beispielen
…
Schwarz-Weiss-Kunst hauptsächlich um ihrer ge-
563
DEUTSCHE MUSEEN MODERNER KUNST
…
vermeiden auch von dem Museum moderner
…
dass das nötige Geld für sogenannte Kulturzwecke
…
anspruchsvolle Sammlung moderner Kunst geschaf-
…
Bilder — sind jetzt im Vaterländischen Museum
…
DEUTSCHE MUSEEN MODERNER KUNST
…
vermeiden auch von dem Museum moderner
…
dass das nötige Geld für sogenannte Kulturzwecke
…
anspruchsvolle Sammlung moderner Kunst geschaf-
…
Bilder — sind jetzt im Vaterländischen Museum
564
geführt, hätte es zu einem Museum führen können,
…
Kunst so gut wie nichts vor-
…
lokale Kunst im neunzehnten
…
allem bekümmert sich auch um das Museum der
…
worden, hat von Hodler für
…
der Kunst heran und erzielt
…
geführt, hätte es zu einem Museum führen können,
…
Kunst so gut wie nichts vor-
…
lokale Kunst im neunzehnten
…
allem bekümmert sich auch um das Museum der
…
worden, hat von Hodler für
…
der Kunst heran und erzielt
566
MAX SLEVOQT, EINLADUNGSKARTE FÜR DAS „GRAPHISCHE KABINETT",
…
Kaufsucht eine grosse Gefahr für unsere von vielen
…
kann ein Museum nicht
…
dem Krieg für die Auf-
…
MAX SLEVOQT, EINLADUNGSKARTE FÜR DAS „GRAPHISCHE KABINETT",
…
Kaufsucht eine grosse Gefahr für unsere von vielen
…
kann ein Museum nicht
…
dem Krieg für die Auf-
568
vor der Berührung mit der Leibischen Kunst, noch
…
lich ; jedes Museum durchbricht damit gewisser-
…
niemals in einem Museum hätte sehen mögen. Es
…
vor der Berührung mit der Leibischen Kunst, noch
…
lich ; jedes Museum durchbricht damit gewisser-
…
niemals in einem Museum hätte sehen mögen. Es
569
haften für einen heiteren Glanz und eine gewisse
…
in einem Museum moderner Kunst und inmitten
…
haften für einen heiteren Glanz und eine gewisse
…
in einem Museum moderner Kunst und inmitten
570
dies Museum auch eine Repräsentation der Deutsch-
…
dies Museum auch eine Repräsentation der Deutsch-
571
werkes. Für Feuerbach hat man sich mit aller
…
fen für ein Museum sich lohnte.
…
werkes. Für Feuerbach hat man sich mit aller
…
fen für ein Museum sich lohnte.
572
zu soll das Museum in seiner jetzigen Gestalt die-
…
zu soll das Museum in seiner jetzigen Gestalt die-
574
Bedeutung liegt weniger in dem, was er in der Kunst,
…
es die Künstler, die bis dahin ganz für sich gelebt hatten,
…
schönes Museum. Er sammelte nicht wie ein Galerie-
…
Bedeutung liegt weniger in dem, was er in der Kunst,
…
es die Künstler, die bis dahin ganz für sich gelebt hatten,
…
schönes Museum. Er sammelte nicht wie ein Galerie-
575
Darum sammelte er auch nur die Kunst, unter deren
…
schaft für die Kunst.
…
Zum Leiter des Meisterateliers für Architektur an
…
seiner Kunst und innerhalb der unzähligen und in ihren
…
für diesen Künstler eingetreten ist. Diese Kandidatur
…
nützig nur für die Sache interessierte March hatte, um
…
lich für Bestelmeyer entschieden. Und man geht wohl
…
Darum sammelte er auch nur die Kunst, unter deren
…
schaft für die Kunst.
…
Zum Leiter des Meisterateliers für Architektur an
…
seiner Kunst und innerhalb der unzähligen und in ihren
…
für diesen Künstler eingetreten ist. Diese Kandidatur
…
nützig nur für die Sache interessierte March hatte, um
…
lich für Bestelmeyer entschieden. Und man geht wohl
576
Das „Deutsche Museum für Kunst in Handel und
…
bisher die eingeborene Kunst dreier Erdteile übersah und
…
Kunst. Der Verfasser sieht in den afrikanischen Skulpturen
…
über Kunstformen homogen ist — so ist für den Ver-
…
Das „Deutsche Museum für Kunst in Handel und
…
bisher die eingeborene Kunst dreier Erdteile übersah und
…
Kunst. Der Verfasser sieht in den afrikanischen Skulpturen
…
über Kunstformen homogen ist — so ist für den Ver-
…
Das „Deutsche Museum für Kunst in Handel und
…
bisher die eingeborene Kunst dreier Erdteile übersah und
…
Kunst. Der Verfasser sieht in den afrikanischen Skulpturen
…
über Kunstformen homogen ist — so ist für den Ver-
577
mit Kunst und ihren Methoden erworbene Anschauung
…
zelnen Werke, zunächst das Gesammtbild dieser Kunst
…
rischen und der afrikanischen Kunst einander gegen-
…
Auflösung dieser Kunst hin. Die ihr folgende Krisis
…
Der dritte Abschnitt breitet als Vorwort für die
…
Kunst begründet, formale und religiöse Geschlossenheit
…
Kunst hat die elementare Aufgabe der Plastik — das
…
mit Kunst und ihren Methoden erworbene Anschauung
…
zelnen Werke, zunächst das Gesammtbild dieser Kunst
…
rischen und der afrikanischen Kunst einander gegen-
…
Auflösung dieser Kunst hin. Die ihr folgende Krisis
…
Der dritte Abschnitt breitet als Vorwort für die
…
Kunst begründet, formale und religiöse Geschlossenheit
…
Kunst hat die elementare Aufgabe der Plastik — das
Maßstab/Farbkeil
Massstab/ Farbkeil
Verlagsanstalt Stuttgart-Berlin. Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst
DELFT, DAS ARSENAL
dische Stadt ist weniger als die berühmten euro-
päischen Städte eine „Sehenswürdigkeit". In ihr
giebt es kaum Einzelbauten, die den Kunstfreund
locken. Wodurch sie zu einem Erlebnis unvergleich-
licher Art wird, das ist ihr Gesamtcharakter, ihre
organische Rassenhaftigkeit.
Man kann sagen, die holländische Stadt sei ein
Gebilde der Architektur, nicht der Baukunst. Wo-
bei die beiden Worte Architektur und Baukunst
etwa so unterschieden werden, wie die Worte
Empfindung und Gefühl. Empfindung ist Einzel-
reiz, Gefühl eine gradweis geordnete Summe von
Reizen; Empfindung ist der Teil, Gefühl ist das
Ganze. In diesem Sinne bezeichnet das Wort
Architektur etwas weitaus Primitiveres als das
Wort Baukunst. Es bezeichnet die Bauthätigkeit
innerhalb des naturalistisch Zweckvollen und
Profanen. Die Baukunst aber umfasst auch noch
die ganze Welt der rein darstellenden Form. Die
Architektur schafft mit charaktervoller Solidität
auf dem Boden des Handwerks und der Tradition
nützliche Bauwerke; die Baukunst wandelt, darüber
hinaus, ein abstraktes Stilsystem ab. Man darf be-
haupten, dass der ganzen holländischen Kunst —
sogar die Malerei, der Gipfel dieser Kunst, ist nicht
ausgenommen — das gleichgültig ist, was wir Stil
nennen. Sie hat aufs höchste und eigenartigste Cha-
rakter, aber sie ist nicht eine Stilkunst. Die italieni-
sche Stadt — das ist die Renaissance, die Stadt des
deutschen Mittelalters — das ist die Gotik; die
holländische Stadt aber ist nur das Gebilde einer
nationalen, bürgerlichen Nutzarchitektur. Nur!
denn dass die Stilideen, der sich die Italiener, Deut-
schen, Franzosen in der Geschichte unterworfen
haben, etwas Höheres ist, bedarf keines Beweises.
Die Idee des Stils bedingt eine erhabene Abstrak-
tion, einen über das Bedürfnis weit hin ausblicken-
den Willen zum Symbol, ein Leben im Gleichnis-
haften der reinen darstellenden Form, einen Sinn
für die Steigerung des Künstlerischen bis zu einem
Typischen von fast religiöser Gewalt. Man denke
an die Säule: sie ist eine Quintessenz, ein Symbol
von ewiger Bedeutung; man betrachte das Gesims:
es ist eine künstlerische Erfindung, frei von aller
naturalistischen Zweckmässigkeit, hinaufgehoben
in die Sphäre reiner Erkenntnis und denkender
Anschauung. Alle höheren Stilformen der Bau-
kunst sind in diesem Sinne Symbolisierungen un-
sichtbarer Kräfte, sind Gebilde einer statisch denken-
den Poesie, sind Formen, in denen das tief emp-
344
dische Stadt ist weniger als die berühmten euro-
päischen Städte eine „Sehenswürdigkeit". In ihr
giebt es kaum Einzelbauten, die den Kunstfreund
locken. Wodurch sie zu einem Erlebnis unvergleich-
licher Art wird, das ist ihr Gesamtcharakter, ihre
organische Rassenhaftigkeit.
Man kann sagen, die holländische Stadt sei ein
Gebilde der Architektur, nicht der Baukunst. Wo-
bei die beiden Worte Architektur und Baukunst
etwa so unterschieden werden, wie die Worte
Empfindung und Gefühl. Empfindung ist Einzel-
reiz, Gefühl eine gradweis geordnete Summe von
Reizen; Empfindung ist der Teil, Gefühl ist das
Ganze. In diesem Sinne bezeichnet das Wort
Architektur etwas weitaus Primitiveres als das
Wort Baukunst. Es bezeichnet die Bauthätigkeit
innerhalb des naturalistisch Zweckvollen und
Profanen. Die Baukunst aber umfasst auch noch
die ganze Welt der rein darstellenden Form. Die
Architektur schafft mit charaktervoller Solidität
auf dem Boden des Handwerks und der Tradition
nützliche Bauwerke; die Baukunst wandelt, darüber
hinaus, ein abstraktes Stilsystem ab. Man darf be-
haupten, dass der ganzen holländischen Kunst —
sogar die Malerei, der Gipfel dieser Kunst, ist nicht
ausgenommen — das gleichgültig ist, was wir Stil
nennen. Sie hat aufs höchste und eigenartigste Cha-
rakter, aber sie ist nicht eine Stilkunst. Die italieni-
sche Stadt — das ist die Renaissance, die Stadt des
deutschen Mittelalters — das ist die Gotik; die
holländische Stadt aber ist nur das Gebilde einer
nationalen, bürgerlichen Nutzarchitektur. Nur!
denn dass die Stilideen, der sich die Italiener, Deut-
schen, Franzosen in der Geschichte unterworfen
haben, etwas Höheres ist, bedarf keines Beweises.
Die Idee des Stils bedingt eine erhabene Abstrak-
tion, einen über das Bedürfnis weit hin ausblicken-
den Willen zum Symbol, ein Leben im Gleichnis-
haften der reinen darstellenden Form, einen Sinn
für die Steigerung des Künstlerischen bis zu einem
Typischen von fast religiöser Gewalt. Man denke
an die Säule: sie ist eine Quintessenz, ein Symbol
von ewiger Bedeutung; man betrachte das Gesims:
es ist eine künstlerische Erfindung, frei von aller
naturalistischen Zweckmässigkeit, hinaufgehoben
in die Sphäre reiner Erkenntnis und denkender
Anschauung. Alle höheren Stilformen der Bau-
kunst sind in diesem Sinne Symbolisierungen un-
sichtbarer Kräfte, sind Gebilde einer statisch denken-
den Poesie, sind Formen, in denen das tief emp-
344