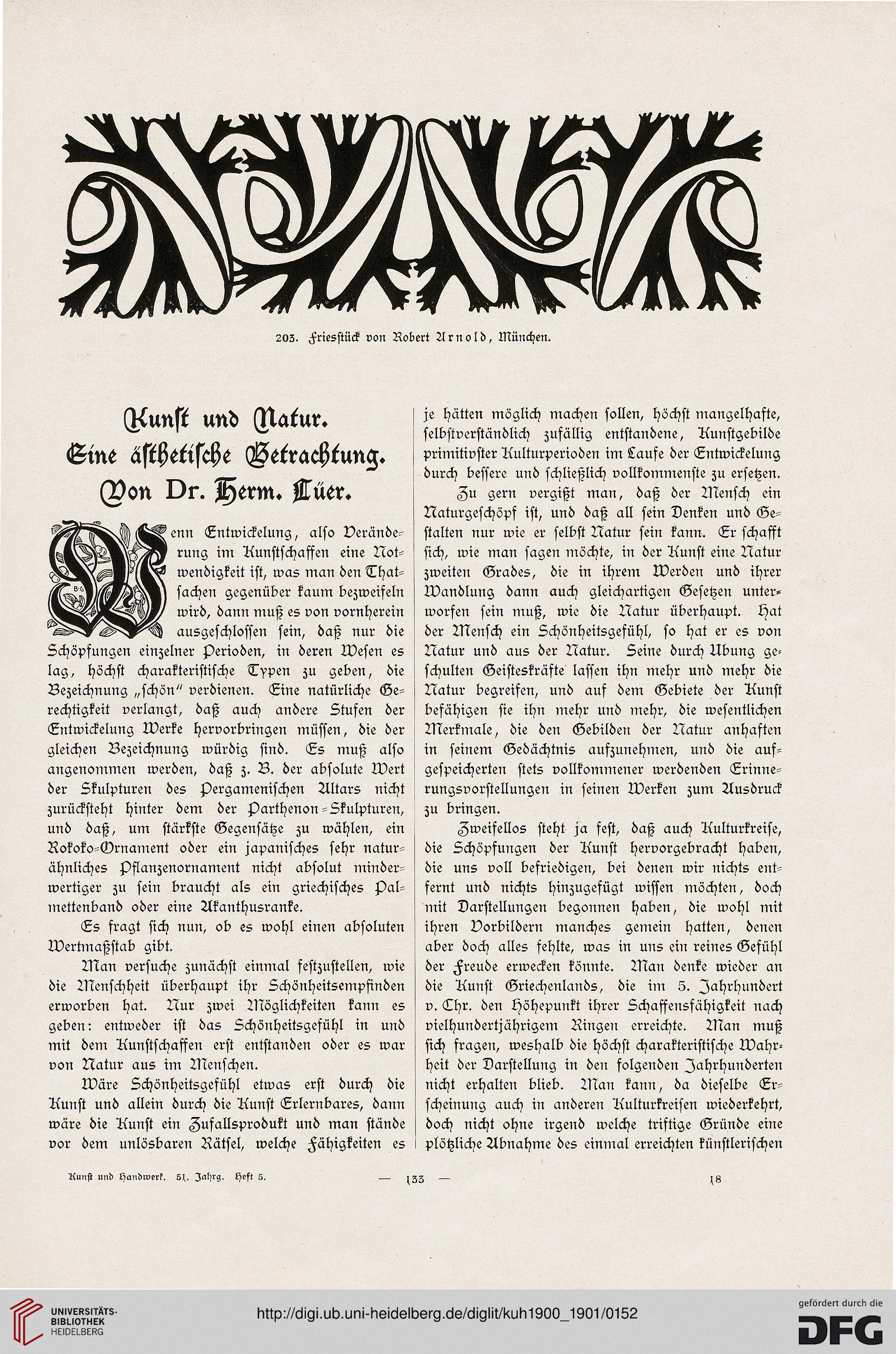203. Friesstück von Robert Arnold, München.
(Kunf? und (Vatur.
Sine asketische Betrachtung.
(Von Dr. Herm. Liier.
enn Entwickelung, also Verände-
rung im Kunstschaffen eine Not-
wendigkeit ist, was man den That-
sachcn gegenüber kaum bezweifelt:
wird, dann muß es von vornherein
ausgeschlossen sein, daß nur die
Schöpfungen einzelner Perioden, in deren Wesen es
lag, höchst charakteristische Typen zu geben, die
Bezeichnung „schön" verdienen. Eine natürliche Ge-
rechtigkeit verlangt, daß auch andere Stufen der
Entwickelung Werke Hervorbringen müssen, die der
gleichen Bezeichnung würdig sind. Es muß also
angenommen werden, daß z. B. der absolute Wert
der Skulpturen des Pergamenischen Altars nicht
zurücksteht hinter dem der Parthenon-Skulpturen,
ui:d daß, um stärkste Gegensätze zu wählen, ein
Rokoko-Vrnament oder ein japanisches sehr natur-
ähnliches Pflanzenornament nicht absolut minder-
wertiger zu sein braucht als ein griechisches Pal-
mettenband oder eine Akanthusranke.
Es fragt sich nun, ob es wohl einen absoluten
Wertmaßstab gibt.
Man versuche zunächst einmal festzustellen, wie
die Menschheit überhaupt ihr Schönheitsempfinden
erworben hat. Bur zwei Möglichkeiten kann es
geben: entweder ist das Schönheitsgefühl in und
mit den: Kunstschaffen erst entstanden oder es war
von Natur aus im Menschen.
Wäre Schönheitsgefühl etwas erst durch die
Kunst und allein durch die Kunst Erlernbares, dann
wäre die Kunst ein Zufallsprodukt und man stände
vor dem unlösbaren Rätsel, welche Fähigkeiten es
je hätten möglich machen sollen, höchst mangelhafte,
selbstverständlich zufällig entstandene, Kunstgebilde
primitivster Kulturperioden im Laufe der Ei:twickelui:g
durch bessere und schließlich vollkoinntenste zu ersetzen.
Zu gern vergißt man, daß der Mensch ein
Naturgeschöpf ist, und daß all sein Denken und Ge-
staltet: nur wie er selbst Natur sein kann. Er schafft
sich, wie ma:i sagen iitöchte, ii: der Kunst eine Natur
zweiten Grades, die in ihrem Werden und ihrer
Wandlung dann auch gleichartigen Gesetzen unter-
worfen sein muß, wie die Natur überhaupt, pat
der Mensch ein Schönheitsgefühl, so hat er es voi:
Natur und aus der Natur. Seine durch Übung ge-
schulten Geisteskräfte lassen ihn mehr ui:d n:ehr die
Natur begreifen, und auf dem Gebiete der Kunst
befähigen sie ihn mehr und n:ehr, die weseittlichen
Merkmale, die den Gebilden der Natur anhasten
in seinem Gedächtnis aufzunehmen, und die auf-
gespeicherten stets vollkontiitener werdenden Erinne-
rungsvorstellungen in seinen Werken zum Ausdruck
zu bringen.
Zweifellos steht ja fest, daß auch Kulturkreise,
die Schöpfungen der Kunst hervorgebracht haben,
die uns voll befriedigen, bei denen wir nichts ent
fernt und nichts hinzugefügt wissen möchten, doch
mit Darstellungen begonnen haben, die wohl mit
ihren Vorbildern manches gemein hatten, denen
aber doch alles fehlte, was in ui:s ein reines Gefühl
der Freude erwecken könnte. Man denke wieder an
die Kunst Griechenlands, die im 5. Jahrhundert
v. Ehr. den Höhepunkt ihrer Schaffensfähigkeit nach
vielhundertjährigem Ringen erreichte. Man muß
sich fragen, weshalb die höchst charakteristische Wahr-
heit der Darstellung in den folgeitdei: Jahrhunderten
nicht erhalten blieb. Man kann, da dieselbe Er-
scheinung auch ii: anderen Kulturkreisen wiederkehrt,
doch nicht ohne irgend welche triftige Gründe eine
plötzliche Abnahme des einmal erreichten künstlerischen
Aunst und Handwerk. 5H. Jährg. Heft 5.
*33
(Kunf? und (Vatur.
Sine asketische Betrachtung.
(Von Dr. Herm. Liier.
enn Entwickelung, also Verände-
rung im Kunstschaffen eine Not-
wendigkeit ist, was man den That-
sachcn gegenüber kaum bezweifelt:
wird, dann muß es von vornherein
ausgeschlossen sein, daß nur die
Schöpfungen einzelner Perioden, in deren Wesen es
lag, höchst charakteristische Typen zu geben, die
Bezeichnung „schön" verdienen. Eine natürliche Ge-
rechtigkeit verlangt, daß auch andere Stufen der
Entwickelung Werke Hervorbringen müssen, die der
gleichen Bezeichnung würdig sind. Es muß also
angenommen werden, daß z. B. der absolute Wert
der Skulpturen des Pergamenischen Altars nicht
zurücksteht hinter dem der Parthenon-Skulpturen,
ui:d daß, um stärkste Gegensätze zu wählen, ein
Rokoko-Vrnament oder ein japanisches sehr natur-
ähnliches Pflanzenornament nicht absolut minder-
wertiger zu sein braucht als ein griechisches Pal-
mettenband oder eine Akanthusranke.
Es fragt sich nun, ob es wohl einen absoluten
Wertmaßstab gibt.
Man versuche zunächst einmal festzustellen, wie
die Menschheit überhaupt ihr Schönheitsempfinden
erworben hat. Bur zwei Möglichkeiten kann es
geben: entweder ist das Schönheitsgefühl in und
mit den: Kunstschaffen erst entstanden oder es war
von Natur aus im Menschen.
Wäre Schönheitsgefühl etwas erst durch die
Kunst und allein durch die Kunst Erlernbares, dann
wäre die Kunst ein Zufallsprodukt und man stände
vor dem unlösbaren Rätsel, welche Fähigkeiten es
je hätten möglich machen sollen, höchst mangelhafte,
selbstverständlich zufällig entstandene, Kunstgebilde
primitivster Kulturperioden im Laufe der Ei:twickelui:g
durch bessere und schließlich vollkoinntenste zu ersetzen.
Zu gern vergißt man, daß der Mensch ein
Naturgeschöpf ist, und daß all sein Denken und Ge-
staltet: nur wie er selbst Natur sein kann. Er schafft
sich, wie ma:i sagen iitöchte, ii: der Kunst eine Natur
zweiten Grades, die in ihrem Werden und ihrer
Wandlung dann auch gleichartigen Gesetzen unter-
worfen sein muß, wie die Natur überhaupt, pat
der Mensch ein Schönheitsgefühl, so hat er es voi:
Natur und aus der Natur. Seine durch Übung ge-
schulten Geisteskräfte lassen ihn mehr ui:d n:ehr die
Natur begreifen, und auf dem Gebiete der Kunst
befähigen sie ihn mehr und n:ehr, die weseittlichen
Merkmale, die den Gebilden der Natur anhasten
in seinem Gedächtnis aufzunehmen, und die auf-
gespeicherten stets vollkontiitener werdenden Erinne-
rungsvorstellungen in seinen Werken zum Ausdruck
zu bringen.
Zweifellos steht ja fest, daß auch Kulturkreise,
die Schöpfungen der Kunst hervorgebracht haben,
die uns voll befriedigen, bei denen wir nichts ent
fernt und nichts hinzugefügt wissen möchten, doch
mit Darstellungen begonnen haben, die wohl mit
ihren Vorbildern manches gemein hatten, denen
aber doch alles fehlte, was in ui:s ein reines Gefühl
der Freude erwecken könnte. Man denke wieder an
die Kunst Griechenlands, die im 5. Jahrhundert
v. Ehr. den Höhepunkt ihrer Schaffensfähigkeit nach
vielhundertjährigem Ringen erreichte. Man muß
sich fragen, weshalb die höchst charakteristische Wahr-
heit der Darstellung in den folgeitdei: Jahrhunderten
nicht erhalten blieb. Man kann, da dieselbe Er-
scheinung auch ii: anderen Kulturkreisen wiederkehrt,
doch nicht ohne irgend welche triftige Gründe eine
plötzliche Abnahme des einmal erreichten künstlerischen
Aunst und Handwerk. 5H. Jährg. Heft 5.
*33