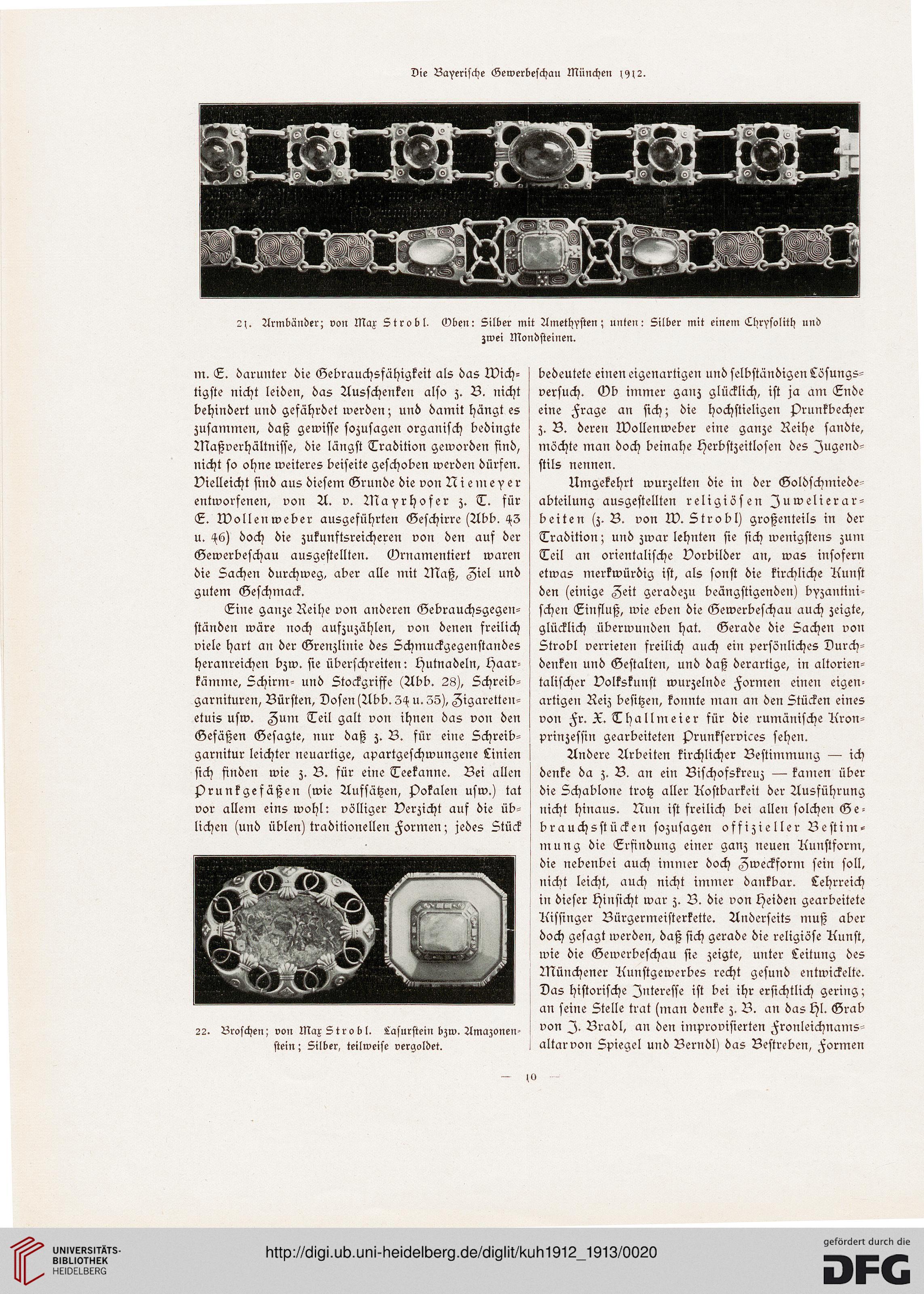Die Bayerische Gewerbeschau München ;9(2.
2\. Armbänder; von Max Strobl. Gben: Silber mit Amethysten; unten: Silber mit einem Chrysolith und
zwei Mondsteinen.
m. G. darunter die Gebrauchsfähigkeit als das Wich-
tigste nicht leiden, das Ausschenken also z. B. nicht
behindert und gefährdet werden; und damit hängt es
zusammen, daß gewisse sozusagen organisch bedingte
Maßverhältnisse, die längst Tradition geworden find,
nicht so ohne weiteres beiseite geschoben werden dürfen.
Vielleicht sind aus diesem Grunde die von N i e m e y e r
entworfenen, von A. v. Mayrhofer z. T. für
(£. Wollenweber ausgeführten Geschirre (Abb. $3
u. -s6) doch die zukunftsreicheren von den auf der
Gewerbeschau ausgestellten. (Ornamentiert waren
die Lachen durchweg, aber alle mit Maß, Ziel und
gutem Geschmack.
Tine ganze Reihe von anderen Gebrauchsgegen-
ständen wäre noch aufzuzählen, von denen freilich
viele hart an der Grenzlinie des Schmuckgegenstandes
heranreichen bzw. sie überschreiten: Hutnadeln, paar-
kämme, Lchirm- und Stockgriffe (Abb. 28), Schreib-
garnituren, Bürsten, Dosen (Abb. 3^ u. 35), Zigaretten-
etuis ufw. Zum Teil galt von ihnen das von den
Gefäßen Gesagte, nur daß z. B. für eine Schreib-
garnitur leichter neuartige, apartgeschwungene Linien
sich finden wie z. B. für eine Teekanne. Bei allen
Prunkgefäßen (wie Aufsätzen, Pokalen usw.) tat
vor allem eins wohl: völliger Verzicht auf die üb-
lichen (und üblen) traditionellen formen; jedes Stück
Mrrr: \
22. Broschen; von Max Strobl. Lasurstein bzw. Amazonen-
stein ; Silber, teilweise vergoldet.
bedeutete einen eigenartigen und selbständigen Lösungs-
versuch. (Ob immer ganz glücklich, ist ja am Ende
eine Frage an sich; die hochstieligen Prunkbecher
z. B. deren Wollenweber eine ganze Reihe sandte,
möchte man doch beinahe Herbstzeitlosen des Jugend-
stils nennen.
Umgekehrt wurzelten die in der Goldschmiede-
abteilung ausgestellten religiösen Juwelierar-
beiten (z. B. von W. Strobl) großenteils in der
Tradition; und zwar lehnten sie sich wenigstens zunr
Teil an orientalische Vorbilder an, was insofern
etwas merkwürdig ist, als sonst die kirchliche Aunst
den (einige Zeit geradezu beängstigenden) byzantini-
schen Ginfluß, wie eben die Gewerbeschau auch zeigte,
glücklich überwunden hat. Gerade die Sachen von
Strobl verrieten freilich auch ein persönliches Durch-
denken und Gestalten, und daß derartige, in altorien-
talischer Volkskunst wurzelnde formen einen eigen-
artigen Reiz besitzen, konnte man an den Stücken eines
von Fr. ch. Thallmeier für die rumänische Aron-
prinzessin gearbeiteten Prunkservices sehen.
Andere Arbeiten kirchlicher Bestimmung —• ich
denke da z. B. an ein Bischofskreuz —- kamen über
die Schablone trotz aller Achtbarkeit der Ausführung
nicht hinaus. Nun ist freilich bei allen solchen Ge-
brauchsstücken sozusagen offizieller Bestim-
mung die Erfindung einer ganz neuen Aunstform,
die nebenbei auch imnier doch Zwecksorm sein soll,
nicht leicht, auch nicht immer dankbar. Lehrreich
in dieser Einsicht war z. B. die von peiden gearbeitete
Aissinger Bürgermeisterkette. Anderseits muß aber
doch gesagt werden, daß sich gerade die religiöse Aunst,
wie die Gewerbeschau sie zeigte, unter Leitung des
Münchener Aunstgewerbes recht gesund entwickelte.
Das historische Interesse ist bei ihr ersichtlich gering;
an seine Stelle trat (man denke z. B. an dasHl. Grab
von I. Bradl, an den improvisierten Fronleichnams-
altarvon Spiegel und Berndl) das Bestreben, formen
io
2\. Armbänder; von Max Strobl. Gben: Silber mit Amethysten; unten: Silber mit einem Chrysolith und
zwei Mondsteinen.
m. G. darunter die Gebrauchsfähigkeit als das Wich-
tigste nicht leiden, das Ausschenken also z. B. nicht
behindert und gefährdet werden; und damit hängt es
zusammen, daß gewisse sozusagen organisch bedingte
Maßverhältnisse, die längst Tradition geworden find,
nicht so ohne weiteres beiseite geschoben werden dürfen.
Vielleicht sind aus diesem Grunde die von N i e m e y e r
entworfenen, von A. v. Mayrhofer z. T. für
(£. Wollenweber ausgeführten Geschirre (Abb. $3
u. -s6) doch die zukunftsreicheren von den auf der
Gewerbeschau ausgestellten. (Ornamentiert waren
die Lachen durchweg, aber alle mit Maß, Ziel und
gutem Geschmack.
Tine ganze Reihe von anderen Gebrauchsgegen-
ständen wäre noch aufzuzählen, von denen freilich
viele hart an der Grenzlinie des Schmuckgegenstandes
heranreichen bzw. sie überschreiten: Hutnadeln, paar-
kämme, Lchirm- und Stockgriffe (Abb. 28), Schreib-
garnituren, Bürsten, Dosen (Abb. 3^ u. 35), Zigaretten-
etuis ufw. Zum Teil galt von ihnen das von den
Gefäßen Gesagte, nur daß z. B. für eine Schreib-
garnitur leichter neuartige, apartgeschwungene Linien
sich finden wie z. B. für eine Teekanne. Bei allen
Prunkgefäßen (wie Aufsätzen, Pokalen usw.) tat
vor allem eins wohl: völliger Verzicht auf die üb-
lichen (und üblen) traditionellen formen; jedes Stück
Mrrr: \
22. Broschen; von Max Strobl. Lasurstein bzw. Amazonen-
stein ; Silber, teilweise vergoldet.
bedeutete einen eigenartigen und selbständigen Lösungs-
versuch. (Ob immer ganz glücklich, ist ja am Ende
eine Frage an sich; die hochstieligen Prunkbecher
z. B. deren Wollenweber eine ganze Reihe sandte,
möchte man doch beinahe Herbstzeitlosen des Jugend-
stils nennen.
Umgekehrt wurzelten die in der Goldschmiede-
abteilung ausgestellten religiösen Juwelierar-
beiten (z. B. von W. Strobl) großenteils in der
Tradition; und zwar lehnten sie sich wenigstens zunr
Teil an orientalische Vorbilder an, was insofern
etwas merkwürdig ist, als sonst die kirchliche Aunst
den (einige Zeit geradezu beängstigenden) byzantini-
schen Ginfluß, wie eben die Gewerbeschau auch zeigte,
glücklich überwunden hat. Gerade die Sachen von
Strobl verrieten freilich auch ein persönliches Durch-
denken und Gestalten, und daß derartige, in altorien-
talischer Volkskunst wurzelnde formen einen eigen-
artigen Reiz besitzen, konnte man an den Stücken eines
von Fr. ch. Thallmeier für die rumänische Aron-
prinzessin gearbeiteten Prunkservices sehen.
Andere Arbeiten kirchlicher Bestimmung —• ich
denke da z. B. an ein Bischofskreuz —- kamen über
die Schablone trotz aller Achtbarkeit der Ausführung
nicht hinaus. Nun ist freilich bei allen solchen Ge-
brauchsstücken sozusagen offizieller Bestim-
mung die Erfindung einer ganz neuen Aunstform,
die nebenbei auch imnier doch Zwecksorm sein soll,
nicht leicht, auch nicht immer dankbar. Lehrreich
in dieser Einsicht war z. B. die von peiden gearbeitete
Aissinger Bürgermeisterkette. Anderseits muß aber
doch gesagt werden, daß sich gerade die religiöse Aunst,
wie die Gewerbeschau sie zeigte, unter Leitung des
Münchener Aunstgewerbes recht gesund entwickelte.
Das historische Interesse ist bei ihr ersichtlich gering;
an seine Stelle trat (man denke z. B. an dasHl. Grab
von I. Bradl, an den improvisierten Fronleichnams-
altarvon Spiegel und Berndl) das Bestreben, formen
io