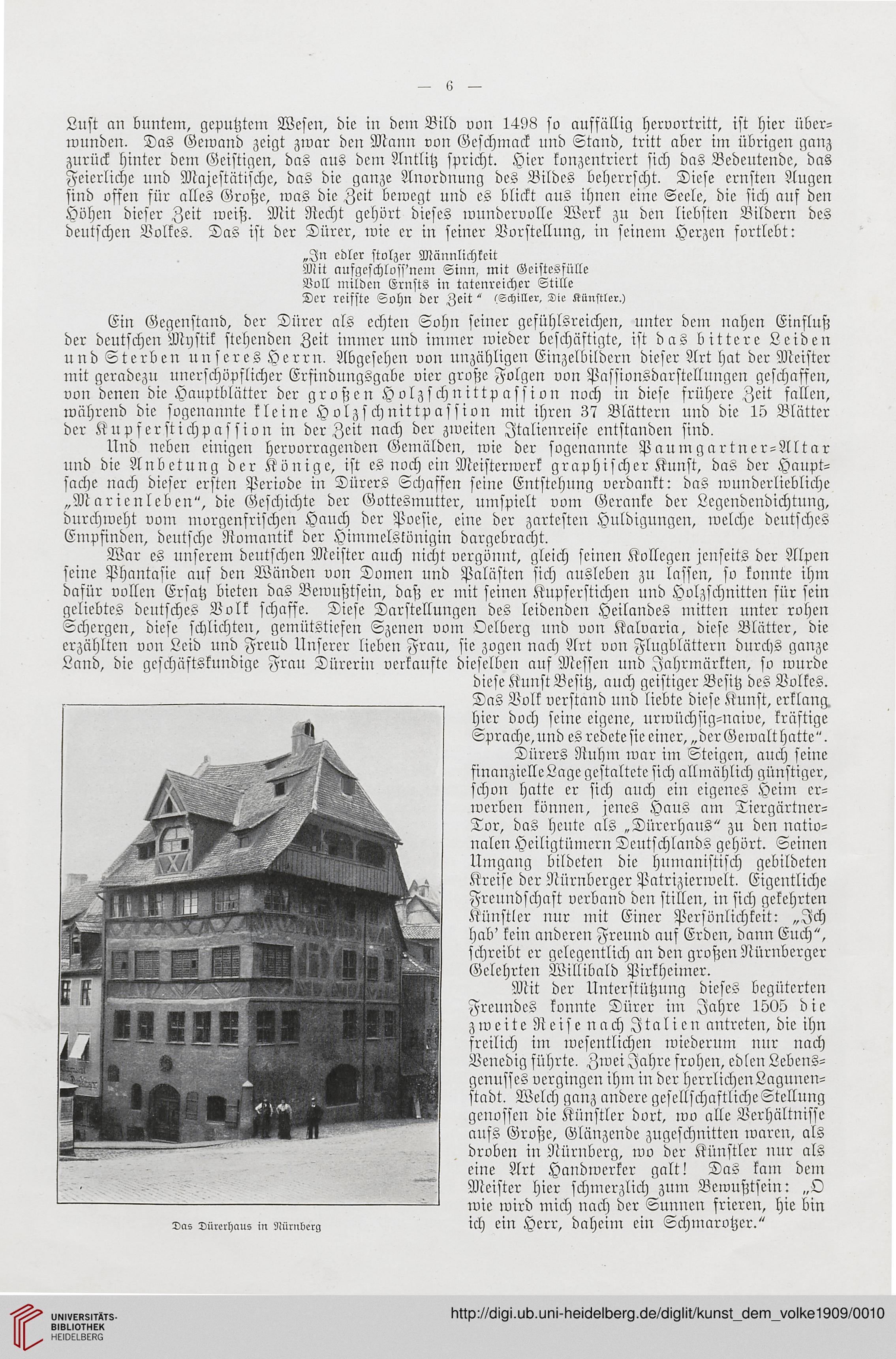6
Lust an buntem, geputztem Wesen, die in dem Bild von 1498 so auffällig hervortritt, ist hier über-
munden. Das Gemand zeigt zwar den Mann von Geschmack und Stand, tritt aber im übrigen ganz
zurück hinter dem Geistigen, das aus dem Antlitz spricht. Hier konzentriert sich das Bedeutende, das
Feierliche und Majestätische, das die ganze Anordnung des Bildes beherrscht. Diese ernsten Augen
sind offen für alles Große, was die Zeit bewegt und es blickt aus ihnen eine Seele, die sich auf den
Höhen dieser Zeit weiß. Mit Recht gehört dieses wundervolle Werk zu den liebsten Bildern des
deutschen Volkes. Das ist der Dürer, wie er in seiner Vorstellung, in seinem Herzen fortlebt:
„Jn edler stolzer Männlichkeit
Mit aufgeschloss'nem Sinn, mit Geistessülle
Voll milden Ernsts in tatenreicher Stille
Der reifste Sohn der Zeit" (Schiller, Dic Künstler.)
Ein Gegenstand, der Dürer als echten Sohn seiner gefühlsreichen, unter dem nahen Einfluß
der deutschen Mpstik stehenden Zeit immer und immer wieder beschäftigte, ist das bittere Leiden
und Sterben un ser es Herrn. Abgesehen von unzähligen Einzelbildern dieser Art hat der Meister
mit geradezu unerschöpflicher Erfindungsgabe vier große Folgen von Passionsdarstellungen geschaffen,
von denen die Hauptblätter der großen H olz sch n ittp assi o n noch in diese frühere Zeit fallen,
während die sogenannte kleine Holzschnittpassion mit ihren 37 Blättern und die 15 Blätter
der Kupferstichpassion in der Zeit nach der zweiten Jtalienreise entstanden sind.
Ilnd neben einigen hervorragenden Gemälden, wie der sogenannte Paumgartner-Altar
und die Anbetung der Könige, ist es noch ein Meisterwerk graphischer Kunst, das der Haupt-
sache nach dieser ersten Periode in Dürers Schaffen seine Entstehung verdankt: das wunderliebliche
„Marienleben", die Geschichte der Gottesmutter, umspielt vom Geranke der Legendendichtung,
durchweht vom morgenfrischen Hauch der Poesie, eine der zartesten Huldigungen, welche deutsches
Empfinden, deutsche Romantik der Himmelskönigin dargebracht.
War es unserem deutschen Meister auch nicht vergönnt, gleich scinen Kollegen jenseits der Alpen
seine Phantasie aus den Wänden von Domen und Palästen sich ausleben zu lassen, so konnte ihm
dafür vollen Ersatz bieten das Bewußtsein, daß er mit seinen Kupferstichen und Holzschnitten für sein
geliebtes deutsches Volk schaffe. Diese Darstellungen des leidendeir Heilandes mitten unter rohen
Schergen, diese schlichten, gemütstiefen Szenen vom Oelberg und von Kalvaria, diese Blätter, die
erzahlten von Leid und Freud llnserer lieben Frau, sie zogen nach Art von Flugblättern durchs ganze
Land, die geschästskundige Frau Dürerin verkaufte dieselben auf Messen und Jahrmärkten, so wurde
diese KunstBesitz, auch geistiger Besitz des Volkes.
Das Volk verstand und liebte diese Kunst, erklang
hier doch seine eigene, urwüchsig-naive, kräftige
Sprache,und esredetesieeiner, „derGewalthatte".
Dürers Ruhm war im Steigcn, auch seine
finanzielleLage gestaltcte sich allmählich günstiger,
schon hatte er sich auch ein eigenes Heim er-
werben können, jenes Haus am Tiergärtner-
Tor, das heute als „Dürerhaus" zu den natio-
nalen Heiligtümern Deutschlands gehört. Seinen
llmgang bildeten die humanistisch gebildeten
Kreise der Nürnberger Patrizierwelt. Eigentliche
Freundschaft verband den stillen, in sich gekehrten
Künstler nur mit Einer Persönlichkeit: „Jch
hab' kein anderen Freund auf Erden, dann Euch",
schreibt er gelegentlich an den grohen Nürnberger
Gelehrten Willibald Pirkheimer.
Mit der Ilnterstützung dieses begüterten
Freundes konnte Dürer im Jahre 1505 die
zweite Reise nach Jtalien antreten, die ihn
freilich im wesentlichen wiederum nur nach
Venedig führte. ZweiJahre frohen, edlen Lebens-
genusses vergingen ihm in der herrlichenLagunen-
stadt. Welch ganz andere gesellschaftlicheStellung
genossen die Künstler dort, wo alle Verhältnisse
aufs Große, Glänzende zugeschnitten waren, als
droben in Nürnberg, wo der Künstler nur als
eine Art Handwerker galt! Das kam dem
Meister hier schmerzlich zum Bewußtsein: „O
wie wird mich nach der Sunnen srieren, hie bin
ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer."
Das Dürerhaus in Nürnberg
Lust an buntem, geputztem Wesen, die in dem Bild von 1498 so auffällig hervortritt, ist hier über-
munden. Das Gemand zeigt zwar den Mann von Geschmack und Stand, tritt aber im übrigen ganz
zurück hinter dem Geistigen, das aus dem Antlitz spricht. Hier konzentriert sich das Bedeutende, das
Feierliche und Majestätische, das die ganze Anordnung des Bildes beherrscht. Diese ernsten Augen
sind offen für alles Große, was die Zeit bewegt und es blickt aus ihnen eine Seele, die sich auf den
Höhen dieser Zeit weiß. Mit Recht gehört dieses wundervolle Werk zu den liebsten Bildern des
deutschen Volkes. Das ist der Dürer, wie er in seiner Vorstellung, in seinem Herzen fortlebt:
„Jn edler stolzer Männlichkeit
Mit aufgeschloss'nem Sinn, mit Geistessülle
Voll milden Ernsts in tatenreicher Stille
Der reifste Sohn der Zeit" (Schiller, Dic Künstler.)
Ein Gegenstand, der Dürer als echten Sohn seiner gefühlsreichen, unter dem nahen Einfluß
der deutschen Mpstik stehenden Zeit immer und immer wieder beschäftigte, ist das bittere Leiden
und Sterben un ser es Herrn. Abgesehen von unzähligen Einzelbildern dieser Art hat der Meister
mit geradezu unerschöpflicher Erfindungsgabe vier große Folgen von Passionsdarstellungen geschaffen,
von denen die Hauptblätter der großen H olz sch n ittp assi o n noch in diese frühere Zeit fallen,
während die sogenannte kleine Holzschnittpassion mit ihren 37 Blättern und die 15 Blätter
der Kupferstichpassion in der Zeit nach der zweiten Jtalienreise entstanden sind.
Ilnd neben einigen hervorragenden Gemälden, wie der sogenannte Paumgartner-Altar
und die Anbetung der Könige, ist es noch ein Meisterwerk graphischer Kunst, das der Haupt-
sache nach dieser ersten Periode in Dürers Schaffen seine Entstehung verdankt: das wunderliebliche
„Marienleben", die Geschichte der Gottesmutter, umspielt vom Geranke der Legendendichtung,
durchweht vom morgenfrischen Hauch der Poesie, eine der zartesten Huldigungen, welche deutsches
Empfinden, deutsche Romantik der Himmelskönigin dargebracht.
War es unserem deutschen Meister auch nicht vergönnt, gleich scinen Kollegen jenseits der Alpen
seine Phantasie aus den Wänden von Domen und Palästen sich ausleben zu lassen, so konnte ihm
dafür vollen Ersatz bieten das Bewußtsein, daß er mit seinen Kupferstichen und Holzschnitten für sein
geliebtes deutsches Volk schaffe. Diese Darstellungen des leidendeir Heilandes mitten unter rohen
Schergen, diese schlichten, gemütstiefen Szenen vom Oelberg und von Kalvaria, diese Blätter, die
erzahlten von Leid und Freud llnserer lieben Frau, sie zogen nach Art von Flugblättern durchs ganze
Land, die geschästskundige Frau Dürerin verkaufte dieselben auf Messen und Jahrmärkten, so wurde
diese KunstBesitz, auch geistiger Besitz des Volkes.
Das Volk verstand und liebte diese Kunst, erklang
hier doch seine eigene, urwüchsig-naive, kräftige
Sprache,und esredetesieeiner, „derGewalthatte".
Dürers Ruhm war im Steigcn, auch seine
finanzielleLage gestaltcte sich allmählich günstiger,
schon hatte er sich auch ein eigenes Heim er-
werben können, jenes Haus am Tiergärtner-
Tor, das heute als „Dürerhaus" zu den natio-
nalen Heiligtümern Deutschlands gehört. Seinen
llmgang bildeten die humanistisch gebildeten
Kreise der Nürnberger Patrizierwelt. Eigentliche
Freundschaft verband den stillen, in sich gekehrten
Künstler nur mit Einer Persönlichkeit: „Jch
hab' kein anderen Freund auf Erden, dann Euch",
schreibt er gelegentlich an den grohen Nürnberger
Gelehrten Willibald Pirkheimer.
Mit der Ilnterstützung dieses begüterten
Freundes konnte Dürer im Jahre 1505 die
zweite Reise nach Jtalien antreten, die ihn
freilich im wesentlichen wiederum nur nach
Venedig führte. ZweiJahre frohen, edlen Lebens-
genusses vergingen ihm in der herrlichenLagunen-
stadt. Welch ganz andere gesellschaftlicheStellung
genossen die Künstler dort, wo alle Verhältnisse
aufs Große, Glänzende zugeschnitten waren, als
droben in Nürnberg, wo der Künstler nur als
eine Art Handwerker galt! Das kam dem
Meister hier schmerzlich zum Bewußtsein: „O
wie wird mich nach der Sunnen srieren, hie bin
ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer."
Das Dürerhaus in Nürnberg