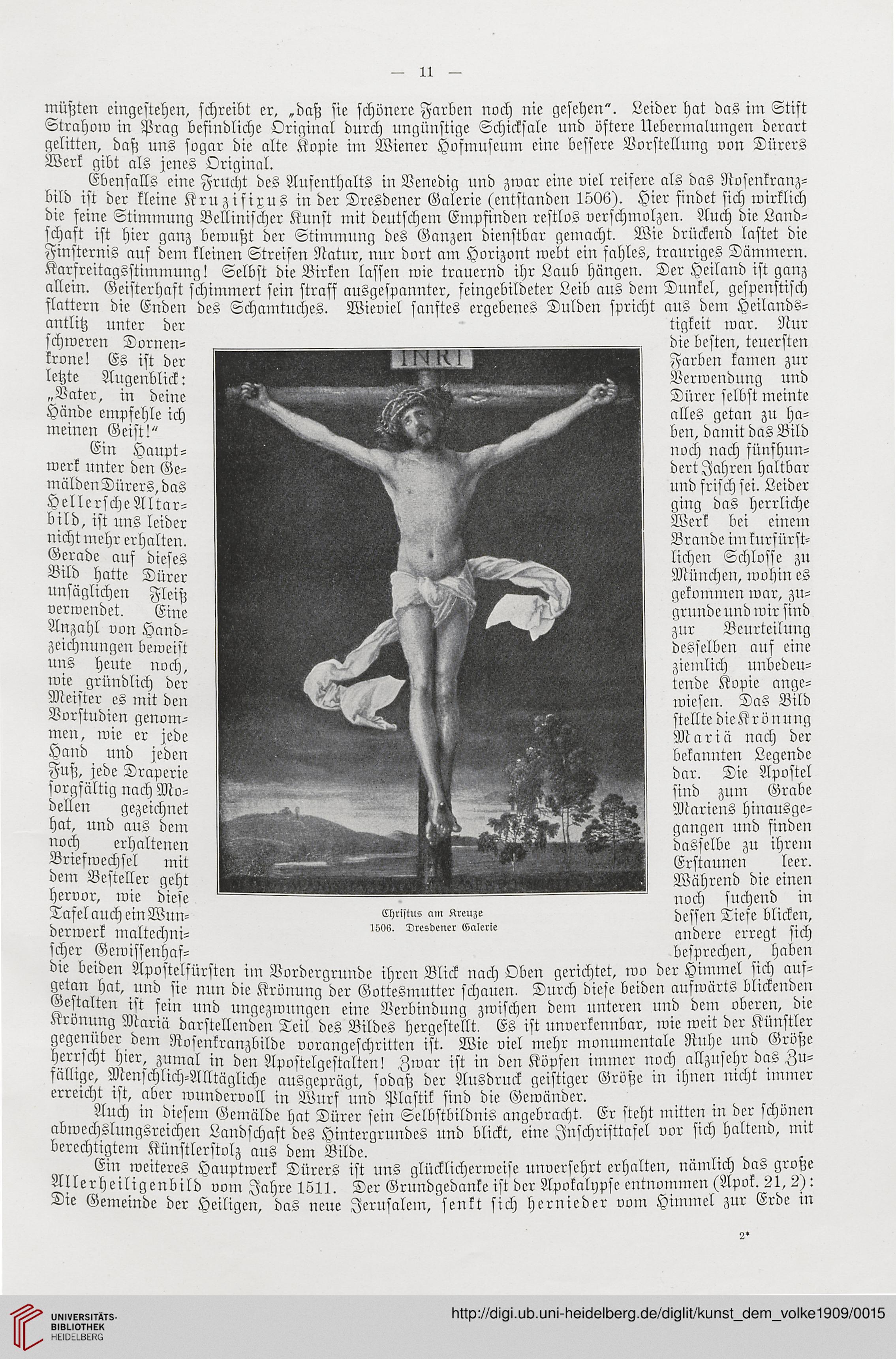11
müßten eingestehen, schreibt er, ,daß sie schönere Farben noch me gesehen . d^
Strahow in Prag befindliche Original durch ungünstige Schrchale und oftere Uebermalung^
gelitten, daß uns sogar die alte Kopie im Wiener Hofmuseum eme befiere ^orstcllung von ^urciv
Mensalls^ei'ne s^ucht des Aufenthalts in Venedig und zmar cine viel refi'ere als das sich mirklich
bild ist der kleine Kfinzifixus in der Dresdener Galerie (entstanden ^1o06). l-'rdet suh wEch
die feine Stimmung Bellinischer Kunst mit deutschem Empfinden restlov ^7?^
schaft ist hier ganz bewußt der Stimmung des Ganzen drenstbar gemacht. ^ i s
Finsternis auf dem kleinen Streifen Natur, nur dort am Horrzont webt em fahlev,
Karfreitagsstnnmung l Selbst die Birken lassen wie trauernd rhr Laub hangen. ^ ^
allein. Geisterhaft schimmert sein straff ausgespannter, feingeblldeter Lerb aus dem 'ukefi geffe^
slattern die Enden des Schamtuches. Wieviel sanftes ergebenes Lulden spricht aus dem Hellam.-
antlitz unter der
schweren Dornen-
kronel Es ist der
letzte Augenblick:
„Vater, in deine
Hände empfehle ich
meinen Geistl"
Ein Haupt-
werk unter den Ge-
mäldenDürers,das
HellerscheAltar-
bild, ist uns leider
nichtmehr erhalten.
Gerade auf dieses
Bild hatte Dürer
unsäglichen Fleiß
verwendet. Eine
Anzahl von Hand-
zeichnungen beweist
uns heute noch,
wie gründlich der
Meister es mit den
Vorstudicn genom-
men, wie er jede
Hand und jeden
Fuß, jede Draperie
sorgfältig nach Mo-
dellen gezeichnet
hat, und aus dem
noch erhaltenen
Briefwechsel mit
dem Besteller geht
hervor, wie diese
TafelaucheinWun-
derwerk maltechni
scher Gewissenhcff
Christus am Kreuze
t506. Dresdener Galerie
tigkeit war. Nur
die besten, teuersten
Farben kamen zur
Verwendung und
Dürer selbst meinte
alles getan zu ha-
ben, damit das Bild
noch nach fünfhun-
dert Jahren haltbar
und frisch sei. Leider
ging das herrliche
Werk bei einem
Brandeimkurfürst-
lichen Schlosse zu
München, wohin es
gekommen war, zu-
grundeundwirsind
zur Beurteilung
desselben auf eine
ziemlich unbedeu-
tende Kopie ange-
wiesen. Das Bild
stelltedieKrönung
Mariä nach der
bekannten Legende
dar. Die Apostel
sind zum Grabe
Mariens hinausge-
gangen und finden
dasselbe zu ihrem
Erstaunen leer.
Während die einen
noch suchend in
dessen Tiefe blicken,
andere erregt sich
besprechen, haben
die beiden Äpostelfürsten im Vordergrunde ihren Blick nach Oben gerichtet, wo der Himmel ftch aus
getan hat, und sie nun die Krönung der Gottesmutter schauen. Durch diese beiden aufwärt^ blickeiu cn
Gestalten ist fein und ungezwungen eine Verbindung zwischen dem unteren und dem oberen, me
Krönung Mnriä darstellenden Teil des Bildes hergestellt. Es ist unverkennbar, wie wert der Kmfitler
gegenüber dem Rosenkranzbilde vorangeschritten ist. Wie viel mehr monumentale Ruhe und Große
herrscht hier, zumal in den Apostclqestalten! Zwar ist in den Köpfen immer noch allzifiehr das ^u-
fällige, Menschlich-Alltägliche ausgeprügt, sodaß der Ausdruck gcistiger Grvße in ihnen mcht innner
erreicht ist, aber wundervoll in Wurf und Plastik sind die Gewänder. . . .
Auch in dieseni Gemälde hat Dürer sein Selbstbildnis angebracht. Er steht mitten ni dcr lchoncn
abwechslungsreichen Landschaft des Hintergrnndes und blickt, eine Jnschrifttafel vor fich haltend, mit
berechtigtem Künstlerstolz aus dem Bilde. ^ ^ .. ^ ^
Ein weiteres Hauptwerk Dürers ist uns glücklicherwcise unvcrsehrt erhalten, uamlufi oav grope
Allerheiligenbild vom Jahre 1511. Der Grundgedanke ist der Apokalppse entnommen (Apok. il, .
Die Gemeinde der Heiligen, das neue Jerusalem, senkt sich hernieder vom Himmel zur Erde in
2*
müßten eingestehen, schreibt er, ,daß sie schönere Farben noch me gesehen . d^
Strahow in Prag befindliche Original durch ungünstige Schrchale und oftere Uebermalung^
gelitten, daß uns sogar die alte Kopie im Wiener Hofmuseum eme befiere ^orstcllung von ^urciv
Mensalls^ei'ne s^ucht des Aufenthalts in Venedig und zmar cine viel refi'ere als das sich mirklich
bild ist der kleine Kfinzifixus in der Dresdener Galerie (entstanden ^1o06). l-'rdet suh wEch
die feine Stimmung Bellinischer Kunst mit deutschem Empfinden restlov ^7?^
schaft ist hier ganz bewußt der Stimmung des Ganzen drenstbar gemacht. ^ i s
Finsternis auf dem kleinen Streifen Natur, nur dort am Horrzont webt em fahlev,
Karfreitagsstnnmung l Selbst die Birken lassen wie trauernd rhr Laub hangen. ^ ^
allein. Geisterhaft schimmert sein straff ausgespannter, feingeblldeter Lerb aus dem 'ukefi geffe^
slattern die Enden des Schamtuches. Wieviel sanftes ergebenes Lulden spricht aus dem Hellam.-
antlitz unter der
schweren Dornen-
kronel Es ist der
letzte Augenblick:
„Vater, in deine
Hände empfehle ich
meinen Geistl"
Ein Haupt-
werk unter den Ge-
mäldenDürers,das
HellerscheAltar-
bild, ist uns leider
nichtmehr erhalten.
Gerade auf dieses
Bild hatte Dürer
unsäglichen Fleiß
verwendet. Eine
Anzahl von Hand-
zeichnungen beweist
uns heute noch,
wie gründlich der
Meister es mit den
Vorstudicn genom-
men, wie er jede
Hand und jeden
Fuß, jede Draperie
sorgfältig nach Mo-
dellen gezeichnet
hat, und aus dem
noch erhaltenen
Briefwechsel mit
dem Besteller geht
hervor, wie diese
TafelaucheinWun-
derwerk maltechni
scher Gewissenhcff
Christus am Kreuze
t506. Dresdener Galerie
tigkeit war. Nur
die besten, teuersten
Farben kamen zur
Verwendung und
Dürer selbst meinte
alles getan zu ha-
ben, damit das Bild
noch nach fünfhun-
dert Jahren haltbar
und frisch sei. Leider
ging das herrliche
Werk bei einem
Brandeimkurfürst-
lichen Schlosse zu
München, wohin es
gekommen war, zu-
grundeundwirsind
zur Beurteilung
desselben auf eine
ziemlich unbedeu-
tende Kopie ange-
wiesen. Das Bild
stelltedieKrönung
Mariä nach der
bekannten Legende
dar. Die Apostel
sind zum Grabe
Mariens hinausge-
gangen und finden
dasselbe zu ihrem
Erstaunen leer.
Während die einen
noch suchend in
dessen Tiefe blicken,
andere erregt sich
besprechen, haben
die beiden Äpostelfürsten im Vordergrunde ihren Blick nach Oben gerichtet, wo der Himmel ftch aus
getan hat, und sie nun die Krönung der Gottesmutter schauen. Durch diese beiden aufwärt^ blickeiu cn
Gestalten ist fein und ungezwungen eine Verbindung zwischen dem unteren und dem oberen, me
Krönung Mnriä darstellenden Teil des Bildes hergestellt. Es ist unverkennbar, wie wert der Kmfitler
gegenüber dem Rosenkranzbilde vorangeschritten ist. Wie viel mehr monumentale Ruhe und Große
herrscht hier, zumal in den Apostclqestalten! Zwar ist in den Köpfen immer noch allzifiehr das ^u-
fällige, Menschlich-Alltägliche ausgeprügt, sodaß der Ausdruck gcistiger Grvße in ihnen mcht innner
erreicht ist, aber wundervoll in Wurf und Plastik sind die Gewänder. . . .
Auch in dieseni Gemälde hat Dürer sein Selbstbildnis angebracht. Er steht mitten ni dcr lchoncn
abwechslungsreichen Landschaft des Hintergrnndes und blickt, eine Jnschrifttafel vor fich haltend, mit
berechtigtem Künstlerstolz aus dem Bilde. ^ ^ .. ^ ^
Ein weiteres Hauptwerk Dürers ist uns glücklicherwcise unvcrsehrt erhalten, uamlufi oav grope
Allerheiligenbild vom Jahre 1511. Der Grundgedanke ist der Apokalppse entnommen (Apok. il, .
Die Gemeinde der Heiligen, das neue Jerusalem, senkt sich hernieder vom Himmel zur Erde in
2*