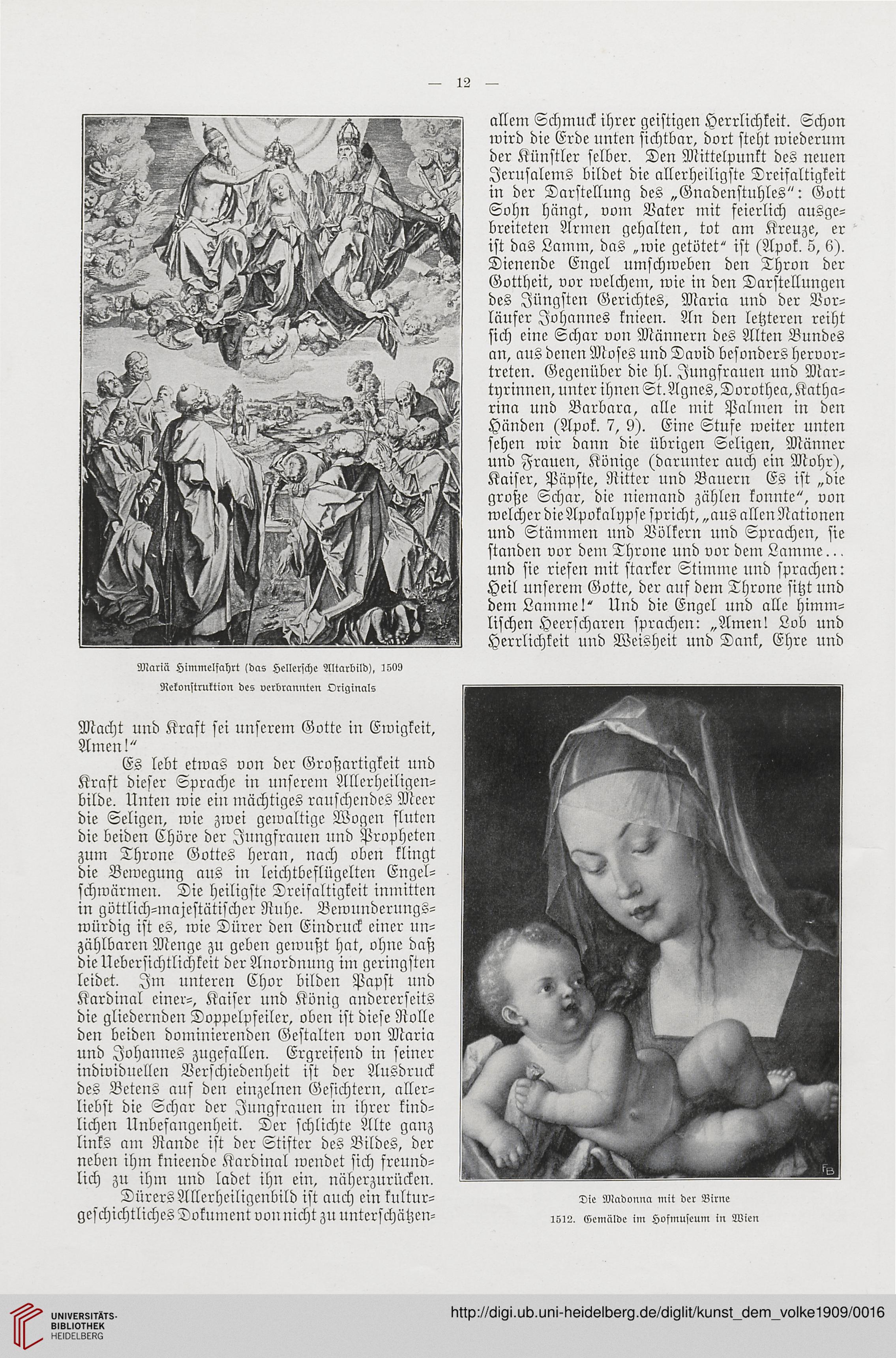12 —
Mariä Himmelfahrt >das Hellerfche Altarbild), I5»g
allem Schmuck ihrer geistigen Herrlichkeit. Schon
wird die Erde unten sichtbar, dort steht wiederum
der Künstler selber. Den Mittelpunkt des neuen
Jerusalems bildet die allerheiligste Dreifaltigkeit
in der Darstellung des „Gnadenstuhles": Gott
Sohn hängt, vom Vater mit feierlich ausge-
breiteten Armen gehalten, tot am Kreuze, er
ist das Lamm, das „wie getötet" ist (Apok. 5, 6).
Dienende Engel umschweben den Thron der
Gottheit, vor welchem, wie in den Darstellungen
des Jüngsten Gerichtes, Maria und der Vor-
läufer Johannes knieen. An den letzteren reiht
sich eine Schar von Männern des Alten Bundes
an, aus denen Moses und David besonders hervor-
treten. Gegenüber die hl. Jungfrauen und Atar-
tyrinnen, unter ihnen St.Agnes, Dorothea, Katha-
rina und Barbara, alle mit Palmen in den
Händen (Apok. 7, 9). Eine Stufe weiter unten
sehen wir dann die übrigen Seligen, Männer
und Frauen, Könige (darunter auch ein Mohr),
Kaiser, Päpste, Ritter und Bauern Es ist „die
große Schar, die niemand zählen konnte", von
welcherdieApokalypse spricht,„ausallenNationen
und Stämmen nnd Völkern und Sprachen, sie
standen vor dem Throne und vor dem Lamme...
und sie riefen mit starker Stimme und sprachen:
Heil unserem Gotte, der aus dem Throne sitzt und
dem Lamme!" Und die Engel und alle himm-
lischen Heerscharen sprachen: „Amen! Lob und
Herrlichkeit und Weisheit und Dank, Ehre und
Nekonstruktion des verbrannten Originals
Macht und Kraft sei unserem Gotte in Ewigkeit,
Amen!"
Es lebt etwas von der Großartigkeit und
Kraft dieser Sprache in unserem Allerheiligen-
bilde. llnten wie ein mächtiges rauschendes Meer
die Seligen, wie zwei gewaltige Wogen slutcn
die beiden Chöre der Jungfrauen und Propheten
zum Throne Gottes heran, nach oben klingt
die Bewegung aus in leichtbeflügelten Engel-
schwärmen. Die heiligste Dreifaltigkeit inmitten
in göttlich-majestätischer Ruhe. Bewunderungs-
würdig ist es, wie Dürer den Eindruck einer un-
zählbaren Menge zu geben gewußt hat, ohne daß
die llebersichtlichkeit der Anordnung im geringsten
leidet. Jm unteren Chor bilden Papst und
Kardinal einer-, Kaiser und König andererseits
die gliedernden Doppelpfeiler, oben ist diese Rolle
den beiden dominierenden Gestalten von Maria
und Johannes zugefallen. Ergreifend in seiner
individuellen Verschiedenheit ist der Ausdruck
des Betens aus den einzelnen Gesichtern, aller-
liebst die Schar der Jungfrauen in ihrer kind-
lichen llnbefangenheit. Der schlichte Alte ganz
links am Rande ist der Stifter des Bildes, der
neben ihm knieende Kardinal wendet sich sreund-
lich zu ihm und ladet ihn ein, näherzurücken.
Dürers Allerheiligenbild ist auch ein kultur-
geschichtlichesDokumentvonnichtzuunterschätzen-
Die Madonna nrit der Birne
1512. Gemälde im Hofrnuseum in Wien
Mariä Himmelfahrt >das Hellerfche Altarbild), I5»g
allem Schmuck ihrer geistigen Herrlichkeit. Schon
wird die Erde unten sichtbar, dort steht wiederum
der Künstler selber. Den Mittelpunkt des neuen
Jerusalems bildet die allerheiligste Dreifaltigkeit
in der Darstellung des „Gnadenstuhles": Gott
Sohn hängt, vom Vater mit feierlich ausge-
breiteten Armen gehalten, tot am Kreuze, er
ist das Lamm, das „wie getötet" ist (Apok. 5, 6).
Dienende Engel umschweben den Thron der
Gottheit, vor welchem, wie in den Darstellungen
des Jüngsten Gerichtes, Maria und der Vor-
läufer Johannes knieen. An den letzteren reiht
sich eine Schar von Männern des Alten Bundes
an, aus denen Moses und David besonders hervor-
treten. Gegenüber die hl. Jungfrauen und Atar-
tyrinnen, unter ihnen St.Agnes, Dorothea, Katha-
rina und Barbara, alle mit Palmen in den
Händen (Apok. 7, 9). Eine Stufe weiter unten
sehen wir dann die übrigen Seligen, Männer
und Frauen, Könige (darunter auch ein Mohr),
Kaiser, Päpste, Ritter und Bauern Es ist „die
große Schar, die niemand zählen konnte", von
welcherdieApokalypse spricht,„ausallenNationen
und Stämmen nnd Völkern und Sprachen, sie
standen vor dem Throne und vor dem Lamme...
und sie riefen mit starker Stimme und sprachen:
Heil unserem Gotte, der aus dem Throne sitzt und
dem Lamme!" Und die Engel und alle himm-
lischen Heerscharen sprachen: „Amen! Lob und
Herrlichkeit und Weisheit und Dank, Ehre und
Nekonstruktion des verbrannten Originals
Macht und Kraft sei unserem Gotte in Ewigkeit,
Amen!"
Es lebt etwas von der Großartigkeit und
Kraft dieser Sprache in unserem Allerheiligen-
bilde. llnten wie ein mächtiges rauschendes Meer
die Seligen, wie zwei gewaltige Wogen slutcn
die beiden Chöre der Jungfrauen und Propheten
zum Throne Gottes heran, nach oben klingt
die Bewegung aus in leichtbeflügelten Engel-
schwärmen. Die heiligste Dreifaltigkeit inmitten
in göttlich-majestätischer Ruhe. Bewunderungs-
würdig ist es, wie Dürer den Eindruck einer un-
zählbaren Menge zu geben gewußt hat, ohne daß
die llebersichtlichkeit der Anordnung im geringsten
leidet. Jm unteren Chor bilden Papst und
Kardinal einer-, Kaiser und König andererseits
die gliedernden Doppelpfeiler, oben ist diese Rolle
den beiden dominierenden Gestalten von Maria
und Johannes zugefallen. Ergreifend in seiner
individuellen Verschiedenheit ist der Ausdruck
des Betens aus den einzelnen Gesichtern, aller-
liebst die Schar der Jungfrauen in ihrer kind-
lichen llnbefangenheit. Der schlichte Alte ganz
links am Rande ist der Stifter des Bildes, der
neben ihm knieende Kardinal wendet sich sreund-
lich zu ihm und ladet ihn ein, näherzurücken.
Dürers Allerheiligenbild ist auch ein kultur-
geschichtlichesDokumentvonnichtzuunterschätzen-
Die Madonna nrit der Birne
1512. Gemälde im Hofrnuseum in Wien