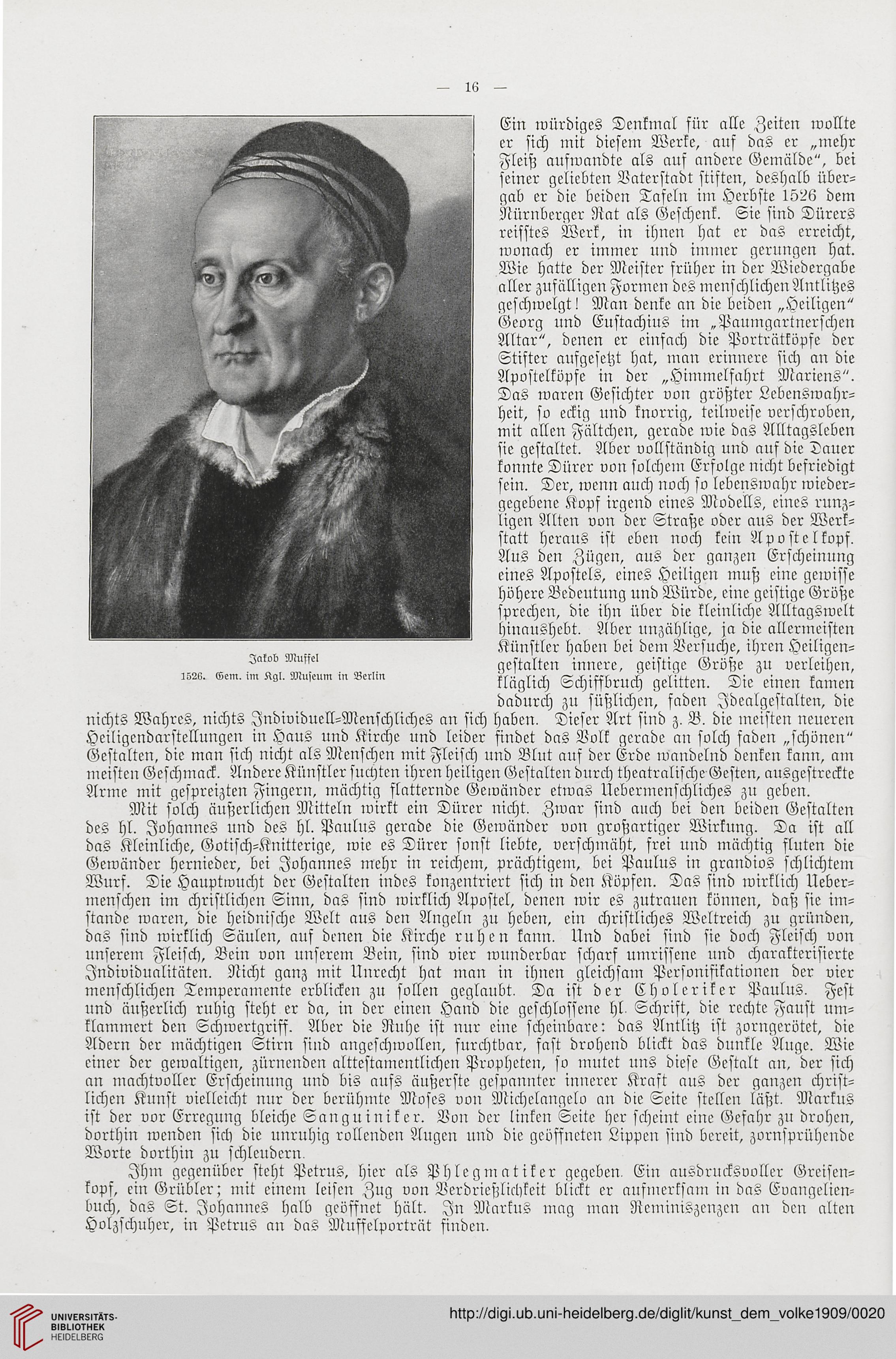16
Ein nmrdiges Denkmal für alle Zeiten wollte
er sich mit diesem Werke, auf das er „mehr
Fleiß aufwandte als auf andere Gemälde", bei
feiner gelicbten Vaterstadt stiften, deshalb über-
gab er die beiden Tafeln im Herbfte 1526 dem
Nürnberger Rat als Geschenk. Sie sind Dürers
reisstes Werk, in ihnen hat er das erreicht,
wonach er immer und immer gerungen hat.
Wie hatte der Meifter früher in der Wiedergabe
aller zufülligen Formen des menschlichenAntlitzes
geschwelgt! Man denke an die beiden „Heiligen"
Georg und Eustachius im „Paumgartnerschen
Altar", denen er einfach die Porträtköpfe der
Stifter aufgesetzt hat, man erinnere sich an die
Apostelköpfe in der „Himmelfahrt Mariens".
Das waren Gesichter von größter Lebenswahr-
heit, so eckig und knorrig, teilweise verschroben,
mit allen Fältchen, gerade wie das Alltagsleben
sie gestaltet. Aber vollständig und auf die Dauer
konnte Dürer von solchem Erfolge nicht befriedigt
sein. Der, wenn auch noch so lebenswahr wieder-
gegebene Kopf irgend eines Modells, eines runz-
ligen Alten von der Straße oder aus der Werk-
ftatt heraus ist eben noch kein Apostelkopf.
Aus den Zügen, aus der ganzen Erscheinung
eines Apostels, eines Heiligen muß eine gemisse
höhere Bedeutung und Würde, eine geistige Größe
sprechen, die ihn über die kleinliche Alltagswelt
hinaushebt. Aber unzählige, ja die allermeisten
Künstler habeu bei dem Versuche, ihren Heiligen-
gestalten innere, geistige Größe zu verleihen,
kläglich Schiffbruch gelitten. Die einen kamen
dadurch zu süßlichen, faden Jdealgestalten, die
nichts Wahres, nichts Jndividuell-Menschliches an sich haben. Dieser Art sind z. B. die meisten neueren
Heiligendarstellungen in Haus und Kirche und leider findet das Volk gerade an solch faden „schönen"
Gestalten, die man sich nicht als Menschen mit Fleisch und Blut auf der Erde mandelnd denken kann, am
meisteu Geschmack. Andere Künstler suchten ihren heiligen Gestalten durch theatralische Gesten, ausgestreckte
Arme mit gespreizten Fingern, mächtig flatternde Geivänder etwas Uebermenschliches zu geben.
Mit solch äußerlichen Mitteln wirkt ein Dürer nicht. Zwar sind auch bei den beiden Gestalten
des hl. Johannes und des HI. Paulus gerade die Gewänder von großartiger Wirkung. Da ist all
das Kleinliche, Gotisch-Knitterige, wie es Dürer sonst liebte, verschmäht, frei und mächtig sluten die
Gewänder hernieder, bei Johannes mehr in reichem, prächtigem, bei Paulus in grandios schlichtem
Wurf. Die Hauptwucht der Gestalten indes konzentriert sich in den Köpfen. Das sind wirklich Ueber-
menschen im christlichen Sinn, das sind wirklich Apostel, denen wir es zutrauen können, daß sie im-
stande waren, die heidnische Welt aus den Angeln zu heben, ein christliches Weltreich zu gründen,
das sind wirklich Säulen, auf denen die Kirche ruhen kann. Und dabei sind sie doch Fleisch von
unserem Fleisch, Bein von unserem Bein, sind vier wunderbar scharf umrissene und charakterisierte
Jndividualitäten. Nicht ganz mit Unrecht hat man in ihnen gleichsam Personifikationen der vier
menschlichen Temperamente erblicken zu sollen geglaubt. Da ist der Choleriker Paulus. Fest
und äußerlich ruhig steht er da, in der einen Hand die geschlossene hl. Schrift, die rcchte Faust um-
klammert den Schwertgriff. Aber die Ruhe ist nur eine scheinbare: das Antlitz ist zorngerötet, die
Adern der mächtigen Stirn siud angeschwollen, furchtbar, fast drohend blickt das dunkle Auge. Wie
einer der gewaltigen, zürnenden alttestamentlichen Propheten, so mutet uns diese Gestalt an, der sich
an machtvoller Erscheinung und bis aufs äußerste gespannter inuerer Kraft aus der ganzen christ-
lichen Kunst vielleicht nur der berühmte Moses von Michelangelo an die Seite stelleu läßt. Markus
ist der vor Erregung bleiche Sanguiniker. Von der linken Seite her scheint eine Gefahr zu drohen,
dorthin wenden sich die unruhig rollenden Augen und die gevffneten Lippen sind bereit, zornsprühende
Worte dorthin zu schleudern.
Jhm gegenüber steht Petrus, hier als PHIegmatiker gegeben. Ein ausdrucksvoller Greisen-
kopf, ein Grübler; mit einem leisen Zug von Verdrießliehkeit blickt er ansmerksam in das Evangelien-
buch, das St. Johannes halb geöffnet hält. Jn Markus mag man Reminiszenzen an den alten
Holzschuher, in Petrus an das Muffelporträt finden.
Jalob Muffel
IS2S. Eem. im Kgl. Museum iu Berlin
Ein nmrdiges Denkmal für alle Zeiten wollte
er sich mit diesem Werke, auf das er „mehr
Fleiß aufwandte als auf andere Gemälde", bei
feiner gelicbten Vaterstadt stiften, deshalb über-
gab er die beiden Tafeln im Herbfte 1526 dem
Nürnberger Rat als Geschenk. Sie sind Dürers
reisstes Werk, in ihnen hat er das erreicht,
wonach er immer und immer gerungen hat.
Wie hatte der Meifter früher in der Wiedergabe
aller zufülligen Formen des menschlichenAntlitzes
geschwelgt! Man denke an die beiden „Heiligen"
Georg und Eustachius im „Paumgartnerschen
Altar", denen er einfach die Porträtköpfe der
Stifter aufgesetzt hat, man erinnere sich an die
Apostelköpfe in der „Himmelfahrt Mariens".
Das waren Gesichter von größter Lebenswahr-
heit, so eckig und knorrig, teilweise verschroben,
mit allen Fältchen, gerade wie das Alltagsleben
sie gestaltet. Aber vollständig und auf die Dauer
konnte Dürer von solchem Erfolge nicht befriedigt
sein. Der, wenn auch noch so lebenswahr wieder-
gegebene Kopf irgend eines Modells, eines runz-
ligen Alten von der Straße oder aus der Werk-
ftatt heraus ist eben noch kein Apostelkopf.
Aus den Zügen, aus der ganzen Erscheinung
eines Apostels, eines Heiligen muß eine gemisse
höhere Bedeutung und Würde, eine geistige Größe
sprechen, die ihn über die kleinliche Alltagswelt
hinaushebt. Aber unzählige, ja die allermeisten
Künstler habeu bei dem Versuche, ihren Heiligen-
gestalten innere, geistige Größe zu verleihen,
kläglich Schiffbruch gelitten. Die einen kamen
dadurch zu süßlichen, faden Jdealgestalten, die
nichts Wahres, nichts Jndividuell-Menschliches an sich haben. Dieser Art sind z. B. die meisten neueren
Heiligendarstellungen in Haus und Kirche und leider findet das Volk gerade an solch faden „schönen"
Gestalten, die man sich nicht als Menschen mit Fleisch und Blut auf der Erde mandelnd denken kann, am
meisteu Geschmack. Andere Künstler suchten ihren heiligen Gestalten durch theatralische Gesten, ausgestreckte
Arme mit gespreizten Fingern, mächtig flatternde Geivänder etwas Uebermenschliches zu geben.
Mit solch äußerlichen Mitteln wirkt ein Dürer nicht. Zwar sind auch bei den beiden Gestalten
des hl. Johannes und des HI. Paulus gerade die Gewänder von großartiger Wirkung. Da ist all
das Kleinliche, Gotisch-Knitterige, wie es Dürer sonst liebte, verschmäht, frei und mächtig sluten die
Gewänder hernieder, bei Johannes mehr in reichem, prächtigem, bei Paulus in grandios schlichtem
Wurf. Die Hauptwucht der Gestalten indes konzentriert sich in den Köpfen. Das sind wirklich Ueber-
menschen im christlichen Sinn, das sind wirklich Apostel, denen wir es zutrauen können, daß sie im-
stande waren, die heidnische Welt aus den Angeln zu heben, ein christliches Weltreich zu gründen,
das sind wirklich Säulen, auf denen die Kirche ruhen kann. Und dabei sind sie doch Fleisch von
unserem Fleisch, Bein von unserem Bein, sind vier wunderbar scharf umrissene und charakterisierte
Jndividualitäten. Nicht ganz mit Unrecht hat man in ihnen gleichsam Personifikationen der vier
menschlichen Temperamente erblicken zu sollen geglaubt. Da ist der Choleriker Paulus. Fest
und äußerlich ruhig steht er da, in der einen Hand die geschlossene hl. Schrift, die rcchte Faust um-
klammert den Schwertgriff. Aber die Ruhe ist nur eine scheinbare: das Antlitz ist zorngerötet, die
Adern der mächtigen Stirn siud angeschwollen, furchtbar, fast drohend blickt das dunkle Auge. Wie
einer der gewaltigen, zürnenden alttestamentlichen Propheten, so mutet uns diese Gestalt an, der sich
an machtvoller Erscheinung und bis aufs äußerste gespannter inuerer Kraft aus der ganzen christ-
lichen Kunst vielleicht nur der berühmte Moses von Michelangelo an die Seite stelleu läßt. Markus
ist der vor Erregung bleiche Sanguiniker. Von der linken Seite her scheint eine Gefahr zu drohen,
dorthin wenden sich die unruhig rollenden Augen und die gevffneten Lippen sind bereit, zornsprühende
Worte dorthin zu schleudern.
Jhm gegenüber steht Petrus, hier als PHIegmatiker gegeben. Ein ausdrucksvoller Greisen-
kopf, ein Grübler; mit einem leisen Zug von Verdrießliehkeit blickt er ansmerksam in das Evangelien-
buch, das St. Johannes halb geöffnet hält. Jn Markus mag man Reminiszenzen an den alten
Holzschuher, in Petrus an das Muffelporträt finden.
Jalob Muffel
IS2S. Eem. im Kgl. Museum iu Berlin