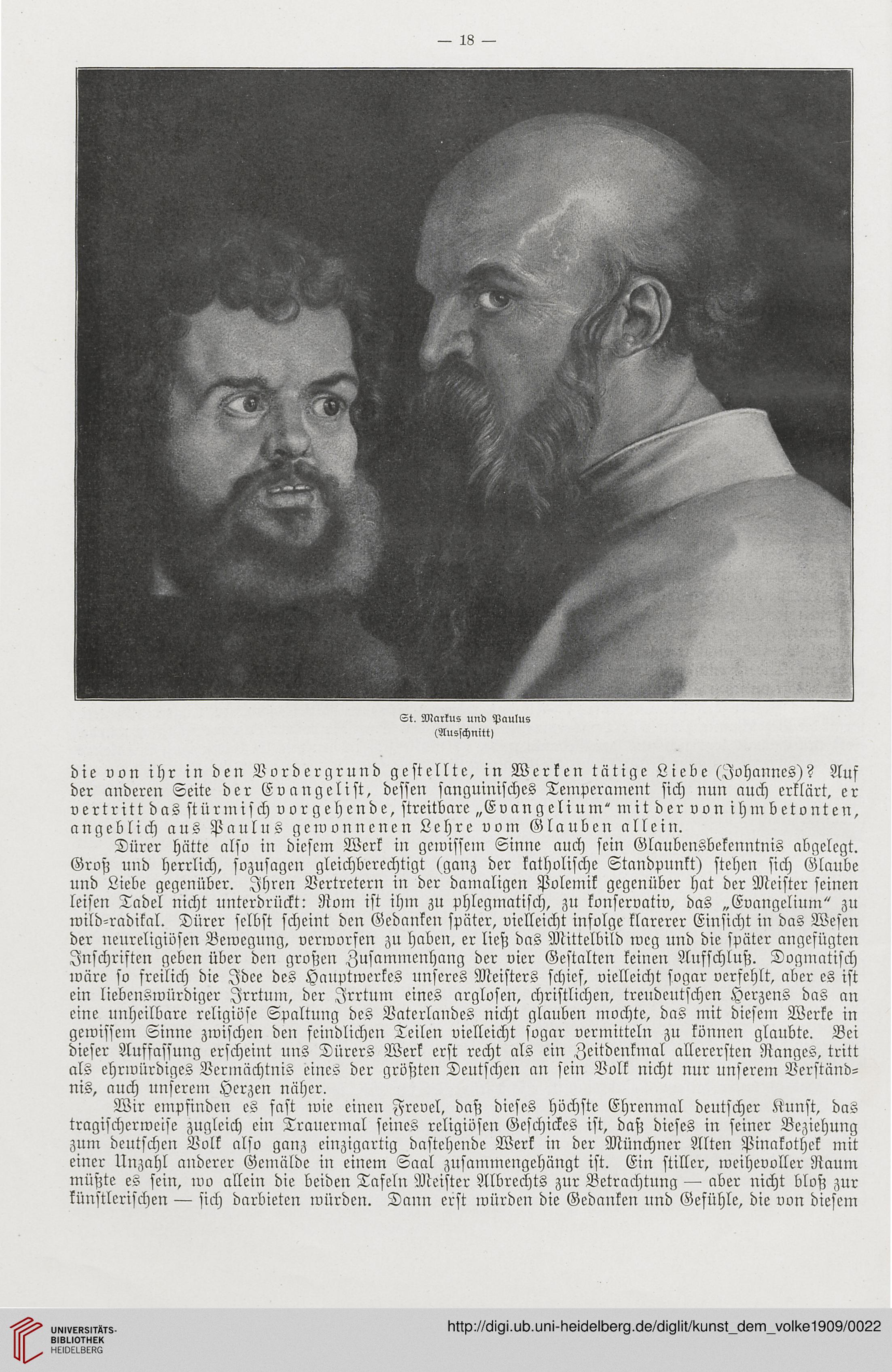18
St. Markus und Paulus
(Ausschnitt)
die von ihr in den Vordergrund gestellte, in Werken tätige Liebe (Johannes)? Auf
der anderen Seite der Evangelist, dessen sanguinisches Temperament sich nun auch erklärt, er
vertritt das stürmisch vorgehende, streitbare „Evangelium" mit der von ihmbetonten,
angeblich aus Paulus gewonnenen Lehre vom Glauben allein.
Dürer hätte also in diesem Werk in geivissem Sinne auch sein Glaubensbekenntnis abgelegt.
Groß und herrlich, sozusagen gleichberechtigt (ganz der katholische Standpunkt) stehen sich Glaube
und Liebe gegenüber. Jhren Vertretern in der damaligen Polemik gegenüber hat der Meister seinen
leisen Tadel nicht unterdrückt: Rom ist ihm zu phlegmatisch, zu konservativ, das „Evangelium" zu
wild-radikal. Dürer selbst scheint den Gedanken später, vielleicht infolge klarerer Einsicht in das Wesen
der neureligiösen Bewegung, verworfen zu haben, er ließ das Mittelbild weg und die später angefügten
Jnschriften geben über den großen Zusammenhang der vier Gestalten keinen Aufschluß. Dogmatisch
wäre so freilich die Jdee des Hauptwerkes unseres Meisters schief, vielleicht sogar verfehlt, aber es ist
ein liebenswürdiger Jrrtum, der Jrrtum eines arglosen, christlichen, treudeutschen Herzens das an
eine unheilbare religiöse Spaltung des Vaterlandes nicht glauben mochte, das mit diesem Werke in
gewissem Sinne zwischen den feindlichen Teilen vielleicht sogar vermitteln zu können glaubte. Bei
dieser Auffassung erscheint uns Dürers Werk erst recht als ein Zeitdenkmal allerersten Ranges, tritt
als ehrwürdiges Vermächtnis eines der größten Deutschen an sein Volk nicht nur unserem Verständ-
nis, auch unserem Herzen näher.
Wir empfinden es fast wie einen Frevel, daß dieses höchste Ehrenmal deutscher Kunst, das
tragischerweise zugleich ein Trauermal seines religiösen Geschickes ist, daß dieses in seiner Beziehung
zum deutschen Volk also ganz einzigartig dastehende Werk in der Münchner Alten Pinakothek mit
einer Unzahl anderer Gemälde in einem Saal zusammengehängt ist. Ein stiller, weihevoller Raum
müßte es sein, ivo allein die beiden Tafeln Meister Albrechts zur Betrachtung — aber nicht bloß zur
künstlerischen — sich darbieten würden. Dann erst würden die Gedanken und Gefühle, die von diesem
St. Markus und Paulus
(Ausschnitt)
die von ihr in den Vordergrund gestellte, in Werken tätige Liebe (Johannes)? Auf
der anderen Seite der Evangelist, dessen sanguinisches Temperament sich nun auch erklärt, er
vertritt das stürmisch vorgehende, streitbare „Evangelium" mit der von ihmbetonten,
angeblich aus Paulus gewonnenen Lehre vom Glauben allein.
Dürer hätte also in diesem Werk in geivissem Sinne auch sein Glaubensbekenntnis abgelegt.
Groß und herrlich, sozusagen gleichberechtigt (ganz der katholische Standpunkt) stehen sich Glaube
und Liebe gegenüber. Jhren Vertretern in der damaligen Polemik gegenüber hat der Meister seinen
leisen Tadel nicht unterdrückt: Rom ist ihm zu phlegmatisch, zu konservativ, das „Evangelium" zu
wild-radikal. Dürer selbst scheint den Gedanken später, vielleicht infolge klarerer Einsicht in das Wesen
der neureligiösen Bewegung, verworfen zu haben, er ließ das Mittelbild weg und die später angefügten
Jnschriften geben über den großen Zusammenhang der vier Gestalten keinen Aufschluß. Dogmatisch
wäre so freilich die Jdee des Hauptwerkes unseres Meisters schief, vielleicht sogar verfehlt, aber es ist
ein liebenswürdiger Jrrtum, der Jrrtum eines arglosen, christlichen, treudeutschen Herzens das an
eine unheilbare religiöse Spaltung des Vaterlandes nicht glauben mochte, das mit diesem Werke in
gewissem Sinne zwischen den feindlichen Teilen vielleicht sogar vermitteln zu können glaubte. Bei
dieser Auffassung erscheint uns Dürers Werk erst recht als ein Zeitdenkmal allerersten Ranges, tritt
als ehrwürdiges Vermächtnis eines der größten Deutschen an sein Volk nicht nur unserem Verständ-
nis, auch unserem Herzen näher.
Wir empfinden es fast wie einen Frevel, daß dieses höchste Ehrenmal deutscher Kunst, das
tragischerweise zugleich ein Trauermal seines religiösen Geschickes ist, daß dieses in seiner Beziehung
zum deutschen Volk also ganz einzigartig dastehende Werk in der Münchner Alten Pinakothek mit
einer Unzahl anderer Gemälde in einem Saal zusammengehängt ist. Ein stiller, weihevoller Raum
müßte es sein, ivo allein die beiden Tafeln Meister Albrechts zur Betrachtung — aber nicht bloß zur
künstlerischen — sich darbieten würden. Dann erst würden die Gedanken und Gefühle, die von diesem