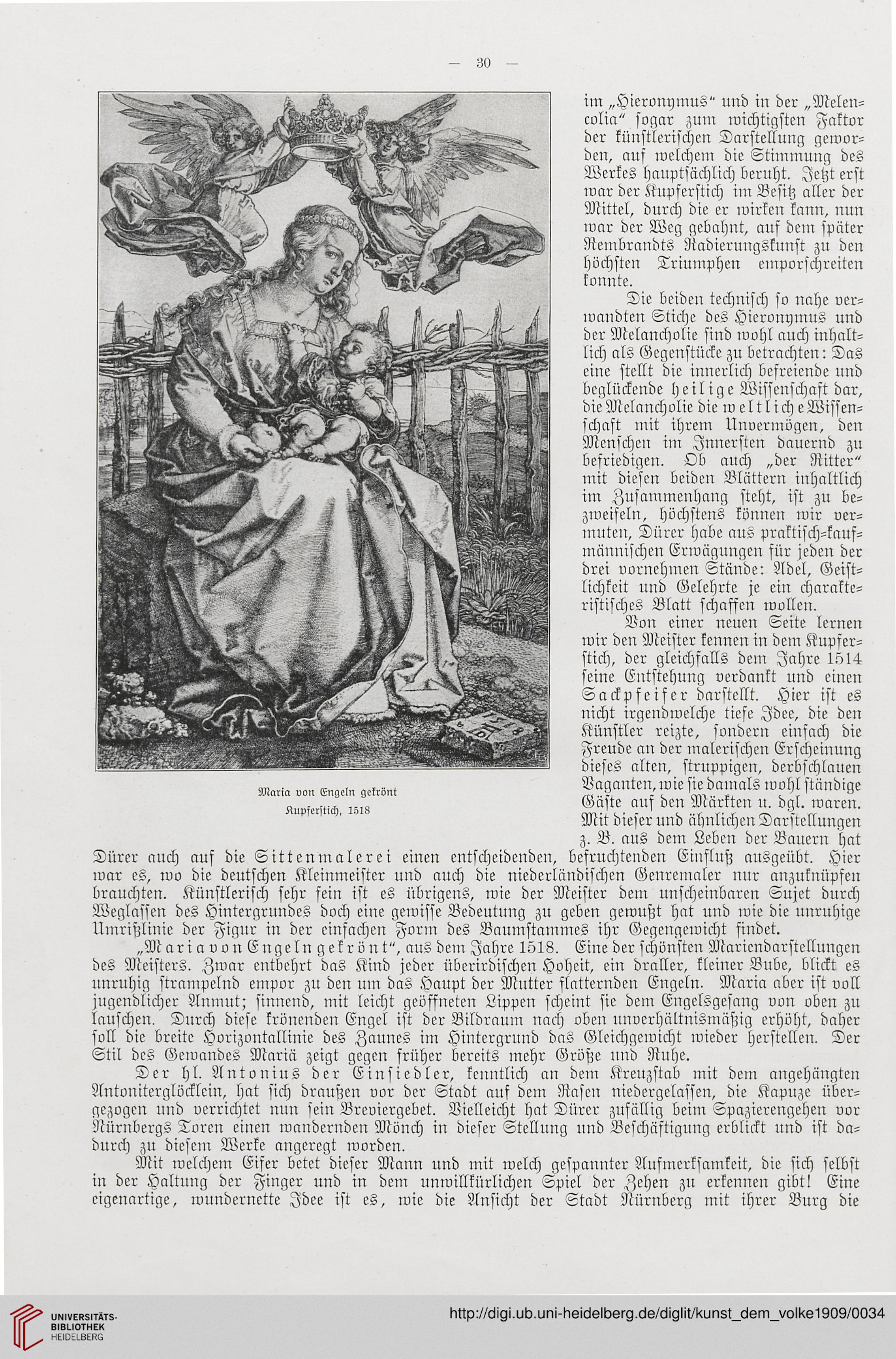30
im „Hieronymus" und in der „Melen-
colia" sogar zum michtigsten Faktor
der künstlerischen Darstellung gewor-
den, auf ivelchem die Stimmung des
Werkes hauptsächlich beruht. Jetzt erst
war der Kupferstich im Besitz aller der
Mittel, durch die er wirken kann, nun
war der Weg gebahnt, auf dem später
Rembrandts Radierungskunst zu den
höchsten Triumphen emporschreiten
konnte.
Die beiden technisch so nahe ver-
wandten Stiche des Hieronymus und
der Melancholie sind wohl auch inhalt-
lich als Gegenstücke zu betrachten: Das
eine stellt die innerlich befreiende und
beglückende heilige Wissenschaft dar,
die Melancholie dieweltliche Wissen-
schaft mit ihrem Unvermögen, den
Menschen im Jnnersten dauerud zu
befriedigen. Ob auch „der Ritter"
mit diesen beiden Blättern inhaltlich
im Zusammenhang steht, ist zu be-
zweifelu, höchstens können wir ver-
muten, Dürer habe aus praktisch-kauf-
männischen Erwägungen für jeden der
drei vornehmen Stände: Adel, Geist-
lichkeit und Gelehrte je ein charakte-
ristisches Blatt schaffen wollen.
Von einer neuen Seite lernen
wir den Meister kennen in dem Kupser-
stich, der gleichfalls dem Jahre 1514
seine Entstehung verdankt und einen
Sackpfeifer darstellt. Hier ist es
nicht irgendwelche tiefe Jdee, die den
Künstler reizte, sondern einfach die
Freude an der malerischen Erscheinung
dieses alten, struppigen, derbschlauen
Vaganten, wie sie damals wohl ständige
Gäste auf den Märkten u. dgl. waren.
Mit dieser und ähnlichcn Darstellungen
z. B. aus dem Leben der Bauern hat
Dürer auch auf die Sittenmalerei einen entscheidenden, befruchteuden Einfluß nusgeübt. Hier
war es, wo die deutschen Kleinmeister und auch die niederländischen Genremaler nur anzuknttpfen
brauchten. Künstlerisch sehr fein ist es übrigens, wie der Meister dem unscheinbaren Sujet durch
Weglassen des Hintergrundes doch eine gewisse Bedeutung zu geben gewußt hat und wie die unruhige
Umrißlinie der Figur in der cinfachen Form des Baumstainines ihr Gegengewicht findet.
„M ari avonEngelngekrön t", aus dem Jahre 1518. Eine der schönsten Maricndarstellungen
des Meisters. Zwar entbehrt das Kind jeder überirdischen Hoheit, ein draller, kleiner Bube, blickt es
unruhig strampelnd empor zu den um das Haupt der Mutter flatternden Engeln. Maria aber ist voll
jugendlicher Anmut; sinnend, mit leicht geöffneten Lippen scheint sie dem Engelsgesang von oben zu
lauschen. Durch diese krönenden Engel ist der Bildraum nach oben unverhältnismäßig erhöht, daher
soll die breite Horizontallinie des Zaunes im Hintergrund das Gleichgewicht wieder herstellen. Der
Stil des Geivandes Mariä zeigt gegen früher bereits mehr Größe und Ruhe.
Der hl. Antonius der Einsiedler, kcnntlich an dem Kreuzstah mit dem angehängten
Antoniterglöcklein, hat sich draußen vor der Stadt auf dem Rasen niedergelassen, die Kapuze über-
gezogen und verrichtet nun sein Breviergebet. Vielleicht hat Dürer zufällig beim Spazierengehen vor
Nürnbergs Toren einen wandernden Mönch in dieser Stellung und Beschäftigung erblickt und ist da-
durch zu diesem Werke angeregt worden.
Mit welchem Eifer betet dieser Mann und mit welch gespannter Aufmerksamkeit, die sich selbst
in der Haltung der Finger und in dem unwillkürlichen Spiel der Zehen zu erkennen gibt! Eine
eigenartige, wundernette Jdee ist es, wie die Ansicht der Stadt Nürnberg mit ihrer Burg die
Maria von Engeln gekrönt
Kupferstich, 1518
im „Hieronymus" und in der „Melen-
colia" sogar zum michtigsten Faktor
der künstlerischen Darstellung gewor-
den, auf ivelchem die Stimmung des
Werkes hauptsächlich beruht. Jetzt erst
war der Kupferstich im Besitz aller der
Mittel, durch die er wirken kann, nun
war der Weg gebahnt, auf dem später
Rembrandts Radierungskunst zu den
höchsten Triumphen emporschreiten
konnte.
Die beiden technisch so nahe ver-
wandten Stiche des Hieronymus und
der Melancholie sind wohl auch inhalt-
lich als Gegenstücke zu betrachten: Das
eine stellt die innerlich befreiende und
beglückende heilige Wissenschaft dar,
die Melancholie dieweltliche Wissen-
schaft mit ihrem Unvermögen, den
Menschen im Jnnersten dauerud zu
befriedigen. Ob auch „der Ritter"
mit diesen beiden Blättern inhaltlich
im Zusammenhang steht, ist zu be-
zweifelu, höchstens können wir ver-
muten, Dürer habe aus praktisch-kauf-
männischen Erwägungen für jeden der
drei vornehmen Stände: Adel, Geist-
lichkeit und Gelehrte je ein charakte-
ristisches Blatt schaffen wollen.
Von einer neuen Seite lernen
wir den Meister kennen in dem Kupser-
stich, der gleichfalls dem Jahre 1514
seine Entstehung verdankt und einen
Sackpfeifer darstellt. Hier ist es
nicht irgendwelche tiefe Jdee, die den
Künstler reizte, sondern einfach die
Freude an der malerischen Erscheinung
dieses alten, struppigen, derbschlauen
Vaganten, wie sie damals wohl ständige
Gäste auf den Märkten u. dgl. waren.
Mit dieser und ähnlichcn Darstellungen
z. B. aus dem Leben der Bauern hat
Dürer auch auf die Sittenmalerei einen entscheidenden, befruchteuden Einfluß nusgeübt. Hier
war es, wo die deutschen Kleinmeister und auch die niederländischen Genremaler nur anzuknttpfen
brauchten. Künstlerisch sehr fein ist es übrigens, wie der Meister dem unscheinbaren Sujet durch
Weglassen des Hintergrundes doch eine gewisse Bedeutung zu geben gewußt hat und wie die unruhige
Umrißlinie der Figur in der cinfachen Form des Baumstainines ihr Gegengewicht findet.
„M ari avonEngelngekrön t", aus dem Jahre 1518. Eine der schönsten Maricndarstellungen
des Meisters. Zwar entbehrt das Kind jeder überirdischen Hoheit, ein draller, kleiner Bube, blickt es
unruhig strampelnd empor zu den um das Haupt der Mutter flatternden Engeln. Maria aber ist voll
jugendlicher Anmut; sinnend, mit leicht geöffneten Lippen scheint sie dem Engelsgesang von oben zu
lauschen. Durch diese krönenden Engel ist der Bildraum nach oben unverhältnismäßig erhöht, daher
soll die breite Horizontallinie des Zaunes im Hintergrund das Gleichgewicht wieder herstellen. Der
Stil des Geivandes Mariä zeigt gegen früher bereits mehr Größe und Ruhe.
Der hl. Antonius der Einsiedler, kcnntlich an dem Kreuzstah mit dem angehängten
Antoniterglöcklein, hat sich draußen vor der Stadt auf dem Rasen niedergelassen, die Kapuze über-
gezogen und verrichtet nun sein Breviergebet. Vielleicht hat Dürer zufällig beim Spazierengehen vor
Nürnbergs Toren einen wandernden Mönch in dieser Stellung und Beschäftigung erblickt und ist da-
durch zu diesem Werke angeregt worden.
Mit welchem Eifer betet dieser Mann und mit welch gespannter Aufmerksamkeit, die sich selbst
in der Haltung der Finger und in dem unwillkürlichen Spiel der Zehen zu erkennen gibt! Eine
eigenartige, wundernette Jdee ist es, wie die Ansicht der Stadt Nürnberg mit ihrer Burg die
Maria von Engeln gekrönt
Kupferstich, 1518