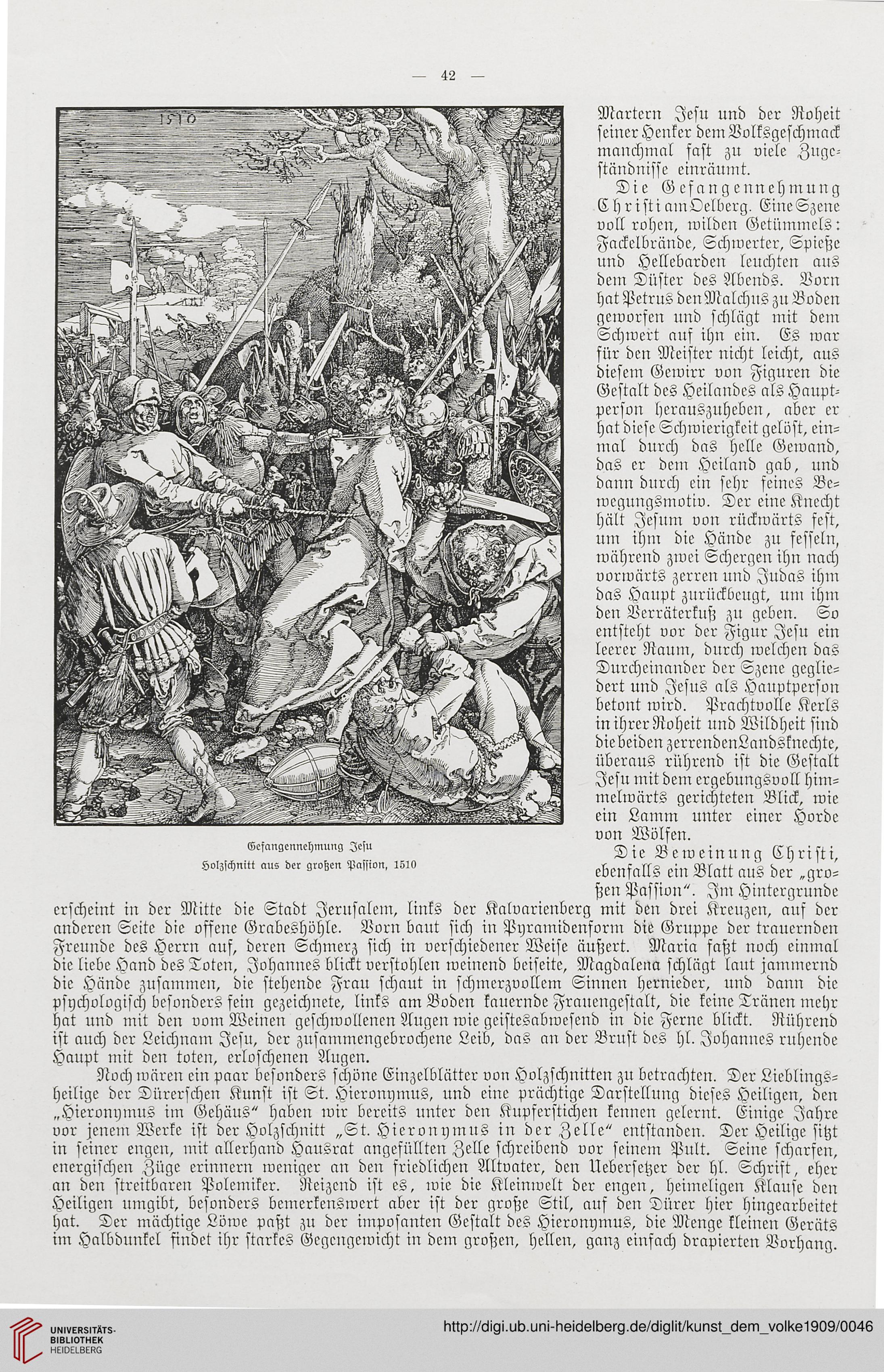Martecn Jesu und der Roheit
seiner Henker demVolksgeschmack
manchmal fast zu viele Zuge-
ständnisse einräumt.
Die G efangennehmung
Christiam Oelberg. Eine Szene
voll rohcn, wilden Getümmels:
Fackelbrände, Schwerter, Spicße
und Hellebarden leuchten aus
dem Düster des Abends. Vorn
hat Petrus denMalchus zu Boden
geworfen und schlcigt mit dem
Schwert nuf ihn ein. Es war
für den Meister nicht leicht, aus
diesem Gewirr von Figuren die
Gestalt des Heilandes als Haupt-
person herauszuheben, aber er
hat diese Schwierigkeit gelöst, ein-
mal durch das helle Gewand,
das er dem Heiland gab, und
dann durch ein sehr feines Be-
wegungsmotiv. Der eine Knecht
hält Jesum von rückwärts fest,
um ihm die Hände zu fesseln,
mährend zwei Schergen ihn nach
vorwärts zerren und Judas ihm
das Haupt zurückbeugt, uni ihm
den Verräterkuß zu geben. So
entsteht vor der Figur Jesu ein
leerer Raum, durch welchen das
Durcheinander der Szene geglie-
dert und Jesus als Hauptperson
betont wird. Prachtvolle Kerls
inihrerRoheit und Wildheit sind
diebeiden zerrendenLandsknechte,
überaus rührend ist die Gestalt
Jesn mit dem ergebungsvoll him-
melwärts gerichteten Blick, wie
ein Lamm unter einer Horde
von Wölfen.
Die Beweinung Christi,
ebenfalls ein Blatt aus der „gro-
ßen Passion". Jm Hintergrunde
erscheint in der Mitte die Stadt Jerusalem, links der Kalvarienberg mit den drei Kreuzen, auf der
anderen Seite die ofsene Grabeshöhle. Vorn baut sich iu Ppramidenform die Gruppe der trauernden
Freunde des Herrn auf, deren Schmerz sich in verschiedener Weise äußert. Maria faßt noch einmal
die liebe Hand des Toten, Johannes blickt verstohlen weincnd beiseite, Magdalena schlägt laut jammernd
die Hände zusammen, die stehende Frau schaut in schmerzvollem Sinnen hernieder, und dann die
pspchologisch besonders fein gezeichnete, links am Boden kauernde Franengestalt, die keine Tränen mehr
hat und mit den vom Weinen geschwollenen Augen wie geistesabwesend in die Ferne blickt. Rührend
ist auch der Leichnam Jesu, der zusammengebrochene Leib, das an der Brust des hl. Johanues ruhende
Haupt mit den toten, erloschenen Augen.
Noch wären ein paar besonders schöne Einzelblätter vou Holzschnitten zu betrachten. Der Lieblings-
heilige der Dürerschen Kunst ist St. Hieronpmus, und eine prächtige Darstellung dieses Heiligen, den
„Hieronpmus im Gehäus" haben wir bereits unter den Kupferstichen kennen gelernt. Einige Jahre
vor jenem Werke ist der Holzschnitt „St. Hieronpmus in der Zelle" entstanden. Der Heilige sitzt
in seincr engen, mit allerhand Hausrat angefüllten Zelle fchreibend vor seinem Pult. Seine schnrfen,
energischen Züge erinnern weniger an den friedlichen Altvater, den Uebersetzer der hl. Schrift, eher
an den streitbaren Polemiker. Reizend ist es, wie die Kleinwelt der engen, heimeligen Klause den
Heiligen umgibt, besonders bemerkenswcrt aber ist der große Stil, auf den Dürer hier hingearbeitet
hat. Der mächtige Löwe paßt zu der imposanten Gestalt des Hieronymus, die Menge kleinen Geräts
im Halbdunkel findet ihr starkes Gegengewicht in dem großen, hellen, ganz einfach drapierten Vorhang.
Eefangennehmung Jesu
Holzschnitt aus der großen Passion, 1510
seiner Henker demVolksgeschmack
manchmal fast zu viele Zuge-
ständnisse einräumt.
Die G efangennehmung
Christiam Oelberg. Eine Szene
voll rohcn, wilden Getümmels:
Fackelbrände, Schwerter, Spicße
und Hellebarden leuchten aus
dem Düster des Abends. Vorn
hat Petrus denMalchus zu Boden
geworfen und schlcigt mit dem
Schwert nuf ihn ein. Es war
für den Meister nicht leicht, aus
diesem Gewirr von Figuren die
Gestalt des Heilandes als Haupt-
person herauszuheben, aber er
hat diese Schwierigkeit gelöst, ein-
mal durch das helle Gewand,
das er dem Heiland gab, und
dann durch ein sehr feines Be-
wegungsmotiv. Der eine Knecht
hält Jesum von rückwärts fest,
um ihm die Hände zu fesseln,
mährend zwei Schergen ihn nach
vorwärts zerren und Judas ihm
das Haupt zurückbeugt, uni ihm
den Verräterkuß zu geben. So
entsteht vor der Figur Jesu ein
leerer Raum, durch welchen das
Durcheinander der Szene geglie-
dert und Jesus als Hauptperson
betont wird. Prachtvolle Kerls
inihrerRoheit und Wildheit sind
diebeiden zerrendenLandsknechte,
überaus rührend ist die Gestalt
Jesn mit dem ergebungsvoll him-
melwärts gerichteten Blick, wie
ein Lamm unter einer Horde
von Wölfen.
Die Beweinung Christi,
ebenfalls ein Blatt aus der „gro-
ßen Passion". Jm Hintergrunde
erscheint in der Mitte die Stadt Jerusalem, links der Kalvarienberg mit den drei Kreuzen, auf der
anderen Seite die ofsene Grabeshöhle. Vorn baut sich iu Ppramidenform die Gruppe der trauernden
Freunde des Herrn auf, deren Schmerz sich in verschiedener Weise äußert. Maria faßt noch einmal
die liebe Hand des Toten, Johannes blickt verstohlen weincnd beiseite, Magdalena schlägt laut jammernd
die Hände zusammen, die stehende Frau schaut in schmerzvollem Sinnen hernieder, und dann die
pspchologisch besonders fein gezeichnete, links am Boden kauernde Franengestalt, die keine Tränen mehr
hat und mit den vom Weinen geschwollenen Augen wie geistesabwesend in die Ferne blickt. Rührend
ist auch der Leichnam Jesu, der zusammengebrochene Leib, das an der Brust des hl. Johanues ruhende
Haupt mit den toten, erloschenen Augen.
Noch wären ein paar besonders schöne Einzelblätter vou Holzschnitten zu betrachten. Der Lieblings-
heilige der Dürerschen Kunst ist St. Hieronpmus, und eine prächtige Darstellung dieses Heiligen, den
„Hieronpmus im Gehäus" haben wir bereits unter den Kupferstichen kennen gelernt. Einige Jahre
vor jenem Werke ist der Holzschnitt „St. Hieronpmus in der Zelle" entstanden. Der Heilige sitzt
in seincr engen, mit allerhand Hausrat angefüllten Zelle fchreibend vor seinem Pult. Seine schnrfen,
energischen Züge erinnern weniger an den friedlichen Altvater, den Uebersetzer der hl. Schrift, eher
an den streitbaren Polemiker. Reizend ist es, wie die Kleinwelt der engen, heimeligen Klause den
Heiligen umgibt, besonders bemerkenswcrt aber ist der große Stil, auf den Dürer hier hingearbeitet
hat. Der mächtige Löwe paßt zu der imposanten Gestalt des Hieronymus, die Menge kleinen Geräts
im Halbdunkel findet ihr starkes Gegengewicht in dem großen, hellen, ganz einfach drapierten Vorhang.
Eefangennehmung Jesu
Holzschnitt aus der großen Passion, 1510